Vor wenigen Wochen hat Maxime Buck sein Studium an der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich begonnen. Computerwissenschaften – ein Fach, das ihn schon seit Jahren fasziniert und für das er wie geschaffen scheint.
Die Aufnahme an der ETH allein ist bereits bemerkenswert. Im europäischen Vergleich rangiert die Hochschule ganz oben, noch vor Oxford oder Cambridge. „Nach Großbritannien wollte ich besonders wegen dem Brexit nicht, da das noch ein Stück komplizierter geworden wäre. Außerdem ist das Studieren dort viel teurer“, begründet Buck seine Entscheidung pragmatisch. Am Lycée Michel Rodange hatte er zuvor seine Première in der Mathematik- und Informatik-Sektion abgeschlossen.
Die ETH Zürich zählt zu den besten Universitäten der Welt und ist nun das neue akademische Zuhause von Maxime Buck. Foto: Shutterstock
Zwischen Lego-Steinen und Jules Verne
Wer verstehen will, wie aus einem Jungen aus Luxemburg ein international ausgezeichneter Jungforscher wird, muss bei den Anfängen beginnen. Bei Science-Fiction-Büchern im Haus seiner Großeltern zum Beispiel. Sein Großvater war ein leidenschaftlicher Jules-Verne-Sammler, und so wuchs Buck umgeben von Zukunftsvisionen und technischen Träumen auf.
Seine eigene Begeisterung für Science-Fiction entwickelte sich dann vor allem durch eigene Lektüre und Filme. Heute liest er „eigentlich von allem“, wie er sagt, aber wenn man ihn nach einer Empfehlung fragt, nennt er „The Three-Body Problem“ von Liu Cixin – jene Buchreihe, die kürzlich als Netflix-Serie für Aufsehen sorgte.
Ein entscheidender Moment war, als mein Vater die Idee hatte, mich an der Luxembourg Tech School einzuschreiben.
Maxime Buck
Student und Jungforscher
Schon als Kind wollte Buck immer wissen, was hinter den Dingen steckt, wie Sachen funktionieren. „Ich habe auch immer schon gerne Legos gebaut und war einfach von solchen Sachen fasziniert“, erinnert er sich. Das Werkeln, das Tüfteln, das Ausprobieren – das zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Buck ist eben nicht nur jemand, der theoretisch brilliert, sondern auch praktisch anpackt.
Lesen Sie auch:Schwerelos über Luxemburg: 40 Jugendliche dem Weltall so nahe
Dass daraus mehr werden würde als ein Hobby, dafür sorgte eine Entscheidung seines Vaters. „Ein entscheidender Moment war, als mein Vater die Idee hatte, mich an der Luxembourg Tech School einzuschreiben. Das war der eigentliche Anfang, dort habe ich zum ersten Mal Programmieren gelernt und auch vom Jonk Fuerscher Projekt erfahren.“
Die Wissenschaft scheint in der Familie zu liegen. Auch seine Geschwister sind sehr interessiert – seine Schwester träumt sogar davon, Astronautin zu werden. Man kann sich vorstellen, wie die Gespräche am Familientisch verlaufen.
Die Kletterhalle war sogar einer der Gründe, warum ich meine Wohnung genau hier genommen habe
Maxime Buck
Student und Jungforscher
Wenn Buck nicht am Computer sitzt oder an Projekten bastelt, findet man ihn in der Kletterhalle. Dreimal pro Woche geht er bouldern – Klettern ohne Seil über dicken Matten. „Es ist wie ein Puzzle, das man jedes Mal lösen muss. Auch hier muss man ruhig bleiben; es ist vor allem ein Wettkampf gegen sich selbst.“
Für Maxime Buck ist das Klettern ein guter Ausgleich und geht dreimal pro Woche klettern. Foto: privat
In Zürich hat er eine große Halle gefunden, nur zehn Minuten mit dem Rad entfernt. „Das war sogar einer der Gründe, warum ich meine Wohnung genau hier genommen habe“, gesteht er. Manche wählen ihre Wohnung nach der Miete, Buck nach der Nähe zur Boulderwand.
Roboter, die sich selbst zusammenbauen
Buck ist an der ETH noch dabei, sich einzugewöhnen. Doch er ist dort nicht unter Fremden. Einige Gesichter kennt er bereits – teils aus Luxemburg, teils von den internationalen Wissenschaftswettbewerben, die ihn in den letzten Jahren um die halbe Welt geführt haben.
Es begann vor einigen Jahren mit dem „Jonk Fuerscher National Contest“ der „Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg“ (FJSL). Buck entwickelte Projekt um Projekt, meist mit starkem Bezug zu Computerwissenschaften. Sein erstes großes Projekt war „Marbles VR“, ein VR-Spiel mit Handtracking. Doch sein ehrgeizigstes Werk ist „M.I.R.A.S.“ – ein Robotersystem, das sich selbst zusammenbaut und dabei Mechanik, Elektronik sowie künstliche Intelligenz vereint.
Sein bislang aufwendigstes Projekt war „M.I.R.A.S.“, ein Robotersystem, das sich selbst zusammenbaut. Foto: FJSL
Die Idee dahinter klingt wie Science-Fiction: Kleine, identische Roboter, die sich selbstständig neu zusammenbauen können, um sich verschiedenen Aufgaben anzupassen. „Normale Roboter sind dazu gar nicht imstande, da sie in der Regel für ganz spezifische Aufgaben gebaut werden“, erklärt Buck. Die Modularität eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Selber-rekonfigurierende modulare Roboter sind ein Bereich der Robotik, der noch in den Kinderschuhen steckt – und Buck arbeitet bereits daran.
Wie viel Zeit er in solche Projekte investiert? „Viel! Eigentlich immer dann, wenn ich nichts Dringenderes zu tun habe.“ Man kann sich vorstellen, dass „Dringenderes“ für Buck eine relative Definition ist.
Von Dallas über Taiwan nach China
Der Erfolg beim nationalen Wettbewerb öffnete Buck Türen zu internationalen Bühnen. 2023 führte ihn der Weg nach Dallas zur „International Science and Engineering Fair“ (ISEF) – 1.800 Teilnehmer, einer der größten Wissenschaftswettbewerbe der Welt. Im vergangenen Jahr folgte Taiwan, wo er bei der Taiwan International Science Fair den ersten Preis in der Kategorie „Computer Science and Information Engineering“ gewann.
Vor wenigen Wochen dann China: Hohhot, Hauptstadt der Inneren Mongolei. Beim „China Adolescents Science & Technology Innovation Contest“ (CASTIC) trat er gegen 50 internationale und mehr als 500 chinesische Teilnehmer an. Anders als zuvor ging es diesmal nicht darum, das eigene Projekt zu präsentieren, sondern mehrere Challenges zu meistern. Schnelles Denken, eigenständiges Arbeiten unter Druck.
Maxime Buck gemeinsam mit Moritz Rohner bei der „Taiwan International Science Fair“ Anfang 2025. Foto: FJSL
Gruppenfoto der Preisträger des diesjährigen „China Adolescents Science & Technology Innovation Contest“. Maxime Buck ist ganz links zu sehen. Foto: FJSL


Und Buck räumte mehrere Sonderpreise ab. Besonders stolz ist er auf eine Auszeichnung eines Unternehmens, das auf Quantencomputer spezialisiert ist. „Dadurch habe ich Zugang zu einer großen Auswahl an Inhalten bekommen, durch die ich weiter lernen kann.“ Dazu kamen ein Geldpreis und wertvolle Kontakte zu Universitäten.
Wie fühlt es sich an, vor einer internationalen Jury zu stehen? „Anfangs war ich bei solchen Wettbewerben nervös, inzwischen herrscht eher Vorfreude“, sagt Buck. „Es macht richtig Spaß, nach einem 3-Minuten-Pitch mit Professoren ins Gespräch zu kommen. Ihre Fragen bringen manchmal völlig neue Perspektiven, auf die man allein nie gekommen wäre.“
In China war ich beeindruckt, wie leicht er mit anderen in Kontakt kam.
Sousana Eang
FJSL-Direktorin
Was bei solchen Wettbewerben entsteht, geht über Preise und Medaillen hinaus. „Bei jedem Wettbewerb entstehen neue, oft unerwartete Kontakte. Man sitzt plötzlich nachts mit Leuten aus Australien oder Brasilien zusammen. Einige dieser Bekanntschaften sind bis heute richtige Freundschaften, mit denen ich regelmäßig schreibe.“
Die Reisen bieten auch kulturelle Einblicke. In China besuchte Buck die Chinesische Mauer und die Verbotene Stadt in Peking. Als angehender Informatiker, der sich mit Überwachungstechnologien auskennt, hatte er einen nüchternen Blick auf das Land. „Man ist sich der Überwachung bewusst, da dort wirklich an jeder Straßenecke gefühlt 20 Kameras hängen.“ Unwohl habe er sich dennoch nicht gefühlt. „Ich habe einfach einen VPN benutzt, um die Internetsperren zu umgehen“, erklärt er trocken.
Teil der Reise nach China war auch ein Kulturprogramm. So besuchte Maxime Buck unter anderem die Chinesische Mauer und die Verbotene Stadt in Peking. Foto: FJSL
Auch die lokale Küche kam nicht zu kurz, wobei es platzmäßig manchmal etwas eng war. Foto: FJSL
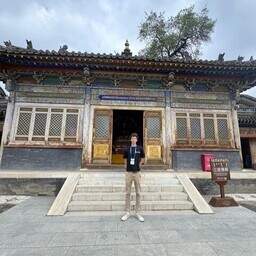

Eine Fondation als Sprungbrett
Dass Buck all diese Erfahrungen machen konnte, verdankt er der FJSL. „Das Team der Fondation ist über die Jahre auch fast schon zu Freunden von mir geworden“, sagt er. Sein Antrieb war dabei weniger, Luxemburg zu repräsentieren, sondern vielmehr, sich selbst zu fördern. Die diplomatische Arbeit überlässt er Sousana Eang, der Direktorin der Fondation, die ihn auf seinen Reisen begleitete.
Dennoch hat es einen gewissen Reiz, die luxemburgische Flagge in die Welt zu tragen. „Es ist definitiv cool, auf diesem Weg anderen Menschen beizubringen, dass es Luxemburg überhaupt gibt.“ Manche hielten ihn für einen Niederländer, eine Russin wollte ihm nicht glauben, dass Luxemburgisch eine eigene Sprache ist. „Daraufhin haben wir kurz gemeinsam gegoogelt“, erinnert er sich lachend.
Der wichtigste Moment seiner Laufbahn? „Auf jeden Fall die Teilnahme beim Jonk Fuerscher Contest. Dort habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass meine Projekte für andere wirklich relevant sind.“ Als er Marbles VR vorstellte, probierten es hunderte Menschen aus. „Viele vergaßen völlig die Welt um sich herum und wollten gar nicht mehr aufhören zu spielen. Dieses Erlebnis war eine riesige Motivation und hat mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“
Irgendwie war quasi jeder am Set von ‚Take Off‘ sich sicher, dass er einer der Finalisten sein würde
Joseph Rodesch
„Take Off“-Host
Eang kennt Maxime seit mehreren Jahren und betont, dass es eine „absolute Freude war, ihn sowohl als jungen Wissenschaftler als auch als Person wachsen zu sehen. In China war ich beeindruckt, wie leicht er mit anderen in Kontakt kam. Nach langen Tagen wissenschaftlicher Herausforderungen während des Wettbewerbs verbrachte er schlaflose Nächte damit, sich mit seinen neuen Freunden zu unterhalten, nicht nur über ihre wissenschaftlichen Projekte, sondern um sie besser kennenzulernen.“
Laut der Direktorin der Fondation war sein starkes Ergebnis, Platz 15 von 50 Projekten, eine herausragende Anerkennung seiner Arbeit. „Aber woran ich mich am meisten erinnern werde, ist seine Großzügigkeit im Geiste und seine echte Liebe zur Entdeckung.“
Stressresistenz durch Fernsehshow
Eine weitere prägende Erfahrung war Bucks Teilnahme an der zweiten Staffel von „Take Off“, der Wissenschaftsshow vom „Fonds National de la Recherche“ und der „André Losch Fondation.“ Hierbei müssen mehrere junge Menschen anfangs in Teams, später alleine Aufgaben lösen, die stets einen wissenschaftlichen Bezug haben. Hier zahlte sich nicht nur sein wissenschaftliches Know-how aus, sondern auch sein handwerkliches Geschick.
Maxime Buck war dieses Jahr auch Teil der Wissenschaftsshow „Take Off“. Foto: Emmanuel Claude/Focalize
Hier lernte er, mit extremem Stress umzugehen und verblüffte mit seiner Kreativität. Foto: Emmanuel Claude/Focalize
Am Ende stand er sogar im Finale. Foto: Emmanuel Claude/Focalize
Was bleibt, ist vor allem die Erinnerung an extremen Stress. „Ich glaube, dank ‚Take Off‘ werde ich nie wieder gestresst sein in meinem Leben“, sagt Buck lachend. „Denn sowohl vor als auch während den Aufgaben war es so unglaublich stressig, da kann im Grunde mich jetzt nichts mehr aus der Ruhe bringen.“ Wenn heute etwas Anstrengendes ansteht, denkt er sich: „Du hast ‚Take Off‘ gemacht, das hier ist nichts im Vergleich.“
Die Show half ihm auch, seine Kamerascheu zu überwinden und Einblicke in die Fernsehproduktion zu gewinnen. „Während der Show wurde mir auch klar, dass es gar nicht so wichtig ist, wie gut ich abschneide, sondern dass es hauptsächlich um den eigenen Spaß geht.“ Dann wird er noch praktischer: „Und selbst wenn man das Preisgeld gewinnen würde, wäre es bei den vielen Stunden, die wir beim Drehen aber auch in der Vorbereitung verbracht haben, am Ende weniger als der Mindestlohn“, witzelt er.
Lesen Sie auch:Luxemburg sucht die Super-Leuchte
Für Lucie Zeches und Joseph Rodesch, zwei der Hosts von „Take Off“, ist Maxime ein bodenständiger Überflieger. „Irgendwie war quasi jeder am Set von ‚Take Off‘ sich sicher, dass er einer der Finalisten sein würde“, erklärt Rodesch auf Nachfrage. „Das Gewinnen war zweitrangig für ihn, er wollte vor allem derjenige sein, der die coolste Maschine baut.“ Mit seiner Kreativität und seinem handwerklichen Können, habe er die Latte der Rube-Goldberg-Maschinen, die die Finalisten von „Take Off“ bauen sollten, Rodesch zufolge auf ein neues Niveau gehoben.
Für Joseph Rodesch und Lucie Zeches ist Maxime ein bodenständiger Überflieger. Foto: Marc Wilwert
Zwischen Hörsaal und Hackathon
An der ETH ist Buck nun in einer neuen Realität angekommen. „Die Kombination aus harter Theorie und einem hohen Tempo macht das Studium sehr herausfordernd. Es gibt viel Mathe“, erklärt er. Doch das Umfeld motiviert: „Gleichzeitig ist man umgeben von sehr schlauen Leuten mit ähnlichen Interessen, ihr Niveau zieht einen automatisch mit und motiviert stark.“
Was ist die größte Herausforderung an der ETH? Buck lacht. „Nicht Mathe, sondern einen freien Platz in der Mensa oder im Hörsaal zu finden.“
Am meisten Spaß macht es mir, an Projekten zu arbeiten, die multidisziplinär sind und verschiedene Welten verbinden.
Maxime Buck
Student und Jungforscher
Das Angebot an Clubs und Aktivitäten ist überwältigend. „Es gibt so viele verschiedene Angebote, dass es wirklich schwer war, sich zu entscheiden.“ Buck hat sich für einen Hackathon angemeldet, den großen Makerspace mit 3D-Druckern, Lasercuttern und VR/AR-Geräten sowie den Entrepreneurship Club. Auch der „Luxemburg Studentenzirkel in Zürich“ (LSZ) gehört dazu. „Die organisieren regelmäßig Events, zum Beispiel war ich kürzlich mit ihnen im Europapark.“
Offene Türen in die Zukunft
Was nach dem Bachelor kommt? Buck lässt sich bewusst Zeit mit der Antwort. „Ich habe viele Interessen, deshalb lasse ich bewusst das erste Jahr auf mich wirken, um zu sehen, wohin es mich zieht.“ Ein Master, ein Startup, die Forschung – vieles ist möglich. „Am meisten Spaß macht es mir, an Projekten zu arbeiten, die multidisziplinär sind und verschiedene Welten verbinden.“
Seine Interessengebiete lesen sich wie ein Who‘s Who der Zukunftstechnologien: KI, Robotik, genetische Evolutionsalgorithmen, Blockchain. „Besonders spannend finde ich es, wenn sich diese Felder überschneiden, zum Beispiel, wenn evolutionäre Algorithmen Robotersteuerungen optimieren.“
Was er nach seinem Bachelor an der ETH machen wird, da ist sich Maxime Buck noch nicht ganz sicher. Ihm stehen jedoch viele Türen offen.
Welches Problem er gerne lösen würde? Buck wird nachdenklich. „Oft weiß man anfangs gar nicht, wofür die eigene Arbeit einmal nützlich sein wird und vieles ist erstmal nur ein Testen von Ideen.“ Er nennt sein Marbles-VR-Projekt als Beispiel. „Das klingt vielleicht wie ein Spielereiprojekt, öffnet aber die Tür für Menschen mit weniger Budget oder eingeschränktem Zugang zu Hardware, weil man plötzlich keinen teuren Controller mehr braucht.“
In zehn Jahren? „Hoffentlich nicht mehr an der ETH!“ Er lacht. „Bis dahin möchte ich längst im Berufsleben stehen. Die ETH soll der Anfang sein, nicht das Ziel.“ Eine Rückkehr nach Luxemburg kann er sich grundsätzlich vorstellen. Das kleine Land mit seinen engen Netzwerken hat durchaus seinen Reiz.
Ratschläge eines 19-Jährigen
Theoretisch könnte Buck noch einige Jahre bei der FJSL mitmachen – der Wettbewerb ist für junge Menschen bis 21 Jahre offen. Aktuell steht aber das Studium im Mittelpunkt. „Wenn ich die Zeit finde, würde ich definitiv gerne wieder teilnehmen. Aber auch hier an der Universität werde ich mit Aktivitäten, Clubs und Ähnlichem bombardiert. Es gibt also ausreichend Optionen für mich.“
Für andere junge Forscher hat Buck einen klaren Rat: „Sie sollten sich für ein Projekt entscheiden, für das sie brennen. Darüber hinaus sollte es, um möglichst weit zu kommen oder gar etwas zu gewinnen, außerdem in irgendeiner Form innovativ sein, etwas Neues bieten.“
Lesen Sie auch:Silber für Nachwuchsforscher aus Luxemburg in New York
Und für alle, die unsicher sind, ob sie „gut genug“ für Wissenschaft oder anspruchsvolle Studiengänge sind? Bucks Antwort ist einfach und ermutigend: „Wenn es einem Spaß macht, ist man schon auf dem richtigen Weg.“
Ein neues Kapitel beginnt für Maxime Buck – eines, das zweifellos weitere spannende Entwicklungen bereithält. Man darf gespannt sein, wo dieser Weg hinführt. Bei jemandem, der mit 19 bereits mehr erreicht hat als die meisten in einem ganzen Leben, sind die Möglichkeiten grenzenlos.
