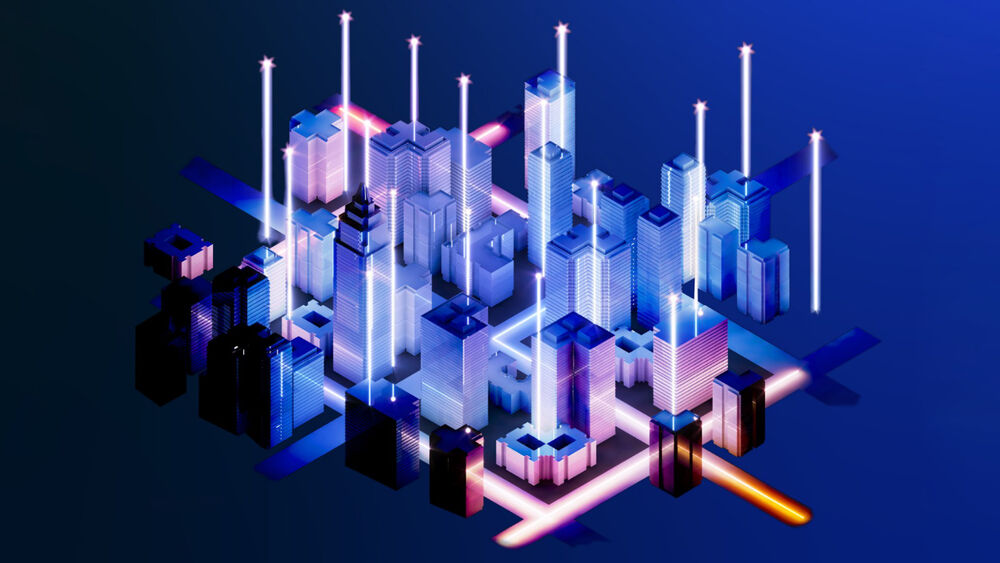Europas Innovationschance
McKinsey sieht in Deep Tech Billionenpotenzial – doch Europas Vorsprung ist fragil
Anbieter zum Thema
Forschung, Talente und Industrie geben Europa eine starke Ausgangsbasis für Deep-Tech-Innovationen. Doch laut McKinsey droht der alte Fehler: zu viel Wissen, zu wenig Wagnis.
 Europa kann laut McKinsey mit Deep Tech bis 2030 eine Billion US-Dollar Wert schaffen – wenn Kapital, Politik und Forschung zusammenspielen.
Europa kann laut McKinsey mit Deep Tech bis 2030 eine Billion US-Dollar Wert schaffen – wenn Kapital, Politik und Forschung zusammenspielen.
(Bild: McKinsey)
Europa hat den Anschluss an die großen digitalen Wachstumswellen verpasst – von der Internetökonomie bis zu globalen Cloud-Plattformen. Doch bei Deep Tech, also bei Technologien mit starkem wissenschaftlichem Fundament wie Quantencomputing, Robotik, Fusion oder neuartiger KI, könnte sich das Blatt wenden. Eine Analyse von McKinsey sieht die Region vor einer historischen Chance: Wenn Politik, Kapitalgeber und Forschung enger verzahnt agieren, ließen sich bis 2030 bis zu eine Billion US-Dollar an Unternehmenswert und eine Million Arbeitsplätze schaffen.
Die Studie zeigt, dass Europas Ökosystem aus Start-ups, Industrie und Universitäten grundsätzlich intakt ist. Hochqualifizierte Fachkräfte, starke Forschung und eine solide industrielle Basis bilden ein stabiles Fundament. Doch Skalierung, Kapital und Regulierung bleiben die altbekannten Bremsen – und entscheiden darüber, ob Europa diesmal den Sprung schafft.
 Forschung auf Weltniveau, Kapital weiter knapp
Forschung auf Weltniveau, Kapital weiter knapp
McKinsey unterscheidet acht Deep-Tech-Felder: Novel AI, Future of Compute, Novel Energy, Advanced Materials, Robotics, Space Tech, Defence Tech sowie Biotech/Foodtech/Agtech. Diese Branchen eint ein hohes Risiko, langer Entwicklungszyklus und hoher Kapitalbedarf – und sie erzeugen nachweislich mehr Arbeitsplätze als klassische Tech-Firmen. In den USA etwa entstehen 0,24 Jobs pro Million Dollar Unternehmenswert, fast doppelt so viele wie in regulären Tech-Sektoren.
Laut dem Report ist der Anteil europäischer Deep-Tech-Unicorns seit 2021 von vier auf acht Prozent gestiegen. Firmen wie Mistral AI, Helsing, IQM oder Celestia belegen, dass der Kontinent die Lücke zu den USA schließt. Deep-Tech-Unternehmen erreichen im Schnitt nach fünf Jahren und sieben Monaten die Milliardenbewertung – fast zwei Jahre schneller als klassische Start-ups. Sie besitzen zudem neunmal mehr Patente und erzielen zwölf Prozent höhere Kapitalrenditen (6,4-fach vs. 5,7-fach).
Deutschlands Zwickmühle
Doch Deutschland stehe exemplarisch für die Ambivalenz Europas: Exzellente Forschung treffe auf Kapitalengpässe. Laut Studie fließt zwar fast die Hälfte der europäischen Tech-Investitionen in Deep-Tech-Projekte, doch im internationalen Vergleich bleibt das Wachstum zäh. Während Frühphasenfinanzierungen solide sind, fehlt es an großen Scale-up-Runden und internationaler Sichtbarkeit.
Programme wie der geplante 30-Milliarden-Euro-Zukunftsfonds oder universitäre Spin-outs sollen Abhilfe schaffen. Doch entscheidend sei, so McKinsey, ein „selbsttragendes Ökosystem“, in dem Industrie, Politik, Forschung und Kapitalgeber eng verzahnt agieren. Nur dann könne Europa vermeiden, dass die nächste Technologiewelle erneut hier vorbeizieht.
 Schweden, Frankreich und UK zeigen, wie es geht
Schweden, Frankreich und UK zeigen, wie es geht
McKinsey nennt Schweden, Frankreich und das Vereinigte Königreich als europäische Best Practices.
Schweden lenkt über seine Pensionsfonds doppelt so viel Geld in Risikokapital wie der EU-Durchschnitt. 65 Prozent aller Start-up-Investitionen fließen dort in Deep Tech.Frankreich hat mit „La Mission French Tech“ ein staatlich gefördertes Programm geschaffen, das lokale Ökosysteme stärkt. Das Land erhöhte seine Zahl an Unicorns von sieben (2015) auf 42 (2024).Großbritannien nutzt steuerliche Anreize wie das Enterprise Investment Scheme und rangiert bei Climate-Tech-Finanzierungen europaweit auf Platz eins.
Diese Länder profitieren von gezielten Programmen, vereinfachten Regulierungen und nationalen Investitionsstrategien. Wenn alle 13 untersuchten Staaten ähnliche Rahmenbedingungen schaffen, könnte laut McKinsey ein zusätzliches Billionenwachstum entstehen.
Doch das Zeitfenster sei eng. Schon in früheren Innovationswellen – etwa bei Cloud und SaaS – hat Europa wertvolle Jahre verloren. Das Risiko, dass sich die Geschichte wiederholt, sei real. McKinsey warnt: Wenn das europäische Start-up-Ökosystem jetzt nicht entschlossen handelt, wird der Kontinent die nächste Chance erneut verpassen.
(ID:50624681)