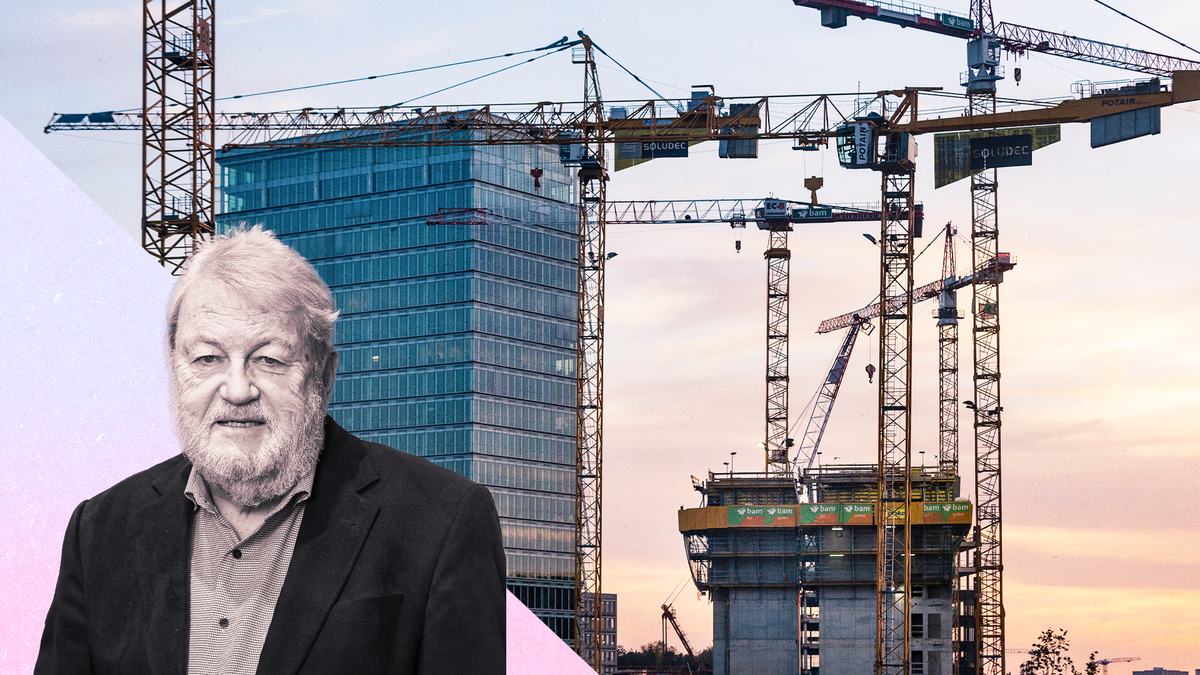Der Autor ist ehemaliger LSAP-Minister und -Europaabgeordneter.
Verfolgt man die politischen Debatten im einzigen Großherzogtum der Welt, hört man eigentlich nur die gleichen Botschaften. Alle Parteien sind für Umwelt- und Klimaschutz, für Armutsbekämpfung, hohe Sozialstandards, gerechtere Löhne und Pensionen, erschwinglichen Zugang zum Eigenheim, eine umfassendere, aber stressfreie Erziehung, mehr Kultur und Sport. Alles mit weniger Steuern. Und weniger Bürokratie.
Sicher, es gibt Nuancen zwischen den Parteien. Friedens CSV will reformieren, ohne klare Ziele, dafür aber im „Dialog“. Die Sozialisten, neue Konservative, wollen alle sozialen Errungenschaften „bewahren“. Die Liberalen setzen ihre Politik im „unteren Drittel der oberen Mitte“ an, also punktgenau in Nirgendwo. Die Grünen wollen mehr Klimaschutz in Luxemburg. Das 0,0005 Prozent der Erdoberfläche umfasst, oder, wenn man nur die 149 Millionen Quadratkilometer der wasserfreien Flächen des Globus in Rechnung stellt, ganze 0,0017 Prozent bedeckt.
Wie viel Einfluss mehr Radfahren in Luxemburg auf das Weltklima hätte, lässt sich abmessen an einer Antwort von Navid Kermani zum Einfluss deutscher Politik: „Was die Klimapolitik betrifft, ist es auch irrsinnig zu meinen, diese Probleme könnten mit nationalen Klimazielen gelöst werden. Selbst wenn sich Deutschland mustergültig verhalten würde, hätte das auf das Weltklima absolut geringfügige Auswirkungen.“ (Tageblatt, 15.01.25).
Lesen Sie auch:Europa lebt besser, aber wie lange noch?
Während Politiker und Leitartikler wetteifern um die großen Prinzipien, wird das Kleingedruckte geflissentlich übersehen. Das sich zunehmend in Balkenschrift auftürmt.
Ade, Schlaraffenland?
Luxemburg mutierte seit dem Überwinden der Stahlkrise in den 1970er Jahren zu dem nominell reichsten Staat der EU. Neben einer recht erfolgreichen Reindustrialisierung erfolgte eine ertragreiche Explosion der Dienstleistungen, vor allem der Banken, Versicherungen und nunmehr Investment-Fonds. Handel und Handwerk, insbesondere die Baubranche, prosperierten.
Der Mangel an einheimischen Arbeitskräften wurde durch Zuwanderung, vornehmlich durch den Zugriff auf das als unerschöpflich geltende Reservoir der Grenzgänger, ausgeglichen. Wobei gerade in den deutschen und lothringischen Grenzgebieten die Bevölkerung rückläufig ist.
Verfolgt man die politischen Debatten im einzigen Großherzogtum der Welt, hört man eigentlich nur die gleichen Botschaften.
Das biedere Luxemburg der Nachkriegszeit entwickelte sich zu einem internationalen Schmelztiegel. Mit Menschen aus über 160 Nationen. Nicht allein, dass sich die Zahl der Landesbewohner in einem halben Jahrhundert nahezu verdoppelte, von 365.000 Menschen im Jahr 1980 auf nunmehr fast 700.000 Einwohner. Die etwas größere Hälfte davon sind zumindest nominell Luxemburger. Aber nur, weil ein erleichterter Zugang zur Naturalisierung jedes Jahr mehrere Tausend „neue“ Luxemburger schuf.
Allein im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts stieg der Anteil der im Ausland geborenen Personen auf 49,2 Prozent. Fast 70 Prozent aller Jugendlichen unterhalb von 20 Jahren haben ein nicht in Luxemburg geborenes Elternteil. Diese Internationalisierung schafft enorme Probleme in den Schulen. Selbst wenn sich Minister Meisch eine Vervielfältigung von internationalen Schulen mit unterschiedlichen Sprachangeboten zugute schreiben kann.
Lesen Sie auch:Energieversorgung zwischen Dunkelflauten und Preissteigerungen
Das Wachsen der Bevölkerung verstärkte den Druck auf alle Infrastrukturen. Mit der Landesbevölkerung, plus 230.000 Grenzgängern, plus mehrere Zehntausend zeitweilig ins Land detachierte Arbeitnehmer, sowie Besucher wie Touristen, tummeln sich über eine Million Menschen auf unseren 2.586 Quadratkilometern.
Dauerstau auf unseren Straßen
Besonders der Wohnungsbau hielt nicht Schritt mit der steigenden Nachfrage. Was zu einer Preisexplosion für Immobilien und im Mietbereich führte. Sowie mehrere Zehntausend Einheimische zur Emigration in die Grenzgebiete zwang.
Die Krise im Bau hat nicht zu einer „Gesund-Schrumpfung“ geführt. Sondern zu vielen Konkursen, gepaart mit der Vernichtung von über 1.900 Arbeitsplätzen allein im Jahr 2023. Dass die Regierung übertriebene Naturschutzregeln für Bauland streichen und gar Gartenhäuschen mit zwölf Quadratmetern Fläche genehmigungsfrei machen will, ist offensichtlich ungenügend.
Der Ausbau des öffentlichen Transportangebotes ist notwendig. Aber die Anpassung des Straßennetzes ebenfalls.
Hauptproblem bleibt, dass kaum neue Bauprojekte in Angriff genommen werden. Was in spätestens zwei Jahren das Angebot noch verringern wird.
Dem Dauerstau auf unseren Straßen will Infrastrukturministerin Yuriko Backes mit strengeren Verkehrsregeln und mit mehr Fahrradwegen begegnen. Als ob die über eine halbe Million Arbeitnehmer, die in ihrer großen Mehrheit durchschnittliche Anfahrtswege von zweimal täglich 40 Kilometern zu bewältigen haben, dies auf einem Drahtesel tun könnten.
Neue Bauprojekte werden einfach nicht in Angriff genommen. Foto: Marc Wilwert
Der Ausbau des öffentlichen Transportangebots ist notwendig. Aber die Anpassung des Straßennetzes ebenfalls. Nicht in dem Schneckentempo wie für die Autobahn nach Thionville.
Ungesunde Beschäftigungsstruktur
Noch schwerwiegender als die infrastrukturellen Mängel sind die sich abzeichnenden soziologischen Umbrüche. Das ständige Wachstum der Beschäftigung übertünchte die Probleme der Finanzierung der sozialen Sicherheit.
Lesen Sie auch:Luxemburg unterschätzt das Problem der Wasserversorgung
Meist junge Grenzgänger und andere Expats ließen durch ihre Sozialbeiträge die Reserven der Kranken- wie Pensionskasse schnell ansteigen. Besonders bei den Pensionen türmten sich die Reserven. Doch aus jungen Arbeitnehmern werden einmal Pensionierte mit Rechten. 2023 wurde erstmalig über die Hälfte der luxemburgischen Renten ins Ausland überwiesen. Tendenz steigend, da nur noch ein Drittel der Arbeitnehmer Luxemburger sind. Die ins Ausland fließende Rentenmasse wird dort konsumiert und fehlt im nationalen Wirtschaftskreislauf.
Die Beschäftigungszahlen des Statec für das Jahr 2024 belegen die Verlangsamung des nationalen Arbeitsmarkts. Nicht nur in der Baubranche, auch in der Industrie und selbst im ICT-Sektor sind die Beschäftigungen rückläufig. Mit Ausnahme von Sektoren mit wenig produktivem Mehrwert wie der Gebäudereinigung stagnieren selbst die Dienstleistungen und vor allem der Handel. Letzterer wurde als größter Arbeitgeber des Landes abgelöst durch … den Staat.
Man darf sich also Sorgen um die Zukunft des Ländchens machen.
„Verwaltung und sonstige öffentliche Dienste“ stellen mit einem Plus von 3.000 Beschäftigten, vornehmlich beim Zentralstaat, nunmehr einige 110.000 Jobs und damit 22 Prozent aller Beschäftigten.
Beamte und selbst Angestellte beim Staat (die laut dem neuen Tarifvertrag zwischen Regierung und CGFP), die nach zehn Jahren Dienst die gleichen Pensionsansprüche erhalten, bekommen ihr Altersgeld direkt aus dem Staatsbudget. Es gibt keine Pensionskasse, wie im Privatsektor, und damit auch keine Reserven.
Man darf sich also Sorgen um die Zukunft des Ländchens machen. Selbst wenn die Politik vor allem in Skandälchen und anderen Nebenkriegs-Schauplätzen schwelgt.