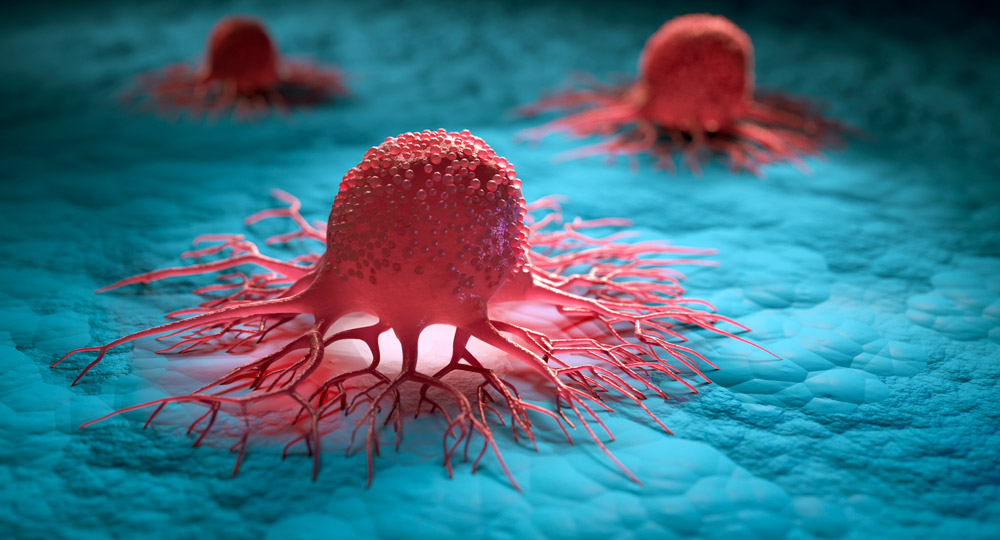Das Team suchte in den Lymphknoten-Geweben mithilfe von speziellen Farbmarkierungen nach sich neu ansiedelnden Krebszellen aus dem Melanom. Anschließend analysierten sie, welche Eigenschaften diese Zellen aufweisen.
Biomarker für metastasierende Krebszellen
Dabei stellten Guetter und seine Kollegen fest, dass bestimmte gestreute Melanomzellen mit einer deutlich verschlechterten Heilungs- und Überlebens-Prognose für die Patienten einhergehen. Selbst wenn die Forschenden nur eine einzige derartige Zelle unter zwei Millionen Lymphknotenzellen fanden, bedeutete das für die Betroffenen eine schlechteren Krankheitsverlauf als ohne diese Klasse an Melanomzellen.
Nähere Untersuchungen zeigten, dass diese Krebszellen das Protein MCSP auf ihrer Oberfläche aufweisen sowie mindestens eines der drei Proteine PMEL, MLANA und DCT produzieren. Die Kombination dieser Biomarker erlaubt eine eindeutige Identifizierung der metastasierenden Melanomzellen.
Krebszellen schalten embryonale Gene an
Genanalysen enthüllten zudem, dass diese Melanomzellen während ihrer Ansiedlung in den Lymphknoten mehrfach ihre Genaktivität und damit Aussehen und Stoffwechsel verändern. Unter anderem wird dabei das embryonale Genprogramm angeschaltet, das sonst nur in Melanozyten aktiv ist. Damit gehen diese gestreuten Krebszellen in einen den Stammzellen ähnlichen Zustand über.
Die metastasierenden Krebszellen entwickeln sich durch diese Reprogrammierung zu einem Zelltyp, der dem von unreifen Vorläufern der Haut-Pigmentzellen ähnelt. Da die gestreuten Melanomzellen sich aber nicht in der Haut, sondern im Lymphknoten befinden, schlägt die „Organbildung“ fehl und es entstehen stattdessen Metastasen.
Im Gegensatz zu klassischen Krebsstammzellen reagierten die metastasierenden Krebszellen in den Tests aber dynamisch auf ihre Mikroumgebung, betont das Team. Demnach handelt es sich nicht um statische Krebsstammzellen, sondern um eine andere, flexiblere Art von Metastasen-Gründerzellen.
Kampf mit dem Immunsystem als Auslöser
Doch was löst diese „Verjüngung“ der gestreuten Krebszellen aus? Wie Guetter und seine Kollegen in weiteren Analysen herausfanden, ist die menschliche Immunabwehr daran beteiligt: Auslöser für diese Entwicklung ist offenbar ein vorangegangener Kampf der Melanomzellen mit den T-Zellen des Immunsystems. Diese „Killerzellen“ erkennen krebstypische Merkmale auf entarteten Zellen und greifen diese an. Doch die Krebszellen, die den Angriff der T-Zellen überleben, schalten als Folge das Melanozyten-Genprogramm an, wie die Tests ergaben.
Teil dieses verjüngenden Genomprogramms der Krebszellen ist neben der MCSP-Produktion auch die Herstellung und Freisetzung von Proteinen (CD155 und CD276), die das Immunsystem unterdrücken. Dadurch haben die gestreuten Krebszellen es dann in den Lymphknoten leichter, sich anzusiedeln und Metastasen zu bilden, wie das Team erklärt. Je größer diese Metastasen-Gründerkolonien dann werden, desto mehr Proteine setzen sie frei und desto stärker hemmt dies die T-Zellen. Die Metastasen können dann ungebremst wachsen und die enthaltenen Krebszellen erneut ihre Genaktivität verändern.
Neue Ansatzpunkte für Hautkrebs-Therapie
Damit haben die Forschenden erstmals aufgeklärt, wie die allerersten Schritte der Metastasenbildung in Lymphknoten beim Melanom ablaufen. Sie gehen davon aus, das ein ähnlicher Prozess bei Metastasen auch in anderen Körperteilen abläuft. Das Wissen könnte künftig helfen, Patienten mit Hautkrebs so zu behandeln, dass eine Metastasen-Bildung im Keim erstickt wird.
Ansatzpunkt könnte dabei das MCSP-Protein sein, das offenbar alle gefährlichen Metastasen-Gründerzellen tragen, aber in gesunden Körperzellen kaum vorkommt. Alternativ könnte die frühe Immunantwort durch T-Zellen unterstützt werden, indem die Proteine CD155 und CD276 bekämpft werden, um den Melanomzellen die Ansiedlung zu erschweren. (Nature Cancer, 2025; doi: 10.1038/s43018-025-00963-w)
Quelle: Universität Regensburg
21. Mai 2025
– Claudia Krapp