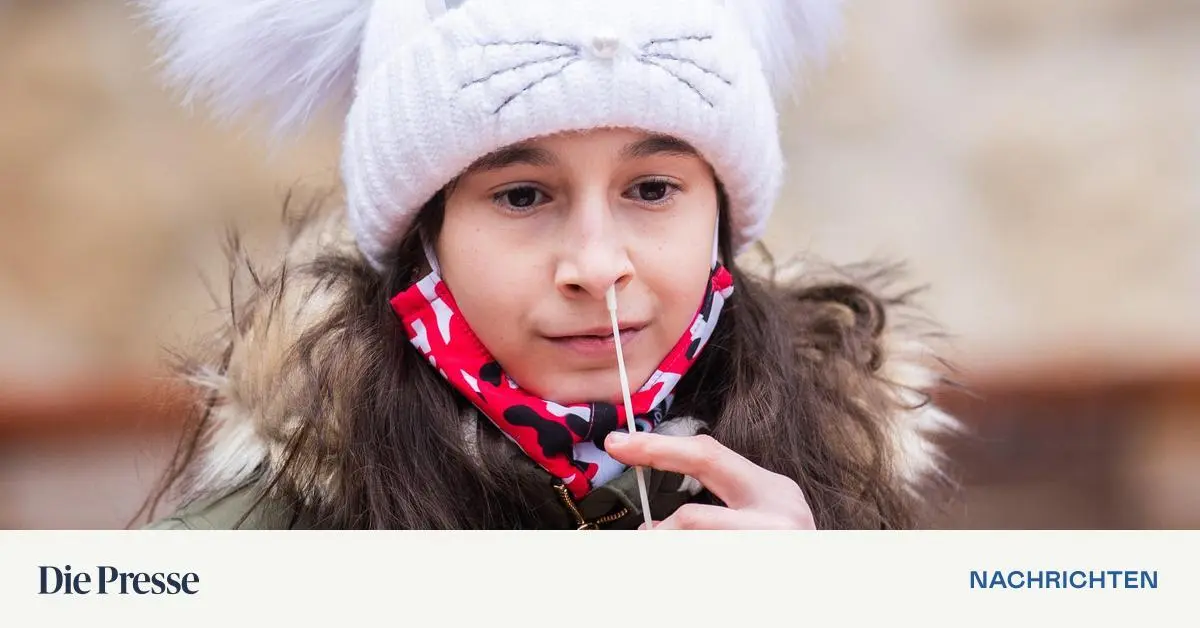Diese Geräte sollen mit unserem Körper kommunizieren, erklärt Serpil Tekoglu von der Uni Linz. Material aus Nanozellulosen ist gut verträglich und kann verschiedene Biomarker nachweisen. Am Ende verrottet Zellulose am Kompost. Die Erfindung wurde international gewürdigt.
Woran wir forschen, nennt man Bioelectronics, also die Kombination von Biologie und Elektronik“, sagt Serpil Tekoglu vom Institut für Physikalische Chemie (IPC) der JKU Linz. Sie schmunzelt bei der Erklärung und weist darauf hin, wie schlecht Bio und Elektrik zusammenpassen: „Wenn Ihr Handy ins Wasser fällt, ist es wohl kaputt. Elektronik kommt meistens nicht gern mit Wasser in Berührung.“ Die Biologie hingegen basiert auf Wasser und Flüssigkeiten. Das Team der Uni Linz sucht kreative Lösungen, wie man elektrische Geräte in flüssiger Umgebung zuverlässig gestaltet.
»Von der Genauigkeit her sind die von uns geplanten Tests gleichauf mit einem PCR-Ergebnis. Aber die Auswertung geht schneller.«
Serpil Tekoglu,
Institut für Physikalische Chemie der Uni Linz

Serpil Tekoglu vom Institut für Physikalische Chemie (IPC) der JKU Linz. Erkan Kadir
Eines der Ziele sind Sensoren für Körperflüssigkeiten wie Blut oder Speichel, die anzeigen, ob bestimmte Biomarker darin vorhanden sind oder nicht. Das können Viren wie Covid-Erreger, Bakterien wie bei einer Streptokokken-Infektion oder jegliche Antikörper sein, die im Körper Hinweise auf Allergien oder Krankheiten geben.
Wunderstoff aus der Natur
Dabei nutzen die Forschenden ein Material namens Nanozellulose, das als neuer Wunderstoff gilt, weil es zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichem Material hat. Erstens ist der Grundstoff Zellulose das häufigste in der Natur vorkommende Polymer, also ein langes Molekül, das aus vielen Einzelbausteinen zusammengesetzt ist. „Wir bekommen diesen Stoff in Form von Kristallen, den unsere Partner um Alessandra Operamolla an der Universität Pisa aus Pflanzenmaterial herstellen. Die Partikel sind kleiner als 500 Nanometer“, sagt Tekoglu, die seit 2019 in Linz lebt und davor in Izmir (Türkei), Mailand (Italien) und Karlsruhe (Deutschland) geforscht hat.
Polymere kennen viele als Kunststoffe wie Polyethylen-Folien, PET-Flaschen oder das am häufigsten eingesetzte Polypropylen, das man simpel als „Plastik“ bezeichnet. Doch Polymere sind auch als Naturstoffe sehr vielfältig: Die Zellwand von Pflanzen besteht wie gesagt aus Zellulose, und unser Erbmaterial, die DNA, ist ebenfalls ein Polymer, das aus kleinen Einzelstücken wie eine Perlenkette aufgebaut ist. „Neben dem Aspekt, dass Zellulose ein häufiger in der Natur vorkommender Stoff ist, haben wir den zweiten Vorteil, dass sie auch natürlich abbaubar ist“, sagt Tekoglu. Bisher sind Schnelltests, die Erkrankungen oder Biomarker anzeigen, hauptsächlich aus synthetischen Kunststoffen, die nicht in den Biomüll gehören. Doch die neuen medizinischen Tests sollen (wenn von der Hygiene her möglich) kompostierbar sein.
Anpassbar wie Lego-Bausteine
„Und als dritter Vorteil ist unsere Entwicklung in der Funktion flexibel: Je nach Wunsch kann man genau die Moleküle suchen, die wichtig sind“, erklärt Tekoglu. Diese anpassbare Funktionalität ergibt sich aus der Bauweise der Biosensoren. An einer Stelle des Sensormoleküls kann man wie bei einem Lego-Set das dran stecken, was man braucht: für Covid-Detektion eine Struktur des Virus-Antikörper, für Bakterien ein Stück der Zelloberfläche zum Andocken oder für Krebsmarker die exakte Passform der gesuchten Tumorstrukturen.
„Das funktioniert über leitende Polymere, die wie ein Schalter on und off anzeigen“, sagt Tekoglu. Wenn ein bestimmter Biomarker an den Sensor bindet, verändert er dadurch die lokale Umgebung der Ionen, was zu messbaren Änderungen des elektrischen Stroms führt.
Weniger aufwendig als PCR-Tests
Die Auswertung von solchen Schnelltests wäre mit eigenen Messgeräten nicht ganz so einfach wie die Nasenabstriche aus der Corona-Zeit, aber viel weniger aufwendig als die PCR-Tests, die uns alle in Erinnerung sind. „Von der Genauigkeit her sind die von uns geplanten Tests gleichauf mit einem PCR-Ergebnis. Aber die Auswertung geht sehr schnell in wenigen Minuten mit kleinen Messgeräten, die in einer Ordination oder einem Gesundheitszentrum stehen könnten“, sagt Tekoglu.
„Wir haben elektrische Leitfähigkeit mit ionischer Leitfähigkeit (biologischer Stromfluss, Anm.) in einem Material kombiniert. Das ist wirklich neu“, beschreibt die Forscherin die Erfindung, die es auch auf das Cover des Journal of Materials Chemistry geschafft hat. Tekoglu wurde heuer zudem von der britischen Royal Society of Chemistry als eine der „Frauen in der Materialwissenschaft 2025“ nominiert und hat am internationalen Frauentag, dem 8. März, die Ehrung erhalten.
Lesen Sie mehr zu diesen Themen: