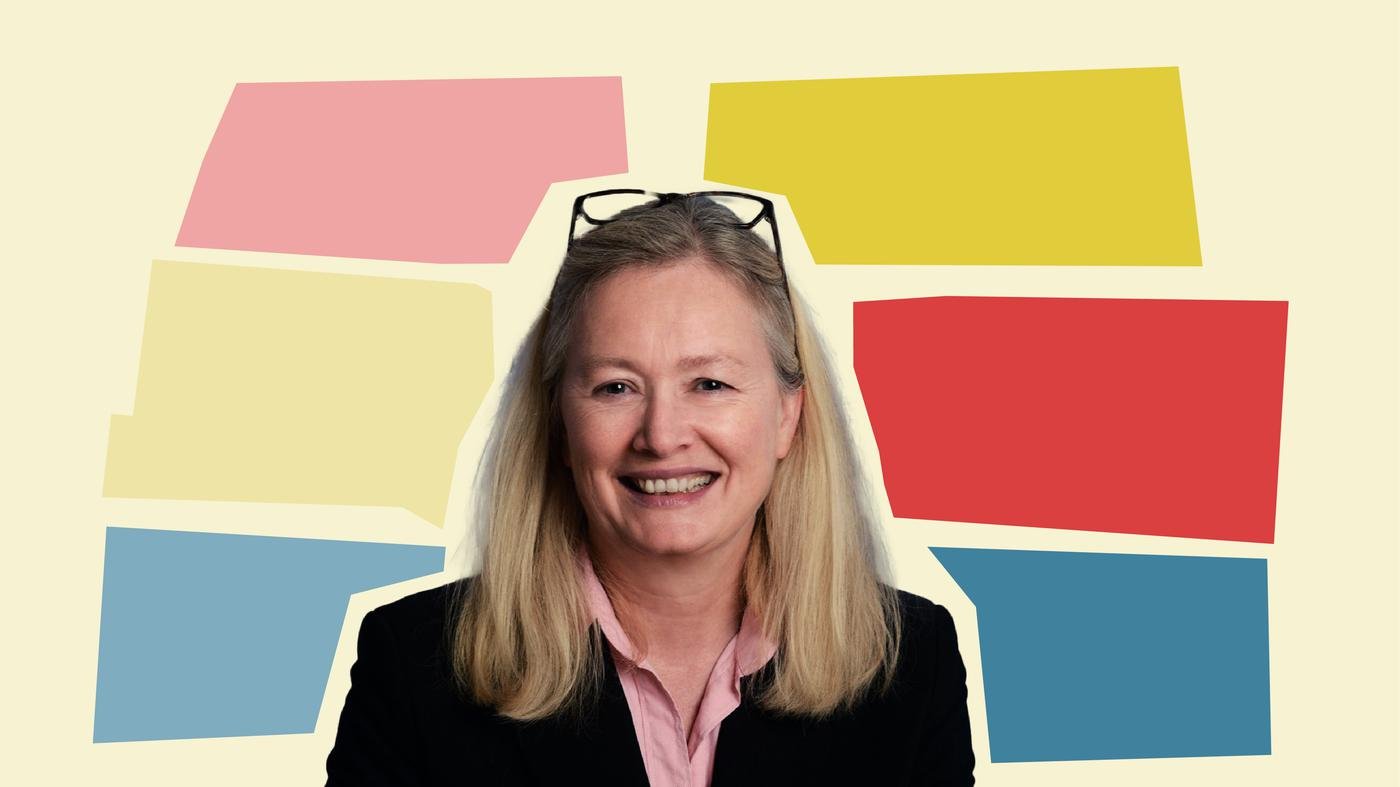Bis 2030 sind es nur noch 5 Jahre. Berlin bis dahin sozial und ökologisch krisenfest zu machen – das schaffen wir nur gemeinsam und auf Augenhöhe. „Veränderungsresistenz ist teurer als der Wandel.“ Die Erfahrung, dass neue Bauprojekte häufig mit teureren Mieten, mehr Autoverkehr, weniger Grün, überfüllten Klassen und mit sozialen Gräben einhergehen, also oft eine De-facto-Verschlechterung der Lebensbedingungen für ein Quartier bedeuten, hat sich tief in das Gedächtnis der Stadt eingeschrieben. Dem entgegen braucht es wieder positive Veränderungserfahrungen. Projekte, die Nachbarschaften abwechslungsreicher, schöner und bezahlbar machen. Mit sieben Punkten lässt sich priorisieren, was für Berlin zu tun ist:
Klimaresilienz
Berlin muss sich besser gegen Extremwetterereignisse wie Hitze und Starkregen schützen. Begrünung und Bodenentsiegelung sind zwei zentrale Bausteine dafür. Viele unterstützende Maßnahmen bewegen sich auf einer kleinmaßstäblichen Ebene: Pflanzung und Pflege von Bäumen, intensive Gründächer, Mulden und Rigolen, Verwendung von durchlässigen Straßenbelägen, wo möglich, und Neuordnung des Straßenprofils.

Theresa Keilhacker ist freischaffende Architektin und seit 2021 Präsidentin der Architektenkammer Berlin. Außerdem ist sie im „Bündnis Klimastadt Berlin 2030“ aktiv.
Wie Entsiegelung und Biodiversität proaktiv und zügig umgesetzt werden kann und auch zu Räumen führt, die man in ihrer Schönheit in Berlin kaum dort erwarten würde, beweisen der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg im Graefekiez oder der Kulturhof in der Koloniestr. 10 im Bezirk Mitte.
Mobilitätswende
An der Mobilitätswende erhitzen sich in Berlin die Gemüter – zu Unrecht. Denn eigentlich besteht weitestgehende Einigkeit darüber, dass mit dem Wachstum der Stadt ein Verkehrskollaps entsteht, wenn nicht klug gegengesteuert wird. Da der historisch gewachsene Stadtgrundriss keine nennenswerte Erhöhung der Kapazität für Autos ermöglicht, liegt es im allgemeinen Interesse, die Menge der Autos auf den Straßen langfristig nicht nur stabil zu halten, sondern zu reduzieren. Nicht zuletzt für diejenigen, die auf Fahrten mit dem Auto dringend angewiesen sind.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Externen Inhalt anzeigen
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
Das Fahrrad ist eine tolle Alternative (nicht die einzige), weil es sehr preiswert ist und gesund sein kann. Wären da nicht die täglichen Gefahren, einen Unfall damit zu erleiden! Die Erfahrungen, wie etwa in der Weserstraße in Neukölln, zeigen: Werden Straßen zu Fahrradstraßen umgestaltet, freut das nicht nur Radfahrende und Anwohnende, sondern auch Geschäftstreibende.
Bauwende
Gerade hat der Bundestag das Ziel „Klimaneutralität bis 2045“ in das Grundgesetz geschrieben. Neben dem Verkehrssektor ist der Gebäudesektor der Bereich, in dem die Klimaziele regelmäßig verfehlt werden. Wenn, wie in der Mollstraße in Mitte, ein Gebäude mit 200 Wohnungen abgerissen wird, um an derselben Stelle ein Bürogebäude zu bauen, ist das kontraproduktiv. Stattdessen sollten bestehende Gebäudestrukturen und Materialien kreislaufgerecht weitergebaut werden – es gilt „Bestandsertüchtigung vor Neubau“.
Dafür sind die Hürden in der Bauordnung für den Bestand zu senken und „Graue Energie“ mit einem Preisschild zu versehen. Zumal dies keine Abstriche am architektonischen Anspruch erfordert, wie die beiden Verwandlungen eines Plattenbaus in die heutige Bezirkszentralbibliothek in Friedrichshain oder die Umnutzung der ehemaligen Blumengroßmarkthalle in ein Kindermuseum in Kreuzberg zeigen. Ganz aktuell entstehen an der Müllerstraße in Mitte Wohnungen über einer ehemaligen Tankstelle.
Kooperative Stadt
Bauen auf der „grünen Wiese“ ist nach dem Baugesetzbuch in Deutschland nicht einfach möglich, und das ist gut so. Zuzug, auch von Geflüchteten, ist als integrative Daueraufgabe von Stadtentwicklung zu betrachten, nicht als Hauruckaktion mittels Sonderparagrafen. In dichten Gebieten treffen stets eine Vielzahl an Interessen aufeinander und werden durch das Städtebaurecht sinnvoll geordnet. Daher gilt: Der schnellste Weg ist, Komplexität anzuerkennen. Wenn frühzeitig Interessen in einem verbindlichen Beteiligungs- und Planungsprozess ausgeglichen werden, erhöht dies die Akzeptanz und Qualität der Planung.
Mit dem Verfahren „Alte Mitte – neue Liebe?“ wurde 2015 bis 2017 ein Dialog mit der Stadtgesellschaft durchgeführt, dessen Ergebnis durch einen einstimmigen Beschluss im Abgeordnetenhaus übernommen wurde. Jetzt bekommt Berlin eine „grüne Oase“ zwischen Fernsehturm und Humboldt-Forum und darf am Kulturquartier Molkenmarkt ökologisch und bezahlbar bauen. Berlin kann nicht nur streiten, sondern auch Konsens.
Serie „Berlin 2030“
In unserer neuen Serie „Berlin 2030“ wollen wir konstruktive Lösungen für die Herausforderungen der Hauptstadt finden und dabei helfen, positiv in die Zukunft zu schauen. Dafür sprechen wir mit Vordenkerinnen und Visionären, mit Wirtschaftsvertretern, mit Kulturschaffenden, mit Stadtplanern, mit Wissenschaftlerinnen und Politikern.
In Gastbeiträgen fragen wir sie nach ihrer Vision für Berlin. Wie soll Berlin im Jahr 2030 aussehen? Welche Ideen haben sie für die Zukunft unserer Stadt? Und welche Weichen müssen dafür jetzt gestellt werden?
Die Beiträge der Serie stammen unter anderem von Kai Wegner, Renate Künast, Sigrid Nikutta, Ulrike Demmer, Tim Raue, Mo Asumang und Christian Schertz. Alle bisher erschienenen Beiträge finden Sie hier.
Am 28. April ab 19.30 Uhr stellen wir die Vorschläge aus der Serie in einer Veranstaltung mit Podiumsdiskussion im Deutschen Theater vor. Tickets gibt es unter veranstaltungen.tagesspiegel.de.
Sie haben auch eine Idee? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an: checkpoint@tagesspiegel.de.
Gemeinwohl und bezahlbarer Wohnraum
An der Wohnraumfrage entscheidet sich die Zukunft dieser Stadt. Eine Erhöhung der Stückzahlen ist wichtig, aber sie sagt nichts über die Bezahlbarkeit und Qualität aus. In Berlin steigt der Wohnungsbestand zwar stetig, aber die Zahl der Sozialwohnungen sinkt. Deshalb muss die öffentliche Hand gemeinwohlorientierte Liegenschaftspolitik betreiben, auch durch Unterstützung von Genossenschaften und Kooperativen.
Insbesondere die „kleinteilige Innenentwicklung“, die im StEP-Wohnen 2040 als zweitgrößtes Potenzial für Wohnungsbau ausgewiesen wird, kann durch gezielte Maßnahmen gefördert werden. Dazu gehören zinsgünstige Kredite, Bürgschaftsprogramme, mögliche Beleihung von Erbpachtgrundstücken, steuerliche Erleichterungen wie zum Beispiel eine Sonder-AfA für Bestandsertüchtigung und die Umsetzung der Bundesförderung für Programme wie „Jung kauft Alt“ oder „Gewerbeimmobilien zu Wohnraum“. Ergänzend kann mithilfe von KI Leerstands- und Nachverdichtungspotenzial effektiv erfasst oder mit der Vermittlung von Co-Living-Konzepten mittels einer Agentur die Wohnraumschaffung weiter ausgebaut werden.
Kulturelle Freiräume
Die kulturelle Vielfalt Berlins ist ihr Innovations- und Wirtschaftsmotor. Sie ist für die Seele der Stadt und die Attraktivität bei Touristen entscheidend. Sie benötigt aber dringend bezahlbare und niedrigschwellige Zugänge zu Räumen und Produktionsstätten.
Gleichzeitig können kulturelle Zwischennutzungen selbst Ausgangspunkt für städtebauliche Entwicklungen sein, wie etwa beim genossenschaftlichen Projekt Holzmarkt, das aus dem Club Bar 25 hervorgegangen ist, oder beim kooperativ entwickelten Haus der Statistik am Alexanderplatz. Wir brauchen hier wieder mehr informelle Experimente in allen Stadtteilen!
Metropolregion Berlin-Brandenburg
Das Wachstum Berlins überschreitet die Berliner Stadtgrenze. Dies erfordert eine Erweiterung des Planungs- und Wissenshorizonts. Denn nicht nur der ÖPNV muss entsprechend angepasst, auch in vielen anderen Bereichen müssen Synergien geschaffen werden. So ist etwa Brandenburg bereits jetzt ein wichtiger Partner, wenn es um Wohnungsbau mit Holz oder nachhaltige Lebensmittel- und Energieversorgung geht.
Mehr Visionen für Berlin 2030 Julian Breinersdorfers Vision für Berlin 2030 „Wohnraum für viele Hunderttausende“ Stiftungschefin Beate Stoffers „Internationale Großveranstaltungen nicht mit provinzieller Radikalität ablehnen“ Kai Wegners Vision für 2030 „Berlin wird schneller und einfacher werden“
Eine IBA 2030 für Berlin und den Metropolenraum sollte diese Potenziale heben und das zirkuläre Planen und Bauen in den Mittelpunkt strategischer Entwicklung stellen – Wissenschaft trifft Praxis. Durch den nachhaltigen Umgang mit dem länderverbindenden Thema Wasser könnte ein gemeinsames Arkadien der Zukunft entstehen.