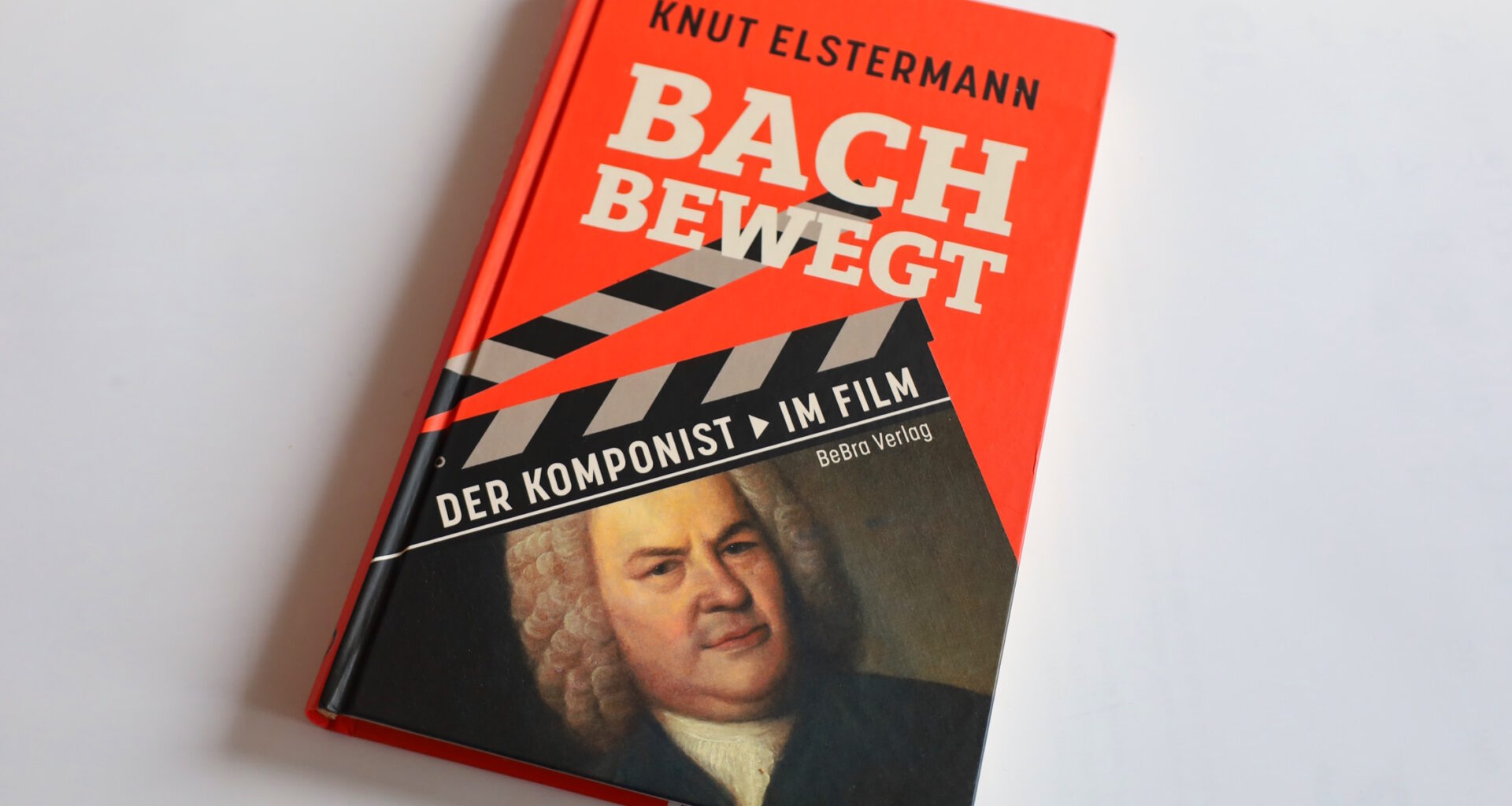Das Bachfest steht wieder vor der Tür und wird wieder tausende Bachverehrer nach Leipzig locken. Manche allein wegen der Musik, manche auch, weil sie ein wenig von der Aura des berühmten Komponisten spüren möchten. Denn seit er im späten 18. Jahrhundert ein bisschen „aus der Mode“ gekommen war, ist er heute längst einer der meistgespielten und meistbewunderten Komponisten weltweit geworden. Und in einer ganzen Reihe von Filmen auch der Star. Denn etliche Regisseure wollen das Genie unbedingt auch im Bilde einfangen. Fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Auch wenn der Journalist, Moderator und Bachverehrer Knut Elstermann mittlerweile einen ganzen Berg von Filmen sichten kann, in denen Johann Sebastian Bach meist die Hauptrolle, manchmal auch die Nebenrolle spielt. Er gibt gern zu, dass er nicht vom Fach ist und bei der musikalischen Interpretation Bach’scher Werke manchmal überfordert ist.
Aber da geht es ihm wohl wie den meisten Menschen, die sich von Bachs Musik bezaubern lassen. Man fühlt ihre Wucht und Schönheit, ohne sagen zu können, wie es der Leipziger Thomaskantor gemacht hat. Was natürlich wieder das Bedürfnis verstärkt, den Mann selbst irgendwie kennenzulernen. Was praktisch unmöglich ist.
Denn es gibt so gut wie keine persönlichen Aufzeichnungen von Johann Sebastian Bach. Hätte er sich nicht eifrig mit Ratsherren und Magistraten gestritten, wüssten wir noch viel weniger über ihn und sein Temperament.
Es gibt keine Tagebücher und auch keinen mitreißenden Briefwechsel mit Freunden, Geliebten, Kollegen. Eher scheint er in den Erinnerungen seiner Söhne und von musizierenden Zeitgenossen auf, die ihn in Leipzig noch erlebt haben.
Welcher Bach eigentlich?
Aber schon da wird es schwierig. Denn auch darüber, wie er sich in der Stadtgesellschaft bewegte oder wie seine meist im Husarenritt für die nächste Motette geschriebenen Musikstücke in den Leipziger Kirchen vom Publikum aufgenommen wurden, gibt es praktisch keine Aufzeichnungen. Keine Erinnerungen. Nichts.
Sodass alle seine Biografen darauf angewiesen sind, seinen Charakter und sein Auftreten irgendwie aus den überlieferten biografischen Daten und vor allem aus seiner Musik herauszulesen. Was schon ein furioses Bild ergibt, wie etwa John Eliot Gardiner in seinem Buch „Bach. Musik für die Himmelsburg“ zeigen konnte. Oder Michael Maul in „J.S.Bach. Wie wundersam sind deine Werke“.
Wenn man seine Musik hört, meint man, sich diesen Mann unbedingt auch vorstellen zu können. Aber Knut Elstermann hat es nicht beim Anschauen der Filme gelassen. Er hat auch die Fachleute besucht. In Leipzig zum Beispiel Michael Maul. Aber er war auch in Arnstadt und Eisenach, den frühen Wirkungsstätten von Johann Sebastian Bach, sprach mit Musikern und Künstlern – etwa Bernd Göbel, dem Schöpfer des burschikosen, aber gerade deshalb so bezaubernden Bachdenkmals in Arnstadt.
Jenem Bach, den man oft vergisst, wenn man immer nur den gestandenen Leipziger Thomaskantor vor Augen hat und nicht den jungen Sprössling aus der berühmtesten Thüringer Musikerfamilie, der sich auch gern mit der Obrigkeit anlegte, wenn er seinen künstlerischen Stolz verletzt sah.
Irgendwie steckte gerade in diesem jungen Bach schon jener Künstlerstolz, der mit dem Geniekult im späten 18. Jahrhundert seinen Ausdruck finden sollte. Aber daran war im frühen 18. Jahrhundert noch nicht zu denken. Kein einziger der honorigen Leipziger Stadtväter wäre wohl auf die Idee gekommen, in diesem aufmüpfigen Thomaskantor ein Genie zu sehen.
Im Gegenteil: Ihnen war das, was er in den Kirchen inszenierte, viel zu viel, zu opernhaft. Auch wenn das einige musikbegeisterte Leipziger damals durchaus anders sahen. Aber die Zeit war noch nicht reif.
Welches ist der Richtige?
Und so sind auch viele der Verfilmungen eine Suche nach dem „richtigen“ Bach, so wie er möglicherweise wirklich war. Aber das Problem beginnt ja – wie Elstermann feststellt – schon beim Konterfei. Hunderte von Bildern geistern durch die Welt, von denen behauptet wurde, sie zeigten Bach, auch wenn die meisten schlicht nichts mit dem berühmten Musiker zu tun haben. Am nächsten kommt ihm – das gibt auch Elstermann zu – das Leipziger Haußmann-Porträt, auch wenn daran wohl nur der Kopf den Thomaskantor zeigt.
Der Rest scheint irgendwie von etwas dilettantischen Schülern angestückelt. Und solche Hände – da ist sich Elstermann sicher – hatte der virtuos auf Orgel und Cembalo spielende Bach ganz gewiss nicht.
Aber ihm geht es ja vor allem um die Filme – die gelungenen und die misslungenen. Und dass gerade die älteren Verfilmungen, die Bach als steifen, barocken Perückenträger zeigen, bei ihm nicht gut wegkommen, ist nur zu verständlich. Dass dieser „deutsche“ Bach, den die Regisseure irgendwie in das nationalistische Verständnis von deutschen Kunstheroen pressten, mit dem lebendigen Bach nichts zu tun hat, sieht man, wenn man Ohren hat zu hören.
Das ganze späte 20. Jahrhundert ist ja ein einziges Arbeiten daran, Bach aus dieser holzschnittartigen deutschen Glorifizierung wieder herauszuholen und ihn als den lebendigen, von den eigenen Ansprüchen getriebenen Musiker zu zeigen, der er war. So zeigen ihn die überlieferten Partituren.
Und wenn man sich dann noch das turbulente Leben mit der Familie in der Thomasschule vorstellt, wird endgültig rätselhaft, wie er unter so turbulenten Bedingungen ein solches Werk schaffen konnte. Aber schon mit der DDR-Verfilmung „Johann Sebastian Bach“ mit Ulrich Thein in der Hauptrolle wurde sichtbar, was in diesem Musiker tatsächlich steckt. Es ist kein Zufall, dass Thein selbst höchst musikalisch war.
So wie so manch anderer späterer Bach-Darsteller. Denn eins wird – je weiter sich Elstermann durch die Bach-Verfilmungen arbeitet – immer deutlicher: Man kommt dem Mann nur über seine Musik näher. Sie zeigt nicht nur das Genie, sie zeigt auch seine in Noten gegossene Gefühlswelt. Er schrieb zwar keine mitreißenden Liebesbriefe (jedenfalls sind keine überliefert), aber wie man liebt, hofft, trauert und wieder aufsteht, das hat er in seine Musik geschrieben. Sein ganzes Leben im Grunde.
Der große Unbekannte
Das ist Musik, die nicht nur moderne Verfilmungen wie „Mein Name ist Bach“ tragen, sondern auch all jene Filme, in denen Bachs Musik – von einfühlsamen Regisseuren richtig eingesetzt – zum Filmmotiv wird. Und auch davon gibt es dutzende große Filme, die Elstermann näher beleuchtet.
Und das alles in einem leichten, sehr feuilletonistischen Ton, der spürbar macht, wie alle seine Begegnungen mit Schauspielerinnen, Regisseuren, Bach-Darstellern, Kostümbildnerinnen, Notenretterinnen und Kantoren eine journalistische Suche nach dem Phantom Bach sind.
Das ein Phantom bleiben muss. Denn natürlich hat jeder einen anderen Bach vor Augen, hört andere Stücke im inneren Ohr, wenn der Name fällt, fühlt sich dem Komponisten in völlig verschiedenen Situationen nah.
Sodass es auch kein Wunder ist, dass es die Regisseure aufgegeben haben, nach Bach-Darstellern zu suchen, die dem Haußmann-Bild oder der Bach-Rekonstruktion von Wilhelm His möglichst nahekommen. Immerhin zeigt auch das Haußmann-Gemälde den späten Bach, den Mann, der seine Kämpfe mit einer sturen Obrigkeit ausfocht, aber die meisten seiner Werke alle schon geschrieben hatte.
Selbstbewusst, sich seines Könnens sicher. Aber auch da ist nur ein Puzzle-Teil dieser musikalischen Biografie, wie Elstermann am Ende seiner Reise durch die bachschen Filmwelten feststellt: „Die Bach-Darsteller in Film und Fernsehen sind Vermittler und Erfinder, sie spielen den großen Unbekannten nach einer fragmentarischen und frei ergänzten Partitur. Niemand von ihnen kann die absolute Wahrhaftigkeit seiner Interpretation beanspruchen, aber alle tragen zum Bild bei, das wir uns von Bach machen.“
Variationen auf einen Bach
Und so sorgen auch die Filme dafür, dass wir uns innerlich ein Bild von diesem Mann machen. Ohne zu wissen, wie er wirklich zu seiner Zeit auftrat und durch die Stadt lief. Eilig, weil er die Partitur mal wieder auf den letzten Drücker fertiggebracht hat? Getrieben von seiner inneren Musik, die unbedingt in Noten gefasst werden musste?
Oder behäbig wie ein gut situierter Leipziger Bürger, für den Eile unter seiner Würde war? Wir wissen es einfach nicht. Und so werden auch alle künftigen Verfilmungen immer nur eine mögliche Annäherung sein an einen Bach, wie wir ihn uns vorstellen können.
Es wird Regisseuren oft so gehe wie Knut Elstermann: Sie werden innerlich schwärmen von diesem Bach. Aber jeder neue Film wird – ganz im Sinne Bachs – wieder nur eine Variation über ein unendlich großes Thema sein. Nicht nur in den Goldberg-Variationen hat Bach ja gezeigt, wie das geht. Und sich vielleicht innerlich gedacht: Daran werden sie sich noch in 300 Jahren die Zähne ausbeißen.
Oder eben ihre pure Freude haben am Verfilmen wie in „Bach – Ein Weihnachtswunder“ mit Devid Striesow von 2024, die natürlich auch mit ins Buch gefunden hat. Denn natürlich erzählt auch sie davon, wie diese Musik auch uns Heutige noch mit sich reißt.
Und wie darin möglicherweise selbst das turbulente Familienleben der Bachs eingefangen ist. In furiosem Tempo in Noten gesetzt. Vielleicht ging es bei Bachs tatsächlich genau so zu. Aber ob es genau so war, ist auch egal. Denn seine Musik erzählt jedem auf seine Weise: Genau so war es. Und wird es für jeden, der Ohren hat, immer wieder sein.
Knut Elstermann Bach bewegt BeBra Verlag, Berlin 2025, 20 Euro.