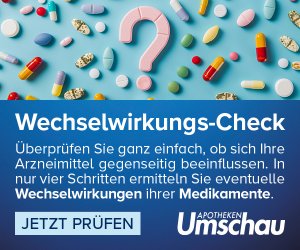Es fühle sich an, als wäre die Tür eines heißen Backofens offen und man selbst stünde die ganze Zeit davor. So beschrieb ein Einwohner von Lytton, eine Gemeinde im Westen Kanadas, wie er die Hitzewelle im Juni 2021 erlebte. Das Thermometer in Lytton stieg damals auf 49,6 Grad Celsius – die bislang höchste in Kanada gemessene Temperatur. Und es blieb über mehrere Tage heiß, sehr heiß.
Hitzewellen sind in Deutschland angekommen
Lytton ist Tausende Kilometer entfernt von unserem gemäßigten Klima in Deutschland. Geografisch liegt es aber ungefähr auf demselben Breitengrad wie Mainz. Das ist einer der Gründe, warum die mehrtägige Gluthitze von 2021 in Teilen Nordamerikas auch in Deutschland ein Thema ist.
Lytton lag unter einem Hitzedom, ein Hochdruckphänomen, bei dem sehr warme Luft über Tage hinweg über einer Region festhängt und sie umschließt. Solche Wetterlagen sind auch in Deutschland möglich.
Doch wie gehen wir damit um, wenn Sommer nicht mehr in erster Linie „endlich schönes Wetter“ bedeutet, sondern immer öfter „schon wieder unerträglich heiß“? Welche Personengruppen gilt es vor den krankmachenden Folgen hoher Temperaturen zu schützen – und wie?
Der Klimawandel hat in Deutschland bereits zu einem deutlichen Temperaturanstieg geführt. Das belegt ein Sachstandsbericht mehrerer Forschungseinrichtungen von 2023. Die vergangenen Jahre brachen dreimal in Folge den Rekord als „wärmstes Jahr seit dem Beginn regelmäßiger Messungen“: 2024, 2023 und 2022, gleichauf mit 2018.
Die klimatische Veränderung treibt nicht nur die mittleren Temperaturen nach oben. Sie bringt mehr Extreme: mehr Tage mit Backofentemperaturen, mehr tropische Nächte, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt, mehr Hitzewellen, die tagelang anhalten. Laut Analysen müssen wir uns darauf gefasst machen, dass Deutschland davon insgesamt stärker betroffen sein wird als der Durchschnitt der Länder.
Höchstwerte ab 30 Grad gelten als Gesundheitsrisiko

Prof. Dr. Beate Müller, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin an der Uniklinik Köln.
© Michael Wodack/MFK
Negative Folgen erleben sehr viele Menschen schon jetzt. Fachleute nehmen an, dass die gesundheitliche Gefahr ab einer Wochenmitteltemperatur von 20 Grad deutlich steigt. Tageshöchstwerte ab 30 Grad gelten als besonders risikoreich. Tropennächte verschärfen die Situation zusätzlich: Der Schlaf ist schlechter und der Organismus kann sich oft nicht ausreichend erholen. Man startet belastet in den nächsten Morgen.
Jede nennenswerte Hitze führt dazu, dass Menschen sterben, weil ihr Körper die Strapazen nicht verkraftet. Für die zurückliegenden beiden Jahre beziffert das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin die Zahl der so verursachten Todesfälle in Deutschland auf jeweils rund 3000.
Außerdem sind da all die Menschen, denen bestehende Krankheiten stärker zu schaffen machen, wenn es heiß ist. „Atemwegserkrankungen, Diabetes, Nierenleiden und psychische Störungen bereiten mehr Probleme“, benennt Prof. Dr. Beate Müller, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin an der Uniklinik Köln einige Beispiele. Auch Schlaganfälle sind in Hitzeperioden häufiger, und es gibt mehr Fehlgeburten. Nicht zuletzt schadet Hitze unmittelbar – bis hin zum Hitzschlag, der immer ein medizinischer Notfall ist.

Gesundheitliche Warnzeichen ernst nehmen
Fehlgeburten, Schlaganfälle, Hitzetote. Keine Frage: Die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels sind gravierend, und sie erfordern massive Veränderungen auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen: im Städtebau, in den Gesundheitseinrichtungen und auch im privaten Verhalten.
Allgemeinmedizinerin Beate Müller erforscht unter anderem, welche Rolle Hausärztinnen und Hausärzte im Klimawandel spielen. Und sie berät zu individuellen Tipps, um extreme Hitze gut zu überstehen. „Jede und jeder sollte sie kennen und möglichst frühzeitig beherzigen“, betont Beate Müller.
Unwohlsein, Schwindel, ein Gefühl von Mattigkeit und Müdigkeit sind Warnzeichen, die man bei Hitzewellen noch ernster nehmen sollte als sonst. Spätestens dann ist es nötig, sich stärker um sich zu kümmern und beispielsweise auch ärztlichen Rat einzuholen, wenn es einem nicht schnell wieder besser geht.
Jeder und jede sollte die individuellen Tipps gegen extreme Hitze kennen und sie frühzeitig beherzigen.
Die vermehrte Wachsamkeit sollte nicht an der eigenen Haustüre enden. „Viele der durch Hitze gefährdeten Menschen, verfügen nur über eingeschränkte Möglichkeiten, sich selbst vor den Folgen zu bewahren“, berichtet Müller. Beispielsweise die hochbetagte, leicht demente Nachbarin, die womöglich das Trinken vergisst, so dass ihr Kreislauf schlapp wird und sie bei jedem Schritt in Gefahr ist zu stürzen. Nicht umsonst appelliert das Bundesgesundheitsministerium auf einem Poster, bei Hitze auf andere zu achten.
Welche Personengruppen besonders gefährdet sind
Als besonders hitzebedroht gelten
- Ältere,
- chronisch kranke Menschen oder
- Menschen mit Behinderungen,
- Säuglinge,
- Kleinkinder und
- Schwangere.
Wer schwer körperlich und im Freien arbeitet, hat ebenfalls schlechtere Bedingungen.
Ein generelles Risiko besteht für von Armut Betroffene. „Diese Menschen leben oft in Wohnungen, die sich schnell stark aufheizen“, verdeutlicht die Biologin Prof. Dr. Susanne Moebus, Leiterin des Instituts für Urban Public Health der Universitätsmedizin Essen, „und ihnen fehlen oft die Mittel, um dieser belastenden Umgebung zu entkommen und sich richtig gut zu schützen.“
Maßnahmen gegen Hitze im Städtebau

Prof. Dr. Susanne Moebus, Leiterin des Instituts für „Urban Public Health“ der Universitätsmedizin Essen.
© Jochen Track
Viele Expertinnen und Experten – auch aus der Politik – sind darum längst überzeugt, dass die Maßnahmen zur Bewältigung des Temperaturanstiegs deutlich weiter reichen müssen als bis zur medizinischen Aufklärung der Bevölkerung.
„Wir brauchen eine Baugesetzgebung, die mehr Grün – also Pflanzen – verlangt und ebenso mehr Blau – also Wasser“, sagt Moebus, die auch Mitglied im Vorstand des Vereins „Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit“ (KLUG) ist.
Eine Studie der Technischen Universität München beleuchtet das Potenzial solcher Maßnahmen: Wären 30 bis 40 Prozent der Fläche in einer Stadt mit Rasen, Wald und Gründächern bedeckt, könnte sich der Hitzestress auf die Hälfte reduzieren. „Auch intelligente Lüftungssysteme und Dämmungen für Häuser wären ein wichtiger Beitrag“, sagt Moebus. Sie ist der Meinung: „Das Thema Hitzeschutz ist in Deutschland angekommen, stärker sogar als andere wichtige Aspekte des Klimawandels. Wir sind da inzwischen auf dem Weg.“
Wir brauchen eine Baugesetzgebung, die mehr Grün und mehr Blau verlangt!
Hitzeaktionspläne sind nicht verpflichtend
Aber die Aufgabe „Hitzeschutz für alle“ bleibt riesig. Sind wir ausreichend gewappnet, Glutsommer zu überstehen? Bereits 2017 hat das Umweltbundesamt Handlungsempfehlungen herausgebracht, die Kommunen als Basis dienen können, um lokale Hitzeaktionspläne zu entwickeln. Sie umfassen etwa die Etablierung von Hitzewarnsystemen, die Vorbereitung von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Betrieben, Kitas oder Bildungsstätten sowie die langfristige Bauplanung.
Es ist jedoch keine Verpflichtung, einen Hitzeaktionsplan auszuarbeiten. Beispielsweise hatte in Bayern bis zum vergangenen Sommer nur rund ein Viertel der Städte und Gemeinden erste Schritte für Anpassungsmaßnahmen unternommen.
Was sich bei der Hitzeanpassung ändern muss

Dr. Martin Herrmann, Vorsitzender von KLUG.
© W&B/Dominik Gigler
Und jetzt? Was passiert, wenn extreme Hitze zur Katastrophe wird wie in Lytton? „Darauf sind wir schlecht vorbereitet“, sagt Dr. Martin Herrmann, Vorsitzender von KLUG: Um uns flächendeckend besser aufzustellen, müsse die Politik das Thema stärker priorisieren. Es bräuchte große Netzwerke, die mit ihrer gebündelen Kompetenz überall Veränderungen gezielt anstoßen und voranbringen können.
Jonas Gerke, der bei KLUG im Bereich Hitzeschutz und Klimaanpassung tätig ist, konkretisiert diesen Anspruch. Zusammen mit Dutzenden Verbänden hat er jüngst politische Forderungen formuliert, die der Hitzevorsorge zusätzlichen Schub verleihen sollen. Demnach müssten zuständige Stellen für Umwelt, Gesundheit und Bauwesen enger zusammenarbeiten und abgestimmte und vor allem verbindlichere Vorgaben auch zur Finanzierung machen. Denn was nutzt die Forderung nach begrünten Fassaden oder Nebelduschen, wenn nicht geklärt ist, wer die Kosten dafür und für das nötige Personal übernimmt?
Hitzewellen können sich zu Großschadensereignissen und Katastrophen entwickeln. Darauf sind wir bislang schlecht vorbereitet.
Auf diese Frage fehlen bislang ausreichende Antworten. Vor allem in größeren Städten etablieren sich aber Initiativen, die das Thema Hitzeschutz breiter angehen. So gibt es in Köln ein kostenloses Hitzetelefon. Sehr stark gefährdete Menschen können sich registrieren lassen, um vor akuter Hitze persönlich telefonisch gewarnt zu werden.
Essen weist auf einem digitalen Stadtplan vom Park bis zum klimatisierten Museum Kühlorte aus, die sich als Zuflucht eignen. Und in Berlin haben sich zahlreiche Akteure, etwa die Ärztekammer und die Berufsfeuerwehr, zu einem Aktionsbündnis zusammengetan. Gemeinsam erarbeiten sie Musterhitzeschutzpläne für den Gesundheitssektor vom Rettungsdienst über ärztliche Praxen bis hin zu Pflegeinrichtungen.
Mut machen solche Initiativen allemal. Doch: Eine Glutglocke über der Stadt bleibt ein reales Szenario. Es bedroht unsere Gesundheit. Bleibt die Hoffnung, dass die Maßnahmen rechtzeitig greifen und weitere hinzukommen – und auf einen einfach nur schönen Sommer.