Es klingt wie ein banales Sprichwort, dass man auf ein Kissen sticken könnte. Aber in dem Satz steckt alles, was diese Frau ausmacht: „Das war damals, und heute ist heute.“ Wir befinden uns im Jahr 1926, in Berlin und einem einst hochherrschaftlichen Apartment am Lützowplatz 4.
Jean Elliott Tarnowitz schlüpft aus dem Bett. Es ist ihr 40. Geburtstag, gerade hat sie darüber nachgedacht, was hinter ihr liegt. Sie kam in den USA zur Welt, verbrachte jedoch den größten Teil ihres Lebens in Berlin. Auch den Ersten Weltkrieg, als das Wohnungsamt das protzige, mit verschlungenen Deckenornamente verzierte Domizil aufteilte.
Durch den größten Raum, einst das Arbeitszimmer ihres Ehemanns, zieht sich nun eine Zwischenwand. Jean ist immer noch mit Graf Arnim von Tarnowitz verheiratet. Die Liebe kam ihnen längst abhanden. Jean fühlt sich nicht mehr als Amerikanerin und erst recht nicht als Deutsche. Mit Arnim und seinen adligen, rechtsradikalen Freunden will sie nichts zu tun haben.
Rebellisches Alter Ego
Man muss nur ein bisschen googlen, um in der rebellischen Jean ein Alter Ego der Schriftstellerin Margaret Goldsmith zu erkennen. Sie veröffentlichte 1928 in New York ihren Roman „Karin’s Mother“, der jetzt erstmals in deutscher Übersetzung erscheint, mit dem Titel „Good-Bye für heute“. Der kleine Berliner Aviva-Verlag hat sich auf Wiederentdeckungen spezialisiert.
Dort kam vor ein paar Jahren bereits Goldsmiths Roman „Patience geht vorüber“ heraus, den sie 1930/31 auf Deutsch schrieb. Es ist lohnend, sich heute mit Goldsmith, ihrem Leben und Werk zu beschäftigen. Weil vieles dieser hundert Jahre alten Vergangenheit geradezu unheimlich an unsere Gegenwart erinnert.
„Das war damals, und heute ist heute“: Jean interessiert sich nicht für das Gestern, nur für das Hier und Jetzt. „Sie lebte in der Gegenwart und liebte sie“, schreibt Goldsmith. „Good-Bye für heute“ erinnert an Christopher Isherwood und seine Romane „Mr Norris Changes Trains“ (1935) und „Goodbye to Berlin“ (1939). Sie erzählen vom freizügigen Nachtleben rund um den Nollendorfplatz in der Endphase der Weimarer Republik. Und davon, wie diese Kultur von den Nationalsozialisten zerstört wurde.
Das war damals, und heute ist heute
Margaret Goldsmith, Diplomatin, Journalistin und Schriftstellerin.
„I am a Camera“, hat Isherwood gesagt. Er wollte die Welt um sich herum buchstäblich aufsaugen und mit der Präzision eines Fotoapparats wiedergeben. Goldsmith besaß eine ähnliche Haltung, doch von Isherwoods Neuer Sachlichkeit ist ihr zehn Jahre älterer Roman weit entfernt.
Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin
![]()
Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport.
Viele Szenen spielen in Salons und Cafés, wo sich adlige und bürgerliche Protagonisten darum streiten, ob die Republik einen Aufstieg oder den Untergang bedeutet und wie „höhere Töchter“ erzogen werden sollen. Kommuniziert wird auch mit Briefen, Telegrammen und Telefonen.
Von „Good-Bye für heute“ führt eine Traditionslinie zurück zu den Gesellschaftsromanen von Theodor Fontane und Georg Hermann. Gleichzeitig ist Goldsmiths Buch überaus modern. Die Schlagfertigkeit der Figuren erinnert an Vicki Baum, mit der Goldsmith befreundet war. Und beim ironischen Unterton, der ihre Erzählung durchzieht, kann man an Erich Kästner denken, dessen Bestseller „Emil und die Detektive“ Goldsmith ins Englische übersetzt hat.
Ein Riss durch die Familie
„Good-Bye für heute“ handelt von einer polarisierten Gesellschaft, nicht nur durch Jeans Familie geht ein Riss. Auf der einen Seite stehen erzreaktionäre Grafen und Herzöge, die der Monarchie und ihren ostpommerschen Landsitzen nachtrauern. Ihnen gegenüber versammeln sich aufmüpfige Jugendliche, die an die Revolution und das Morgenrot einer besseren Zukunft glauben.
Zu ihnen gehört der proletarische Gewerkschafter, der mit seiner Familie gleich hinter der Trennwand des Tarnowitzschen Palais haust. Und Jeans Tochter Karin, die Medizin an der Humboldt-Universität studiert und über das Rollenbild der „deutschen Hausfrau“ spottet. Sie verkörpert den Typus der Neuen Frau, der in Deutschland mit hosentragenden Bubikopf-Mädchen verbunden und in den USA „Flapper Girl“ genannt wurde.
Nationalsozialisten kommen in „Good-Bye für heute“ nicht vor. Und zwar, weil sie – wie der Übersetzer Eckhard Gruber im Nachwort erläutert – 1926 noch nicht die Demokratie bedrohten. Die Splitterpartei NSDAP war bis 1925 verboten und erreichte nach ihrer Neugründung bei den Reichstagswahlen von 1928 nur 2,6 Prozent der Stimmen.
 Der Lützowplatz heute. Nur drei alte Häuser überstanden den Bombenkrieg und den Wiederaufbau der Nachkriegszeit.
Der Lützowplatz heute. Nur drei alte Häuser überstanden den Bombenkrieg und den Wiederaufbau der Nachkriegszeit.
© IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer
Größere Gefahr ging von Freikorps wie der „Organisation Consul“ und ihren oft adligen Mitgliedern aus. Sie ermordeten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Matthias Erzberger und Walter Rathenau. Die Handlung des Romans kulminiert in einem Attentat auf den jüdischen Juristen Herbert Mendelssohn, der Jean in Rechtsfragen berät. Ein Freigeist, in dessen Kanzlei ein Gemälde von Otto Dix hängt und eine Lenin-Büste steht.
Lenin auf dem Schreibtisch
Margaret Goldsmith war eine Außenseiterin, die nirgends richtig reinpasste. 1895 als Tochter deutschstämmiger Auswanderer in Wisconsin geboren, kam sie um 1900 mit ihrer Familie nach Berlin. Sie studierte Germanistik an der Humboldt-Universität und in Illinois, wo sie ihre Abschlussarbeit über Goethes Sesenheimer Lieder schrieb.
Zu den Büchern 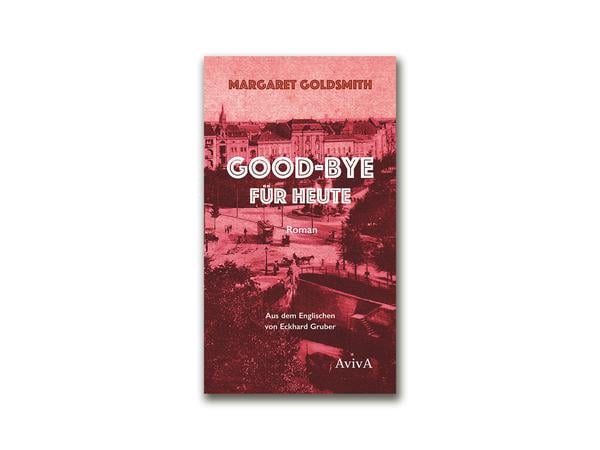
© Aviva Verlag
Margaret Goldsmith: Good-Bye für heute. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Eckhard Gruber, Aviva Verlag, Berlin 2025. 224 Seiten, 22 €.
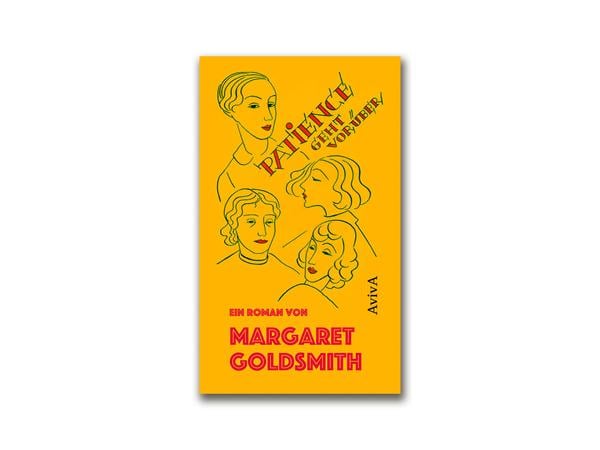
© Aviva Verlag,
Margaret Goldsmith: Patience geht vorüber. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Eckhard Gruber, Aviva Verlag, Berlin 2020. 224 seiten, 19 €.
1921 kehrt Goldsmith als Diplomatin nach Berlin zurück und steigt an der Botschaft zur stellvertretenden US-Handelskommissarin auf. Nebenbei arbeitet sie als Korrespondentin für amerikanische Zeitungen und Magazine. Sie verliebt sich in die britische Schriftstellerin Vita Sackville-West und zieht 1933 nach London, wo sie lebt, bis sie 1971 stirbt. Ihr literarisches Werk war bis vor wenigen Jahren nahezu vergessen.
Man kann „Good-Bye für heute“ auch als Reiseführer in die Vergangenheit benutzen, mit dem Buch in der Hand die Wege ablaufen, die Goldsmiths Heldin zurücklegte. Jean bummelt durch das Botschafts- und Regierungsviertel im Tiergarten, besucht einen Maler in dessen Atelier an der Kurfürstenstraße, kehrt ein in Krolls Restaurant am Reichstag.
Die großbürgerliche Welt von damals ist heute verschwunden, nur wenige Relikte haben im Berliner Zentrum den Zweiten Weltkrieg und den Nachkriegs-Wiederaufbau überstanden. Der Lützowplatz wurde 1943/44 durch Bomben zerstört. Lediglich drei Häuser auf der östlichen Platzseite überstanden die Verheerungen. Die Idee der „autogerechten Stadt“ sorgte dafür, dass auf der Westseite ein Drittel des Platzes heute unter dem Straßenasphalt verschwunden ist.
Mehr Literatur im Tagesspiegel: Sebastian Haffners Roman „Abschied“ Ein letzter Rückzug ins Private Hymnen für Strand und Baggersee Die zehn besten Musikbücher für den Sommer Anna Katharina Fröhlichs Buch „Roberto und ich“ Das innere Auge liest mit
Das Happyend von „Good-Bye für heute“ ereignet sich am Anhalter Bahnhof. Dort verabschiedet sich Jean von einem ehemaligen Geliebten und läuft dann mit ihrer Tochter Karin über eine Treppe zur Straße hinab, einer vermeintlich besseren Zukunft entgegen. Wenige Jahre später begann ab 1933 für viele Emigrantinnen und Emigranten am Anhalter Bahnhof der Weg ins Exil.
