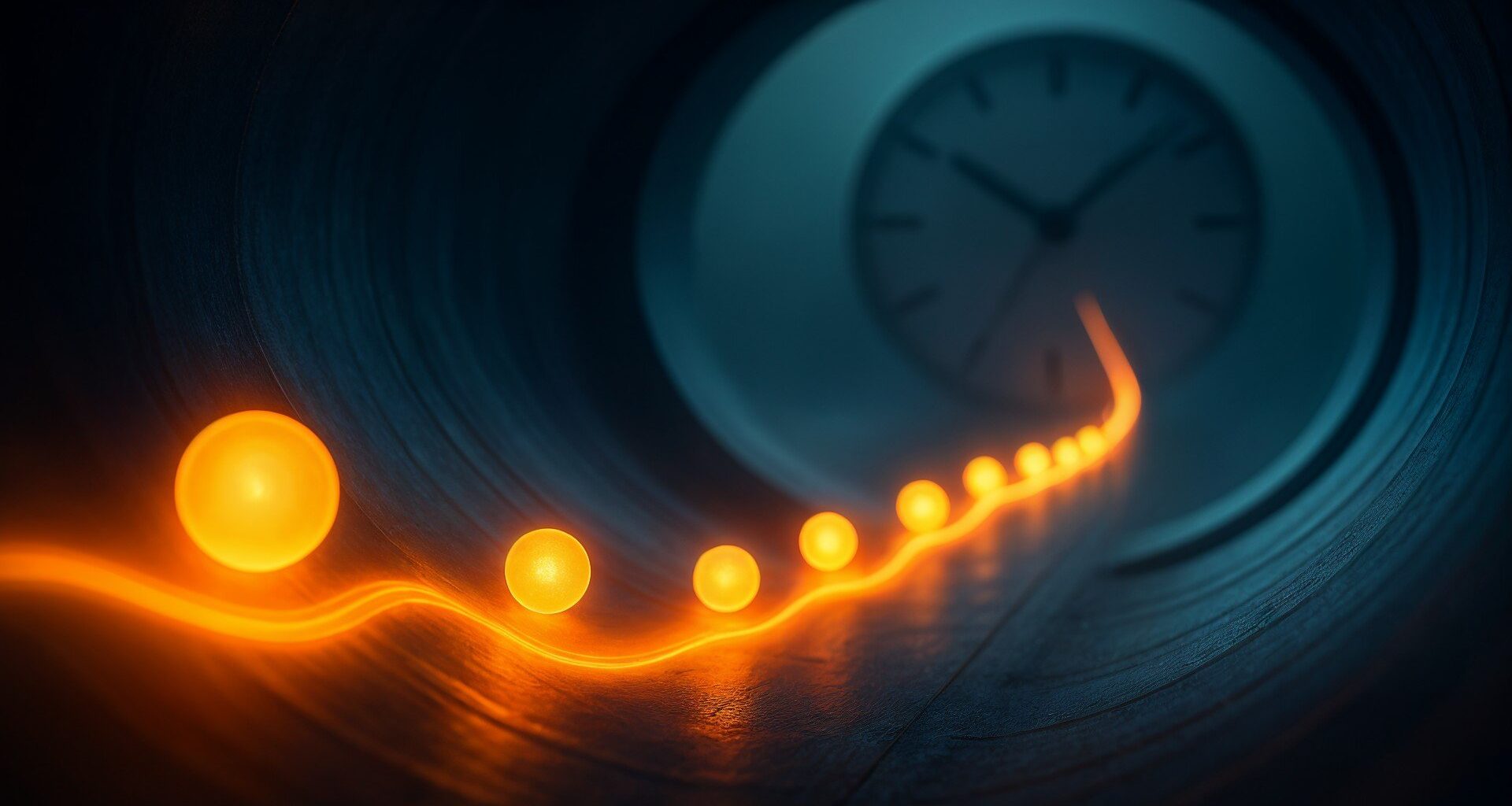Ein Grundprinzip der Physik galt lange als unumstößlich: Wer Zeit präziser messen will, muss dafür Energie opfern – je präziser, desto mehr. Ein Forschungsteam aus Wien zeigt jetzt, dass es auch anders geht – mit einem Quantenuhren-Konzept, das einen Trick beherrscht.

Neue Quantenuhr: Präzision fast ohne Preis
Ob GPS, Quantensensorik oder Telekommunikation – moderne Technologien basieren auf extrem präzisen Taktgebern, die physikalische Prozesse bis auf die milliardstel Sekunde genau erfassen. Doch mit jeder neuen Dezimalstelle steigt auch der Preis: Jeder Tick solcher Uhren erzeugt unvermeidlich thermodynamische Verluste – also Energie, die als Wärme entweicht, weil der zugrundeliegende Vorgang irreversibel ist. In klassischen Systemen mag das kaum auffallen, doch in der Quantenwelt und bei Anwendungen auf Nanoskala kann selbst kleinste Wärmeleistung stören. Je präziser die Uhr, desto größer das Problem – bislang galt das als unausweichlich.
Jetzt stellt ein internationales Team um die TU Wien dieses Prinzip infrage. In einer Studie, veröffentlicht in Nature Physics, schlagen sie ein neuartiges Uhrenkonzept vor, das Präzision fast ohne Energieverlust erzeugt. Der Ansatz beschreibt eine Quantenuhr, deren Taktgeber nicht mehr bei jedem „Tick“ thermodynamisch aktiv wird. Stattdessen nutzt sie einen quantenmechanischen Transportmechanismus, der nahezu ohne Energieverlust auskommt.
Die neue Uhr verzichtet auf den klassischen Taktgeber, bei dem jeder Zeitimpuls ein kleiner, aber energiezehrender Vorgang ist – etwa wie ein Zahnrad, das weiterklickt, oder ein Laser, der regelmäßig misst. Stattdessen greift das Konzept auf ein quantenphysikalisches Phänomen zurück: Zustände vieler Teilchen bewegen sich gemeinsam und gleichförmig weiter – wie eine Welle, die sich durch das System zieht. Fachleute sprechen dabei von „kohärentem Vielkörpertransport“. Dieser läuft nahezu verlustfrei ab, weil die Bewegung nicht gestoppt oder ständig überprüft werden muss.
Fakten zur neuen Quantenuhr
- Publikation: Nature Physics, 2025, DOI: 10.1038/s41567-025-02929-2
- Zentraler Mechanismus: Kohärenter, verlustfreier Quantentransport
- Besonderheit: Präzisionsgewinn fast ohne Entropieerzeugung
- Technologie: Supraleitende Schaltkreise mit Josephson-Kontakten
- Ausblick: Erste Prototypen in Entwicklung; Anwendungen in Quantenkontrolle und -kommunikation möglich
Man kann sich das vorstellen wie einen Sekundenzeiger, der sich lautlos und gleichmäßig weiterdreht, ohne dass er bei jedem Schritt Energie verliert – und trotzdem am Ende die Zeit exakt weitergibt.
Bisher war es ein Grundsatz der Physik, dass mehr Präzision auch mehr Energie kostet. Wer die Genauigkeit verdoppeln will, muss auch doppelt so viel Verlust in Kauf nehmen – etwa in Form von Wärme. Die neue Quantenuhr bricht mit dieser Regel. Ihr Energieverbrauch wächst nicht mehr im gleichen Tempo mit, sondern nur noch langsam – selbst dann, wenn die Messgenauigkeit deutlich steigt.
Langfristige Ziele
Die Forschung wurde in Nature Physics veröffentlicht und sieht bereits erste Anwendungen: Am Chalmers Institute wird ein Prototyp auf Basis von Josephson-Kontakten entwickelt – derselben supraleitenden Technologie, die auch in Quantencomputern von IBM oder Google zum Einsatz kommt. Laut Simone Gasparinetti, Co-Autor und Hardwareentwickler, sei ein Proof of Concept mit heutiger Technik „in Reichweite“.
Langfristig könnten solche Uhren nicht nur für präzisere Zeitmessung sorgen, sondern auch bei der genauen Steuerung anderer Quantengeräte helfen – etwa in Sensorik, Navigation oder zukünftiger Quantenkommunikation. Denn wie Huber es zusammenfasst: „Je präziser unsere Kontrolle über Zeit wird, desto weiter reicht unser Zugriff auf quantendynamische Prozesse – und das ohne unnötige Verluste.“
Was ist eine Atomuhr?
Eine Atomuhr ist ein hochpräzises Zeitmessgerät, das die Schwingungen von Atomen zur Zeitmessung nutzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Uhren, die auf mechanischen Schwingungen oder Quarzkristallen basieren, nutzen Atomuhren die extrem stabilen Schwingungen von Atomen, meist Cäsium-133.
Durch diese Methode erreichen Atomuhren eine außerordentliche Genauigkeit. Eine moderne Cäsium-Atomuhr verliert oder gewinnt theoretisch nur eine Sekunde in mehreren Millionen Jahren, was sie zum genauesten Zeitmessgerät macht, das Menschen bisher entwickelt haben.
Wie funktioniert eine Atomuhr?
Eine Atomuhr nutzt die Energieübergänge in Atomen als präzisen Taktgeber. Bei einer Cäsium-Atomuhr werden Cäsium-Atome erhitzt und in einen Resonator geleitet, wo sie mit Mikrowellen bestrahlt werden. Wenn die Frequenz genau 9.192.631.770 Hz beträgt, ändert sich der Energiezustand der Atome.
Diese Frequenz wird als Referenz verwendet, um die Zeit zu messen. Ein elektronischer Zähler zählt diese Schwingungen und wandelt sie in Sekunden, Minuten und Stunden um. Moderne Atomuhren nutzen auch andere Elemente wie Rubidium oder Wasserstoff, funktionieren aber nach ähnlichen Prinzipien.
Wozu brauchen wir Atomuhren?
Atomuhren sind für zahlreiche moderne Technologien unerlässlich. Satelliten-Navigationssysteme wie GPS, GLONASS oder Galileo benötigen die präzise Zeitmessung von Atomuhren, um genaue Positionsbestimmungen zu ermöglichen. Bereits winzige Zeitabweichungen würden zu erheblichen Positionsfehlern führen.
Auch Telekommunikationsnetze, das Internet, Energieversorgungsnetze und wissenschaftliche Forschung sind auf präzise Zeitsynchronisation angewiesen. Atomuhren definieren zudem die internationale Zeitskala UTC (Koordinierte Weltzeit), die weltweit als Referenz für die offizielle Zeit dient.
Wie genau sind Atomuhren?
Moderne Atomuhren erreichen eine erstaunliche Genauigkeit von etwa einer Sekunde Abweichung in mehreren Millionen Jahren. Die genauesten Cäsium-Fontänen-Uhren haben eine relative Ungenauigkeit von etwa 10^-16, was einer Abweichung von einer Sekunde in 300 Millionen Jahren entspricht.
Noch präziser sind optische Atomuhren, die mit Strontium oder Ytterbium arbeiten. Sie erreichen Genauigkeiten im Bereich von 10^-18, was theoretisch einer Abweichung von nur einer Sekunde in 30 Milliarden Jahren entspricht – länger als das Alter des Universums.
Wo werden Atomuhren eingesetzt?
Atomuhren finden in zahlreichen Bereichen Anwendung. Nationale Zeitinstitute wie die PTB in Deutschland oder das NIST in den USA betreiben Atomuhren zur Definition der gesetzlichen Zeit. Satelliten-Navigationssysteme wie GPS haben mehrere Atomuhren an Bord, um präzise Positionsdaten zu liefern.
Auch in der Grundlagenforschung, bei astronomischen Beobachtungen, in der Telekommunikation und in Rechenzentren kommen Atomuhren zum Einsatz. Große Forschungseinrichtungen wie CERN nutzen sie für synchronisierte Experimente, und selbst Finanzmärkte benötigen exakte Zeitstempel für Transaktionen.
Kann man Atomuhren kaufen?
Tatsächlich gibt es kommerzielle Atomuhren zu kaufen, allerdings sind diese nicht für den durchschnittlichen Verbraucher gedacht. Kleinere Rubidium-Atomuhren kosten etwa 5.000 bis 20.000 Euro und werden hauptsächlich von Forschungseinrichtungen, Telekommunikationsunternehmen oder spezialisierten Laboren genutzt.
Für den Heimgebrauch gibt es jedoch Funkuhren, die ihr Zeitsignal von Atomuhren beziehen. Diese Uhren empfangen Funksignale von Zeitzeichensendern wie DCF77 in Deutschland, die wiederum mit Atomuhren synchronisiert sind. So erhält man indirekt die Genauigkeit einer Atomuhr für wenige Euro.
Wer erfand die Atomuhr?
Die erste funktionsfähige Atomuhr wurde 1949 von Harold Lyons am National Bureau of Standards (heute NIST) in den USA entwickelt. Diese erste Ammoniak-basierte Uhr war nicht sehr genau. Der entscheidende Durchbruch kam 1955, als Louis Essen und Jack Parry am National Physical Laboratory in Großbritannien die erste Cäsium-Atomuhr bauten.
Diese Cäsium-Uhr, genannt Cäsium Mk.1, bildete die Grundlage für alle modernen Atomuhren. Ihre Entwicklung führte 1967 zur Neudefinition der Sekunde durch die Internationale Konferenz für Maß und Gewicht, die nun auf der Grundlage von Cäsium-Schwingungen festgelegt wurde.
Wie entwickeln sich Atomuhren?
Die Zukunft der Atomuhren liegt in optischen Atomuhren, die Licht statt Mikrowellen nutzen. Diese können eine bis zu 100-mal höhere Genauigkeit als herkömmliche Cäsium-Uhren erreichen. Wissenschaftler arbeiten an transportablen Versionen, die für Satelliten und weltraumbasierte Anwendungen geeignet sind.
Quanteneffekte wie Verschränkung werden erforscht, um die Präzision weiter zu steigern. Man diskutiert bereits eine Neudefinition der Sekunde, basierend auf optischen Übergängen. Diese Entwicklungen könnten zu neuen Anwendungen führen, etwa in der Erdbeobachtung, wo minimale Höhenunterschiede durch relativistische Zeitdilatation gemessen werden könnten.
Zusammenfassung
- Wiener Forschungsteam entwickelt revolutionäres Quantenuhren-Konzept
- Präzise Zeitmessung ohne entsprechend hohen Energieverbrauch möglich
- Neuartige Uhr nutzt kohärenten Vielkörpertransport statt klassischer Taktgeber
- Veröffentlichung in Nature Physics am 16. Juni 2025 mit wegweisenden Ergebnissen
- Supraleitende Schaltkreise mit Josephson-Kontakten bilden technologische Basis
- Energieverbrauch steigt nicht proportional zur Messgenauigkeit wie bisher
- Potenzielle Anwendungen in Quantenkontrolle und -kommunikation in Reichweite
Siehe auch: