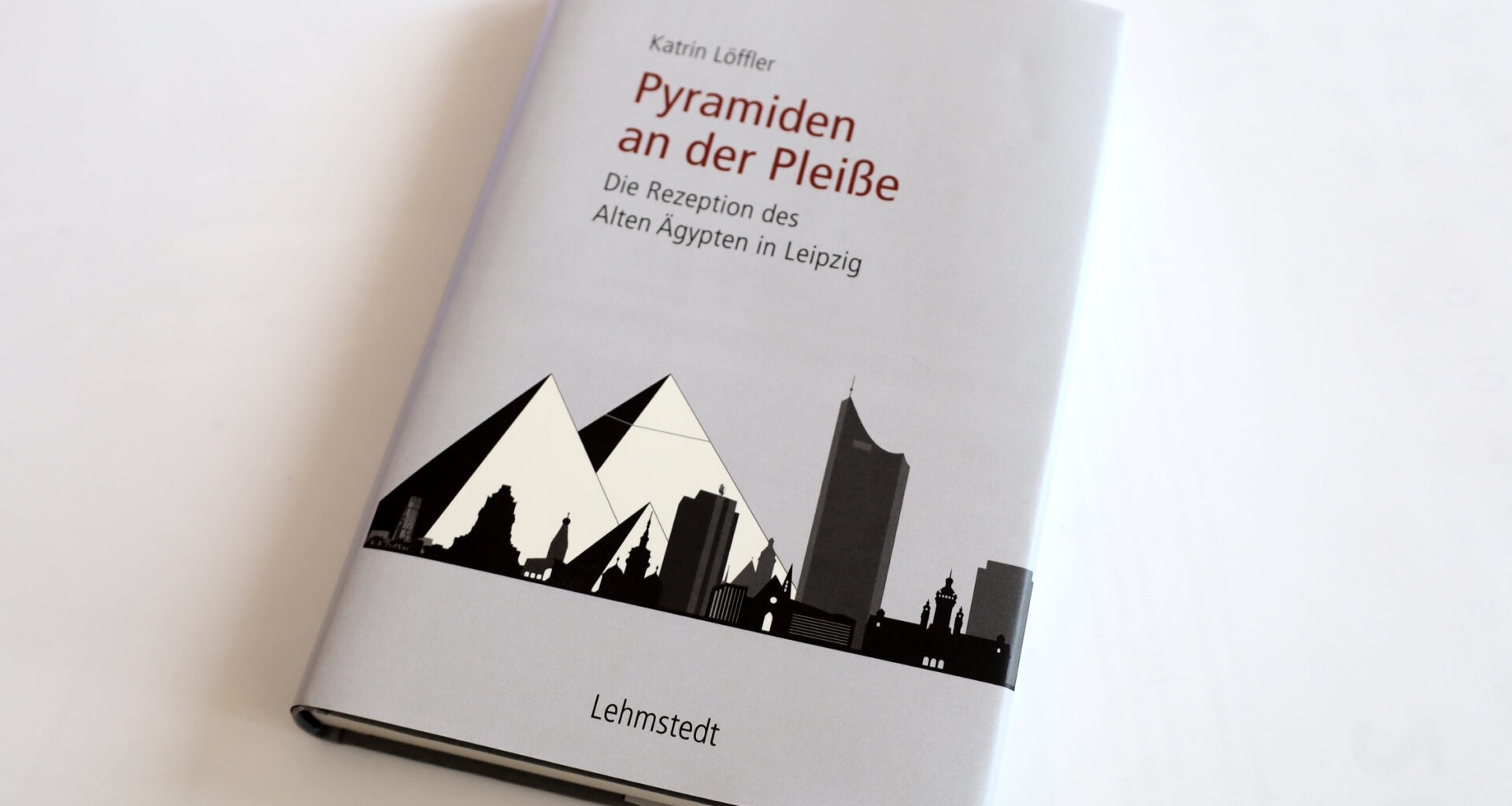Das Alte Ägypten hat die Europäer schon immer fasziniert. Nicht nur mit seinen gewaltigen Pyramiden. Auch mit seiner unvorstellbar langen Geschichte. Aber auch mit seiner beeindruckenden Religion. Das ist bei griechischen Autoren schon nachzulesen, die jahrhundertelang im Grunde die einzigen Quellen waren, aus denen sich die Mitteleuropäer über das sagenhafte Land am Nil informieren konnten. Reisen dorthin waren bis in die Frühe Neuzeit selten und gefährlich. Aber mit den Forschungsreisen im 15. und 16. Jahrhundert wuchs auch die Neugier. Auch in Leipzig.
Dass sich die Literaturwissenschaftlerin und Historikerin Katrin Löffler mit der Geschichte der Rezeption des Alten Ägyptens in Leipzig zu beschäftigen begann, hat mit der 2022 verstorbenen Leipziger Ägyptologin Elke Blumenthal zu tun, die sich auch nach ihrer Emeritierung mit diesem ganz speziellen Forschungsgegenstand auseinandersetzte, das Buch aber selbst nicht mehr schreiben konnte und das Thema Katrin Löffler zu treuen Händen gab.
Ein Thema, das für gewöhnlich nicht Forschungsgegenstand ist. Und das betrifft nicht nur die Ägyptologie. Das betrifft auch andere Studienfächer. Obwohl der Forschungsgegenstand viel darüber verrät, wie wir selbst mit der Kultur anderer Völker umgehen, wie uns diese Kulturen faszinieren und wir damit eigene Sehnsüchte, Erwartungen und Vorstellungen verbinden.
In Leipzig kommt noch hinzu: Als Buchstadt war Leipzig immer auch ein besonderer Ort, über den die neuesten Erkenntnisse und Berichte über Ägypten liefen. Hier veröffentlichten Reisende, Forscher und Historiker ihre Bücher. Hier waren aber auch die Verlage, die in der Lage waren, nicht nur hochwertige Drucke mit den Ansichten der ägyptischen Altertümer zu veröffentlichen, sondern auch die ersten Bücher mit ägyptischen Schriftzeichen, nachdem diese endlich entziffert werden konnten.
Ägypten im Stadtbild entdecken
Und so war es folgerichtig, dass an der Universität Leipzig auch einer der ersten ägyptologischen Lehrstühle entstand und sich hier mehrere Lehrstuhlinhaber als führende Forscher auf ihrem Gebiet profilierten.
Die dann auch selbst zu Forschungsreisen nach Ägypten aufbrachen und jene Funde mitbrachten, die heute den Bestand des Ägyptischen Museums der Universität ausmachen. Und natürlich blieb es dabei nicht. Denn die Faszination des Alten Ägyptens strahlte auch in die Stadt aus. Und wer seine Augen öffnet, sieht diese Zeugnisse einer Ägypten-Rezeption, zu deren Erkundung Katrin Löffler regelrecht auf eine Ägypten-Tour einlädt. Eine Tour, die dabei hilft, die Augen zu öffnen.
Denn so wie es keineswegs selbstverständlich ist, dass auf Leipziger Friedhöfen und in Parks kleine Pyramiden stehen, die die uralte ägyptische Begräbniskultur zitieren, ist es auch nicht selbstverständlich, dass selbst an markanter Stelle Obelisken stehen. Scheinbar reine Stilelemente, die sich die Künstler für ihre Entwürfe angeeignet haben. Die markantesten sind das Eisenbahndenkmal an der Goethestraße und der Obelisk am Mendebrunnen auf dem Augustusplatz.
Aber selbst an Eisenbahnüberführungen sieht man Obelisken als Stilelemente. Zeichen dafür, wie stark die ägyptische Kultur gerade im 19. Jahrhundert rezipiert wurde. Wohl nicht nur in Leipzig. Aber für andere Städte fehlt eine so umfassende Ausarbeitung, wie sie Katrin Löffler hier ausgehend von den Forschungen Elke Blumenthals vorgelegt hat. Und natürlich erwägt sie auch die Frage, was hinter dieser zeitweise sehr umfassenden Rezeption stehen könnte.
Wobei es auf der Hand liegt, dass hier mehrere Faktoren zusammenkamen – von den völlig neuen Möglichkeiten eines Tourismus, der sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte, bis hin zur – kolonialistisch geprägten – Sicht auf die Welt. Beide verstärkt durch Veröffentlichungen, welche die Ägypten-Faszination auch beim weniger betuchten Publikum entfachte. Wobei einer der berühmtesten Leipziger Forscher, Georg Ebers, mit seinen Ägypten-Romanen eine nicht ganz unwichtige Rolle spielte. Auch das beleuchtet Katrin Löffler.
Forschung und Legenden
Genauso wie die 200-jährige Geschichte der Ägyptologie an der Universität Leipzig – neben Georg Ebers geprägt durch Wissenschaftler wie den früh verstorbenen Friedrich August Wilhelm Spohn, dessen Grab zwar nicht erhalten ist. Aber als Teil seiner einst sehr markanten Grabanlage auf dem Alten Johannisfriedhof hat sich die ägyptisch nachempfundene Säule erhalten, die man auf dem Alten Johannisfriedhof auch heute noch sehen kann.
Mit Gustav Seyffarth wird einer seiner Nachfolger ins Bild gesetzt, der bei seinen Forschungen eher ein unglückliches Händchen hatte. Aber mit Georg Ebers und Georg Steindorff erreichte die Leipziger Ägyptologie Spitzenniveau. Das Ägyptische Museum, das heute den Namen des von den Nazis vertriebenen Professors trägt, ist ohne Steindorff nicht denkbar.
Aber Löffler streift auch ein Kapitel, das für Liebhaber von spannungsgeladener Literatur gar nicht so fremd ist: die Welt der Freimaurer, die auch in Leipzig – und zwar nicht nur im Logennamen – ägyptische Symbole und Legenden aufnahmen. Nur dass ihre Welt mit dem Zweiten Weltkrieg und seinen Zerstörungen genauso zu Staub der Zeit wurde, wie die der ägyptischen Reiche. Mit deutlich weniger Zeugnissen ihrer Existenz, auch wenn man diese an Leipziger Obelisken und sogar bei genauerem Hinsehen am Völkerschlachtdenkmal entdecken kann.
Was Katrin Löffler hier also vorlegt, ist eine recht umfassende Geschichte davon, wie Leipziger in den vergangenen rund 400 Jahren ägyptische Kunst und Geschichte aufnahmen und verstanden. Dass sie da manches auch falsch verstanden, weil anfangs – wie man das kennt – alte Überlieferungen und fantasiereiche Thesen dominierten – gehört mit zur Geschichte.
Davon erzählt auch der „Zedler“, das wohl maßgebende Lexikon der deutschen Aufklärung. Aufklärung bedeutete eben auf fast allen Wissensgebieten oft gerade erst den Anfang, mit alten Märchen und Vorstellungen aufzuräumen. Was aber nicht bedeutete, dass die Zeitgenossen mit dem vor allem in Büchern verbreiteten Wissen nichts anfangen konnten. Im Gegenteil.
Ägypten auf der Bühne
Sie ließen sich regelrecht faszinieren, wie die Innenraumgestaltung der Nikolaikirche durch Johann Carl Friedrich Dauthe zeigt, in der er griechische und ägyptische Säulenformen mit filigran aufsprießenden Palmblättern verband. Und die Palme spielt nicht nur in der Bibel eine zentrale Rolle, sondern neben anderen Pflanzen aus dem Nildelta auch in der ägyptischen Kunst. Dass die so gestalteten Säulen auch geradezu zum Symbol der Friedlichen Revolution geworden sind, wird natürlich auch erwähnt.
Es lohnt sich also, mit Katrin Löffler auf die Spurensuche zu gehen und die überdauernden Relikte einer einst sehr umfassenden Ägypten-Rezeption zu suchen. Eine Rezeption, die gerade im 19. Jahrhundert selbstverständlich war – nicht nur in Leipzig. Davon erzählen neben Büchern auch Dramen und Opern, wie die bis heute mit begeistertem Publikum immer wieder gespielte Oper „Aida“.
Aber selbst Mozarts „Zauberflöte“ spielt mit ägyptischen Motiven. Und die Frage steht durchaus, wie heftig die (Wieder-)Entdeckung Ägyptens auf Kunst, Kultur und Reiselust in Deutschland wirkte. Erst recht, als im frühen 20. Jahrhundert Foto und Film die großen Entdeckungsgeschichten begleiteten und die Leipziger, die es sich leisten konnten, dazu animierten, selbst ins legendäre Giza zu fahren, um Pyramiden und Sphinx zu bewundern.
Neugier und Aneignung
Und es ist gut möglich, dass die Faszination bis heute nicht nachgelassen hat. Auch wenn Architekten eher auf Verzierungen mit Obelisken, Sphingen und Pylonen verzichten. Im Grunde erzählt Löfflers Buch ja von dieser anhaltenden Faszination, nur dass der Blick sich jetzt auf die durchaus beeindruckende Rezeptionsgeschichte des Phänomens Ägypten in Leipzig richtet. Eine Geschichte, die auch von Neugier, Reiselust und gewaltigem Wissensdurst erzählt.
Es ist ja nicht nur das Geheimnisvolle, das neugierig macht auf die Geschichte der ägyptischen Reiche und Dynastien, sondern auch ihr verblüffender Reichtum, der selbst heute noch wahrnehmbar ist, obwohl die ägyptischen Schätze Jahrtausende der Plünderung erlebten und eines gedankenlosen wie fahrlässigen Umgangs mit diesen Schätzen aus dem Wüstensand. Deren Weg in europäische Sammlungen sogar zeitweilig der einzige war, sie vor dem Verschwinden in finsteren Kanälen zu retten.
Elke Blumenthal war es übrigens auch, die wesentlich dazu beitrug, den Lehrstuhl für Ägyptologie an der Universität Leipzig zu retten. Und das Ägyptische Museum ist bis heute der Ort, an dem auch die Leipziger die Faszination dieser Jahrtausende alten Kultur entdecken können. Das Buch lädt auch dazu ein und macht so nebenbei deutlich, wie sehr unsere eigene Kultur auch in diesem speziellen Fall durch die Kultur eines scheinbar fremden und fernen Landes bereichert wurde.
Und viele Elemente dieser Rezeption so nahtlos in die eigene Kultur übernommen wurden, dass der Betrachter oft gar nicht mehr sieht, dass hier tatsächlich ägyptische Stilelemente übernommen wurden. Manchmal einfach der Ästhetik wegen.
Aber oft genug auch bewusst, weil damit auch eine Botschaft oder ein Bekenntnis verbunden war, entschlüsselbar oft erst, wenn man überhaupt erst bemerkt, dass der Schlüssel in der ägyptischen Geschichte liegt.
Katrin Löffler „Pyramiden an der Pleiße“ Lehmstedt Verlag, Leipzig 2025, 48 Euro.