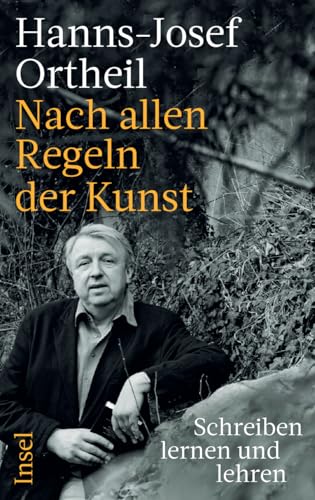Hanns-Josef Ortheil bietet in seinem Buch „Nach allen Regeln der Kunst“ gewinnbringende Einblicke in seine jahrzehntelange Unterrichtserfahrung im Kreativen Schreiben
Von Michael Fassel![]()
![]()
Besprochene Bücher / Literaturhinweise
Wie lässt sich Kreatives Schreiben erlernen? Wie gelingt eine erfolgreiche Vermittlung von Kreativem Schreiben? Welche Bedeutung hat das Reisen für das eigene Schreiben? Wie gestaltet man literarische Räume, wie entwirft man Figuren? Wie formuliere ich eine Romanidee aus? Solche und viele weitere Fragen diskutiert und reflektiert Hanns-Josef Ortheil in seinem Buch Nach allen Regeln der Kunst. Schreiben lernen und lehren. Darin blickt er auf 30 Jahre Lehrerfahrung sowie auf die eigenen Schreibprozesse zurück, indem der Autor u.a. erhellende Einsichten in seinen facettenreichen Lehralltag bietet. Darüber hinaus bildet das Buch ein breites Spektrum verschiedener Inspirationen und Impulse ab, die sich Schreibende aneignen und im Arbeitsprozess produktiv umsetzen können. Ortheil legt kein didaktisches Regel- oder Lehrwerk vor, sondern führt in einem einladenden Erzählton aus, welche unkonventionellen Mittel und Materialien einen Schreibprozess in Gang bringen und halten können. Lediglich eine Regel gilt es zu beherzigen: den eigenen, selbst aufgestellten Regeln zu folgen. Gleichwohl soll dieses Credo nicht darüber hinwegtäuschen, dass Schreiben mit Fleiß verbunden ist und trainiert werden sollte.
Das Schreiben möchte Ortheil nämlich nicht als beiläufiges Hobby verstanden wissen; vielmehr handelt es sich um einen kreativen Prozess, der Vorarbeit, Recherche und das Überarbeiten eigener Texte umfasst. Wie genau schließlich die Arbeitsschritte aussehen, hängt von der Profilierung des eigenen Schreibtyps ab. Bestenfalls sollte das Schreiben gar trainiert resp. ritualisiert werden, indem man zum Beispiel frühmorgendliches Schreiben pflegt. Nichtsdestoweniger weist Nach allen Regeln der Kunst keinen normativen Charakter auf, wie man ihn in dem einen oder anderen Schreibratgeber findet. Ortheil pflegt einen deskriptiven Stil, um die Spielwiese möglicher Schreibimpulse und -übungen auszuschöpfen. Er greift dabei nicht nur auf seine eigenen Erfahrungen zurück, sondern stellt Arbeitsweisen und Materialien anderer Schriftsteller:innen vor und umreißt die Denk- und Schreibwerkstätten bedeutender Autor:innen. So nutzt beispielsweise Herta Müller Ausschnitte aus Zeitungen, die sie zur Bildung neuer Sätze anregt.
Ortheil skizziert überdies in gebotener Kürze Einblicke in die Kulturgeschichte des Schreibens, greift große Denker wie Aristoteles, Plinius oder Theophrast auf, um zu zeigen, wie stark sie unser heutiges Verständnis vom Schreiben beeinflusst haben und immer noch beeinflussen. Insbesondere im ersten Viertel des Buches wirft Ortheil schlaglichtartig einen Blick auf Ikonen des Schreibens, indem er Schreibszenen aus exemplarisch ausgewählten Gemälden oder Skulpturen präsentiert. Doch auch wichtige Stimmen der Gegenwart, wie z.B. Thomas Mann oder der für das Schreiben einflussreiche Roland Barthes, werden aufgegriffen, um sie für Überlegungen über mögliche Arbeitsprozesse fruchtbar zu machen.
Ortheil stellt verschiedene Arbeitsmethoden vor, die für das eigene Schreiben ergiebig sind. Jeder Schreibtyp muss sein eigenes Profil ausbilden, herumexperimentieren auch mit unkonventionellen Methoden, den Blick über den künstlerischen Tellerrand zulassen. Nicht umsonst verweist Ortheil u.a. auf Film, Fotografie und Musik, die das eigene Schreiben beflügeln können. So lädt der Autor gelegentlich zu praktisch umsetzbaren Stil- und Schreibübungen ein, etwa wenn es um das Finden von Synonymen geht, um einen einfachen Beispielsatz umzuformulieren: „Mit Hilfe von Synonymen können wir im Kopf blitzschnell möglichst viele Varianten durchspielen und die jeweils angemessene, passende Schreibweise orten.“
Besonders erfrischend sind die kurzen Kapitel, in denen er spannende und kritische Fragen seiner Studierenden aufgreift und beantwortet, indem er persönliche Einblicke in seine eigenen Arbeitsweisen offenbart und sich so über die Schulter blicken lässt. Ortheil betont die Wichtigkeit intensiver Gespräche über den eigenen Stil, über selbst verfasste Texte und die Reflexion der Arbeitsweisen, wie sie auch spätestens in Verlagslektoraten geführt werden. Dies spiegelt sich auch in der Hildesheimer Lehre: „Es ging nie nur darum, das Schreiben zu lehren, sondern immer auch darum, es genauer zu verstehen und die entstehenden kreativen Prozesse zu beleuchten und zu beschreiben.“ KI hat bis zum Abschluss des Buches offenbar keine nennenswerte Rolle in Ortheils Lehre gespielt. Erst am Ende seines Buches verweist der Autor auf KI-Modelle, die im Rahmen eines „großen Forschungsprojekts“ angegangen werden, das danach fragt, wie die KI zukünftig Prozesse des Schreibens mitgestalten könne.
Ortheil legt dar, dass die Lehre des Kreativen Schreibens überdies nicht ausschließlich im Seminarraum stattfindet, sondern auch auf Exkursionen u.a. nach Paris, Venedig, Köln oder in den Westerwald. Daran anknüpfend befasst sich Ortheil mit der Bedeutung des Reisens für das Schreiben. Je nachdem, wie Reisende den Fokus setzen, können sich aus Reisen etwa Abenteuergeschichten oder Bildungsreisen speisen, was wiederum die von Ortheil diskutierte Frage einschließt, inwiefern sich Schreibende in den Raum einschreiben, wie sie einen Raum literarisch in Szene setzen, wie und welche Figuren sich diesen Raum aneignen. Allein das Stellen bloßer Fragen kann schon als Schreibimpuls betrachtet werden.
Anhand der gegensätzlichen Arbeitsweisen zweier bedeutender Schriftsteller erläutert Ortheil, wie aus Recherchen, Anregungen und gesammelten Materialien ein Roman entstehen kann, indem er die Werkstattprozesse von Franz Kafka und Heinrich Böll gegenüberstellt. Dank des Forschungszweigs der Critique génétique gibt es die Möglichkeit, handschriftliche Planungsarbeiten verstorbener Autoren zu erkunden. Während Kafka recht unvorbereitet mit dem Schreiben seines Romans Der Proceß angesichts zahlreicher Streichungen und Überarbeitungen nur stockend vorankam und das Projekt nicht abschloss, plante Böll en détail jedes Kapitel eines Romans u.a. mit Grafiken und farbigen Schemata. Kafka musste sich trotz seiner Korrekturen auf der ersten Seite seines handschriftlichen Manuskripts schlussendlich sein Scheitern eingestehen. Angesichts des offenbar sonst sehr gut lektorierten Buches fällt jedoch das Manko ins Auge, dass Kafka am „30. November 2014“ (anstatt 1914) einen Tagebucheintrag vorgenommen hat.
Insgesamt legt Ortheil ein in jeder Hinsicht gewinnbringendes Buch vor. 30 Jahre geballte Lehrerfahrung im Kreativen Schreiben und Literarischen Schreiben, die eigene Schreiberfahrung und das stupende Wissen zur Schreibkulturgeschichte machen die Lektüre zu einem ebenso unterhaltsamen wie auch erkenntnisreichen Erlebnis. Die zahlreichen Übungen resp. anregenden Arbeitsmethoden sind für die eigene Schreibarbeit praktisch anwend- und umsetzbar, wenn man den Regeln der Kunst im besten Sinne vertraut. Vor diesem Hintergrund sollte Ortheils Buch nicht als simpler Ratgeber für kreatives Schreiben gelesen werden. Wer das Buch nur unter diesem Aspekt liest, verkennt seinen eigentlichen Wert.
Ein Beitrag aus der Redaktion Gegenwartskulturen der Universität Duisburg-Essen