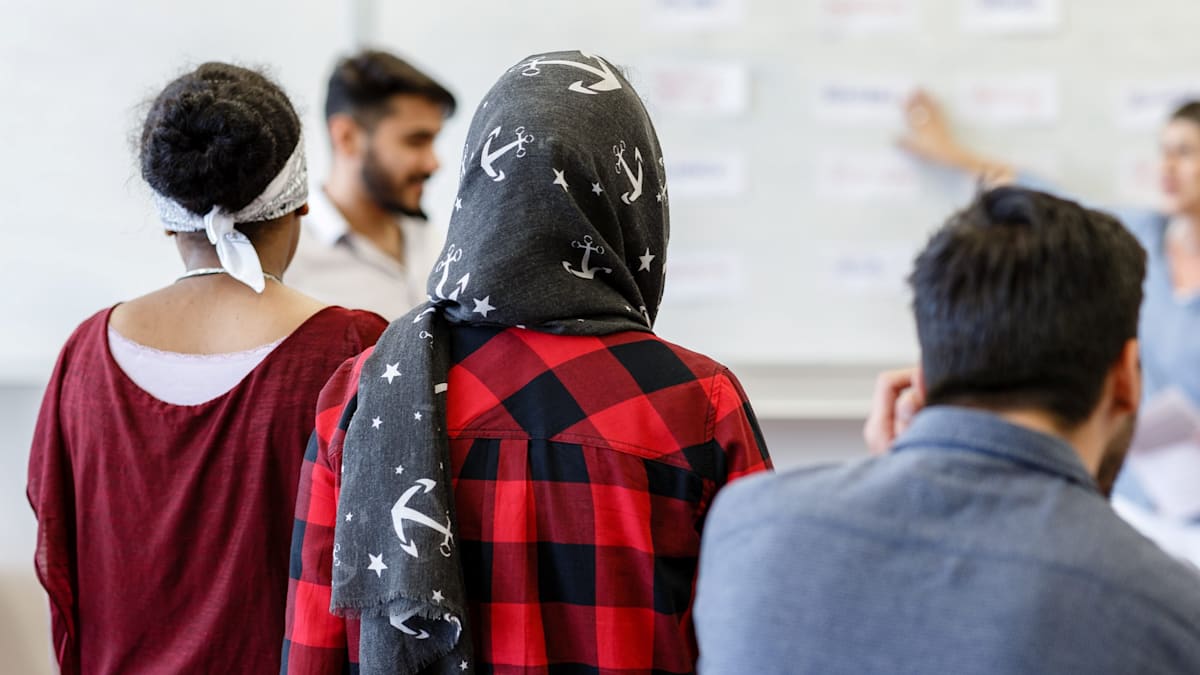Bei Berufssprachkursen für Asylbewerber wird stark gespart – dabei sollen Migranten dort fit für den Arbeitsmarkt werden. Der Leiter eines Sprachinstituts warnt: Der neue Ansatz der Politik sei praxisuntauglich. „Ich habe das Gefühl, in Berlin ist die Situation nicht bekannt.“
Deutschland spart bei berufsbezogenen Sprachkursen für Migranten. Hintergrund ist der noch geltende vorläufige und knappe Haushalt der damaligen Ampel-Koalition. Statt des auf 500 Stunden Unterricht angelegten und etablierten Berufssprachkurses (BSK), den etwa anerkannte Asylbewerber oder Arbeitsmigranten nach ihrem Integrationskurs belegen dürfen, setzen das Arbeitsministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) jetzt prioritär auf einen anderen Kurs, den „Job-BSK“. Er dauert 100 bis 150 Stunden und soll direkt am Arbeitsplatz stattfinden. Ein neu gegründetes Netzwerk von Sprachschulen, die solche Kurse anbieten sollen, klagt: Der „Job-BSK“ sei kein adäquater Ersatz. Zudem entstünden damit zahlreiche weitere Probleme. Kai U. Müller, 61, Geschäftsführer der Sprachenakademie Aachen, spricht für dieses Netzwerk.
WELT: Herr Müller, seit Anfang dieses Jahres spart die Bundesregierung bei den regulären Berufssprachkursen (BSK), die über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vergeben und vom Arbeitsministerium bezahlt werden. Was ist Ihre Bilanz?
Kai U. Müller: Es gibt einen immer größeren Stau von Lernwilligen, die regelmäßig nach Kursen fragen und keinen bekommen. Die Fallmanagerinnen und Fallmanager in den Jobcentern suchen händeringend nach Möglichkeiten des Spracherwerbs für ihre „Kunden“. Wir Sprachkursträger haben teils extreme Finanzprobleme. Viele freiberufliche Lehrkräfte fallen quasi ins Bodenlose. Kommt mit dem neuen Bundeshaushalt nicht kurzfristig mehr Geld, drohen Kurzarbeit, Kündigungen, auch Insolvenzen. Besonders betroffen sind Träger, die Lehrkräfte eingestellt haben – was ja eigentlich sehr wünschenswert ist – und sich stark auf Berufssprachkurse konzentriert haben.
WELT: Wie stark mussten Sie reduzieren?
Müller: 2024 hatten wir 500 Teilnehmer in Berufssprachkursen, jetzt noch genau einen Kurs mit 22 Teilnehmern. Und das wird der vorerst letzte sein, denn weitere Kurse haben wir nicht zugelost bekommen.
WELT: Was heißt „zugelost“?
Müller: Am 16. Juni hatten die Sprachschulen unserer Region ein Treffen mit dem zuständigen BAMF-Außendienstler. Der hat Zettel in eine Tasse gefüllt mit vielen Nieten. Der Gewinn: der Zuschlag für einen der wenigen verbliebenden Berufssprachkurse, an denen Existenzen von Lehrkräften hängen. Wir sind leer ausgegangen. Verlosungen dieser Art finden bundesweit statt.
WELT: Wer besucht diese Kurse?
Müller: Zwei Fünftel unserer Teilnehmer letztes Jahr waren Ukrainer, dazu kamen Syrer, Türken, Iraner, Inder, Afghanen, Russen, Leute aus der Maghreb-Region und so weiter. Alles überaus lernwillige, hoch motivierte Leute, die die Prüfung nach ihrem Integrationskurs bestanden hatten und sich nun in Richtung Arbeitsmarkt bewegen wollten. Unsere Teilnehmer waren in der Regel auf Kurs in eine Ausbildung oder eine Anstellung, für die sie das Niveau B2 oder C1 erreichen mussten, meist höher qualifiziert. Auch jetzt ist die Nachfrage extrem groß. Wir müssen alles absagen, die Leute verzweifeln.
WELT: Mit welcher Konsequenz?
Müller: Arbeitsbiografien werden gestoppt, oder der Einstieg in den Arbeitsmarkt verlängert sich stark. Bedeutet: längerer Verbleib in Sozialleistungen, das kostet die Kommunen viel Geld. Und sie werden doppelt belastet. Neben den Sozialleistungen brechen ihren Volkshochschulen Einnahmen weg, und diese führen teilweise bis zu 50 Prozent der Kurse durch.
WELT: Es gibt auch Kritik an den Berufssprachkursen. Diese seien nicht effizient genug, es gebe zu viele Kurswiederholer – kommen die Kürzungen zu Recht?
Müller: Bei uns haben 80 Prozent der Teilnehmer mit den angestrebten Zertifikaten bestanden. Wir haben uns auf B2-Kurse mit 500 Kursstunden fokussiert. Höhere Durchfallquoten insgesamt oder an anderen Standorten könnten wie folgt entstehen: Es gibt fünf Arten von Berufssprachkursen mit dem Kursziel vom niedrigen Deutsch-Niveau A2 bis zum sehr hohen Niveau C2.
Die Formate A2 und B1 haben wir nicht angeboten, da sie sich an Leute richteten, die vorher satte dreimal durch die Abschlussprüfung der Integrationskurse gefallen sind. Dabei handelte es sich durchaus auch um kaum beschulbare und/oder rudimentär alphabetisierte Leute. Oder um notorische Leistungsverweigerer. Diese Kurse waren Fehlkonstruktionen, daher könnten auch höhere Durchfallquoten rühren.
WELT: Das heißt, Sie sehen Reformbedarf?
Müller: Ja, was diese unteren Kursklassen angeht, und prinzipiell wäre mehr Orientierung der Kurse am Arbeitsmarkt sicher gut – etwa durch begleitende Praktika.
WELT: Im Arbeitsministerium, noch geprägt durch den damaligen Minister Hubertus Heil (SPD), hat man statt einer Reform der Berufssprachkurse das System von jetzt auf gleich umgestellt. Als Mittel der Wahl gilt dort jetzt – dafür soll das vorhandene Geld prioritär ausgegeben werden – der „Job-BSK“. Die Teilnehmer sollen schon einen Job gefunden haben, und, so die Botschaft: arbeiten statt in Kursen sitzen.
Müller: Das alles gehört zum unter Heil entwickelten „Job-Turbo“, der bekanntlich nicht funktioniert. Man will aber unbedingt der Öffentlichkeit vermitteln, dass man Flüchtlinge irgendwie in Arbeit kriegt. Diese neuen „Job-BSK“ sollen diesen Eindruck verstärken, sind aber mehr Symbolpolitik als effektiv. Denn Arbeitsmarktintegration ist ein langsamer Prozess, und dazu gehört zwingend – damit der Einstieg überhaupt klappt –, dass man vorher sprachlich ausgebildet wird. Mit dem Fokus auf den unbedingten schnellen Einstieg erreichen Sie im Zweifelsfall höchstens, dass ein Ingenieur einen Tellerwäscherjob annimmt, für den er die Sprache nicht beherrschen muss.
WELT: Das kann man legitim finden, wenn dieser Ingenieur somit keine Leistungen bezieht.
Müller: Wie nachhaltig ist so eine Beschäftigung? Zur Bewältigung des Fachkräftemangels trägt das nicht bei. Die Praxis zeigt ohnehin: Die „Job-BSK“ werden kaum nachgefragt und auch kaum angeboten, weil sie leider am Reißbrett erdacht und praxisuntauglich sind.
WELT: Inwiefern?
Müller: Nehmen wir Folgendes an: Sie haben in der Städteregion Aachen, die bis in die Eifel reicht, mehrere Logistikunternehmen. Über diese verteilt sind dann Leute, die bräuchten einen Sprachkurs, um sich fortzubilden für ihre berufliche Entwicklung oder überhaupt um ihren Job besser zu machen. Dann müssen Sie über die Betriebe verteilt eine Gruppe von Leuten zusammensuchen, die ein ungefähr vergleichbares Sprachniveau hat, um überhaupt erst mal einen Kurs zusammenzustellen. Die Betriebe müssen Sie als Sprachschule nach ihren sprachlichen Anforderungen fragen und daraufhin ein Unterrichts-Curriculum erarbeiten. Dann müssten diese Leute von den Firmen freigestellt werden, alle zeitgleich, auf Betriebskosten. Die Unterrichtsräume müssen außerhalb der Betriebe liegen.
Im ländlichen Raum haben Sie dann das große Problem: Wie soll das mit dem Pendeln funktionieren? Das funktioniert vielleicht in Großstädten oder dort, wo Sie sehr große Industriestandorte haben, wo sie eine Gruppe in einem einzigen Unternehmen zusammenbekommen. In Hamburg haben Sie jetzt vielleicht 30 dieser Kursformate, von vormals über 100 richtigen Berufssprachkursen.
WELT: Die „Job-BSK“ sind also ein Reinfall?
Müller: In einzelnen Fällen funktionieren sie. Wir machen Kurse für Ärzte, für Zahnärzte und Pflegekräfte, die C1- oder C2-Niveau brauchen. Das sind Sonderkursformate, die bieten wir digital an mit bundesweiten Teilnehmern. Jeder einzelne Teilnehmer von anderswo als dem Aachener Raum muss allerdings doppelt genehmigt werden: einmal von unserem regionalen BAMF-Außendienstler, einmal vom BAMF-Außendienstler aus der Heimatregion des Teilnehmers.
WELT: Heißt: viel Bürokratie, in der Regel unbrauchbar – gleichzeitig aber steigt die Verweildauer verschiedener Migrantengruppen in Deutschland, also auch der Bedarf für weiterführende Sprachkurse. Erkennt die Politik das Problem?
Müller: Ich habe das Gefühl, in Berlin ist die Situation nicht bekannt. Dort setzt man weiterhin auf die genannten Schreibtisch-Konzepte. Das ist für Sprachschulen wie uns existenzbedrohend und geht völlig an der Fachkräftemangel-Realität vorbei – und eine unbekannt große Zahl von Arbeitswilligen bleibt im Sozialleistungsbezug, weil sie wegen mangelnder Sprachkenntnisse gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden.
Jan Alexander Casper berichtet für WELT über innenpolitische Themen.