
AUDIO: Libanesische Geschichte in den Romanen von Pierre Jarawan (55 Min)
Stand: 07.07.2025 06:00 Uhr
Pierre Jarawan erzählt in seinem Roman „Frau im Mond“ von Flucht, Identität und entdeckt anhand von der Hauptfigur Lilit Familiengeheimnisse zwischen dem Libanon und Kanada und der Suche nach sich selbst.
Früher war er mal deutscher Meister im Poetry Slam, heute schreibt er international erfolgreiche Romane. Pierre Jarawan tritt dennoch eher leise auf. Er lebt in München, der Vater stammt aus dem Libanon und dieses Land ist Flucht und Angelpunkt in seinen Büchern. Nach „Am Ende bleiben die Zedern“ und „Ein Lied für die Vermissten“ ist im Frühjahr sein dritter Roman erschienen, „Frau im Mond“ – von der Kritik hochgelobt, ist Jarawan jetzt mit dem Buch auf Lesereise, auch im Norden. Mit Katja Weise spricht Pierre Jarawan in NDR Kultur à la carte über seine Recherchen, Inspirationen und erklärt, was „The Lebanese Rocket Society“ mit dem Buch zu tun hat.
Teile des Romans spielen im Libanon, aber er beginnt in Kanada, und dass das so ist, hängt wiederum auch mit der „Lebanese Rocket Society“ zusammen. Das ist eine Gruppe von Forschern an einer Universität in Beirut, die in den 1960er-Jahren an einem Raketenprogramm arbeiteten.
Pierre Jarawan: Wenn man die Geschichte der Rocket Society chronologisch erzählen möchte, dann müsste man 1915 beginnen. Bei der Recherche habe ich schnell gemerkt, dass sich das am armenischen College in Beirut abgespielt hat, also die erste armenische Hochschule im Nahen Osten. Es ist eine Geschichte der Armenier im Libanon. Man kann diese Geschichte nicht erzählen, ohne zu sagen, warum Armenier im Libanon sind. Dann ist man schon bei der Ursache und die liegt 1915 im Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich. Viele Armenier sind damals in die Provinz Beirut geflüchtet. Den heutigen Libanon gab es damals noch nicht. Dort ließen sie sich nieder, wurden über die Jahrzehnte Teil der libanesischen Gesellschaft, wurden Libanesen armenischer Herkunft und gründeten Ende der 1950er-Jahre dieses College und suchten Dozenten. Dort bewarb sich dann Manouc Manukyan – so geht die wahre Geschichte – und gründete dort mit den Enkeln von Genozid-Überlebenden diese „Lebanese Rocket Society“. Dass das so eine Erfolgsgeschichte wurde, war nicht abzusehen.
Für mich war klar, ich muss, um irgendetwas greifbar zu machen, historisch bis 1915 zurückgehen. Mir war auch klar, über vier Generationen zu erzählen ist möglicherweise ein bisschen viel für so einen Roman, bleiben wir bei drei, dann tricksen wir ein bisschen und machen einen hundertjährigen Großvater. Er ist 1920 geboren und 2020 ist die Zeit, in der Lilit, seine Enkeltochter, erzählt. Da ist er 100 Jahre alt. Dann war mir am Anfang gar nicht so klar, dass diese Geschichte nach Kanada gehört. Man zeichnet sich einen Lebenslauf oder einen Stammbaum auf und stellt fest, der muss Physik und Mathematik studieren, wie Manuk Manukyan auch. Das heißt, es war ungefähr 1939. Da fiel mir auf, das kann nicht in Deutschland spielen. Denn du kannst 1939 keinen libanesischen Studenten in Deutschland haben, historisch ist das vielleicht möglich, aber dann ist es ein völlig anderer Roman. Dann war klar, ich muss mit der Geschichte nach Übersee. Dann schwankte ich ein bisschen zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten, aber Kanada ist der deutlich interessantere und weniger erzählte Schauplatz. Auch das kanadische Kino spielt zu der Zeit eine Rolle, und es gibt auch viele libanesische Auswanderer, die 1915 schon nach Kanada ausgewandert sind. Es hat sich dann sehr schnell als genau der richtige Schauplatz ergeben.
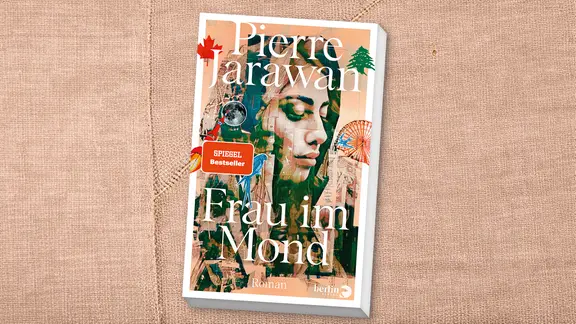
Pierre Jarawans Roman verwebt politische Themen, familiäre Prägungen und die Bedeutung von Identität spannend miteinander.
Warum haben Sie sich entschieden, die Geschichte aus der Perspektive der Enkeltochter Lilit zu erzählen? Sie hat noch eine Zwillingsschwester Lina. Aber Lilit ist diejenige, die uns als Leserinnen und Leser an die Hand nimmt und mit der wir zusammen in die Geschichte zurückgehen.
Jarawan: Mich interessiert diese Perspektive der „Ich-gehöre-der-zweiten-Generation-Einwanderern-an“ und Lilit der dritten Generation. Für die zweite Generation ist vor allem in den Jugendjahren, glaube ich, ganz typisch eine Identitätsfrage. Man fühlt sich ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Was ist jetzt die Heimat? Ist es das Land, in dem ich aufgewachsen bin, also Deutschland, oder ist das die Heimat der Eltern oder des Vaters? Ich höre das oft von türkischen Jugendlichen, die sagen: ‚In Deutschland bin ich immer der Türke, auch wenn ich hier geboren bin, aber in der Türkei bin ich immer der Deutsche.‘ Was mich an Lilit, also der dritten Generation interessiert hat, ist, für sie liegt der Libanon wirklich schon 100 Jahre zurück. Die Geschichte der Familie entfaltet sich ab 1920 mit der Ankunft des Großvaters als Baby in Montreal und der Libanon ist für sie überhaupt keine Heimat mehr. Das hat mich interessiert, wie sie sich diesem Land nähert, nicht mit einem Heimatgefühl, sondern sie reist nach Beirut, weil ihr Großvater davon erzählt hat. Er beginnt seine Lebensgeschichte auszuweiten, er selbst war Teil der „Lebanese Rocket Society“. Lilit erkennt in dieser Erzählung, dass es da noch mindestens eine weitere wichtige Hauptfigur gibt, ihre ihr unbekannte armenische Großmutter. Weil sie in sich selbst eine Art Dunkelheit und eine Verlorenheit spürt, vermutet sie, dass das vielleicht von ihrer Großmutter, die den Genozid als Kind überlebt hat, auf sie übergegangen sein könnte. Das ist ihr Grund für das Aufbrechen nach Beirut. Die Suche zu sich selbst und gar nicht so sehr nach etwas in diesem Land per se. Das hat mich interessiert, weil es auch für mein Erzählen neu war. Damit weiche ich sehr deutlich von den ersten beiden Romanen ab. Das hat Spaß gemacht, das so zu erkunden.
Das Gespräch führte Katja Weise. Einen Ausschnitt davon lesen Sie hier, das ganze Gespräch können Sie oben auf dieser Seite und in der ARD Audiothek hören.
Schlagwörter zu diesem Artikel
