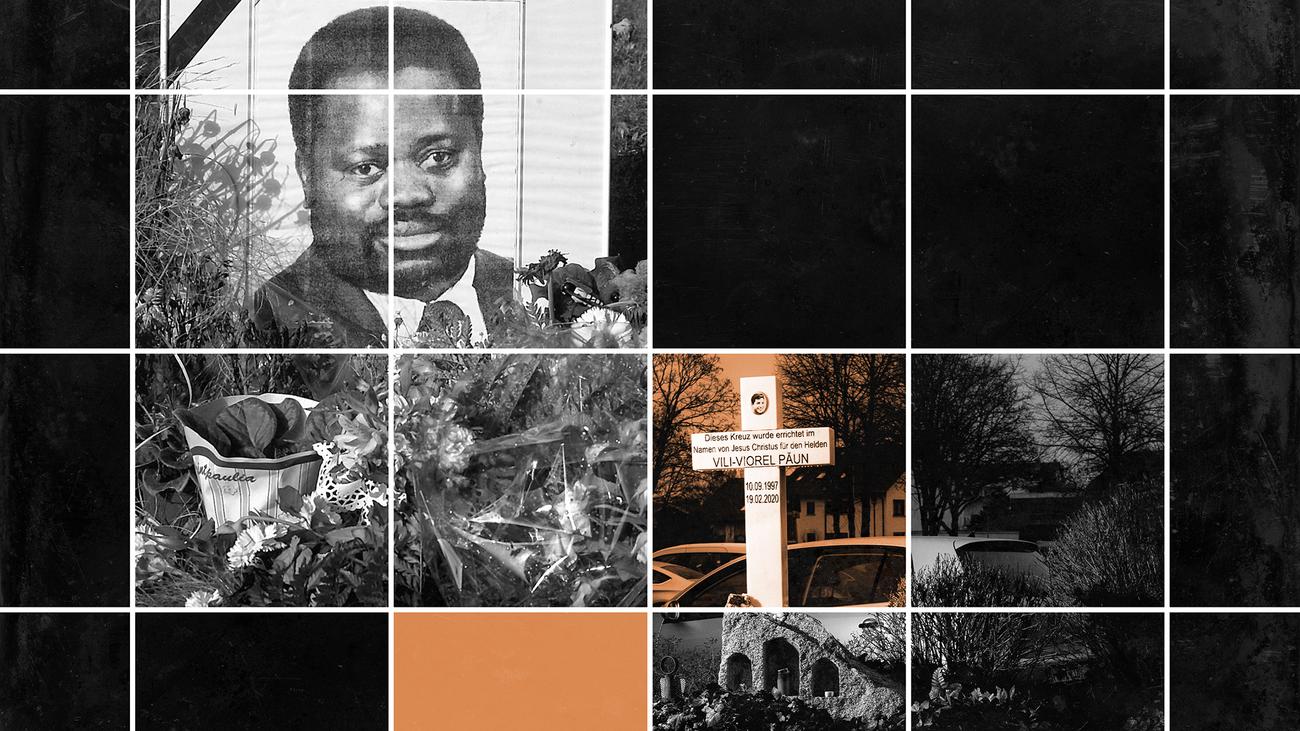Inhalt
Auf einer Seite lesen
Inhalt
-
Seite 1Wieso fehlen 86 Tote in den Zahlen?
Seite 2 Drohen sich die Baseballschlägerjahre zu wiederholen?
117 Menschen wurden in Deutschland seit der Wiedervereinigung 1990 von rechtsmotivierten Tätern getötet – so steht es jedenfalls in der Statistik der Behörden.
Aber eine Langzeitrecherche der ZEIT zeigt: Tatsächlich gab es mindestens 203 Todesopfer, 86 von ihnen fehlen also in den offiziellen Zahlen.
Zum Beispiel Mahdi Ben Nasr: Kurz vor Weihnachten 2023 wird der tunesische Geflüchtete erschossen, seine Leiche zerstückelt im Rhein versenkt. Er fehlt in der Behörden-Statistik.
Seit 25 Jahren recherchiert das ZEIT-Team zu Todesopfern rechtsmotivierter Gewalt. Besonders häufig treibt Rassismus die Täter.
Aber auch 26 tödliche Angriffe auf politische Gegner und 45 auf Wohnungslose und aus sozialdarwinistischen Motiven konnte die Recherche dokumentieren. Sie fehlen besonders oft in den offiziellen Statistiken.
Zum Beispiel Günter Schwannecke: Der wohnungslose Künstler wird im August 1992 in Berlin-Charlottenburg von einem Neonazi mit einem Baseballschläger angegriffen und stirbt Tage später. Erst 2018 wird die Tat offiziell anerkannt.
Ein neues Phänomen aus den vergangenen Jahren sind Fälle, bei denen die Täter rechten Verschwörungsideologien anhingen, etwa zur Coronapandemie. Zu den Opfern zählen auch vier Kinder.
Besonders viele Menschen starben in den 1990er-Jahren durch rechtsmotivierte Täter: mindestens 99. Oft ist von den „Baseballschlägerjahren“ die Rede.
In den 2000er-Jahren gab es 58 Tote – darunter zehn Menschen, die von der Terrorgruppe NSU erschossen wurden.
Seit 2010 kamen weitere 46 Menschen durch Täter von rechts ums Leben. Auch in jüngster Zeit gibt es noch Lücken in den offiziellen Statistiken. Wie kann das sein?
Das Team der ZEIT ist außerdem auf 74 weitere Fälle gestoßen, bei denen ein rechtes Motiv naheliegt, aber letzte Beweise bislang fehlen.
Die
Warnungen sind einhellig, und sie werden immer eindringlicher: In
Deutschland entstehe eine neue, gewalttätige Neonazi-Szene. So
mahnen Rechtsextremismus-Beobachtungsstellen und Veranstalter von
Pride-Paraden. So beobachteten es etliche
Medien,
die in den vergangenen Monaten über neue,
militante Jugendgruppen
berichteten, darunter
die ZEIT.
So sieht
es das Bundesamt für Verfassungsschutz,
das von einer Gefährdung „insbesondere für Angehörige der
LSBTIQ-Bewegung, linken Szene und Personen mit Migrationshintergrund“
spricht.
Dass
eine neue Welle rechtsextremer Gewalt droht, darauf deuten auch die
Statistiken hin: 2024 registrierten die Sicherheitsbehörden fast ein
Fünftel mehr Gewalttaten als
2023. In diesem Jahr reißen die Meldungen über Brandanschläge,
rassistische
und queerfeindliche
Angriffe und Überfälle
auf alternative Kultur- und Jugendzentren
nicht ab. Im Mai hob die Bundesanwaltschaft ein
Netzwerk 14- bis 18-jähriger mutmaßlicher Rechtsterroristen aus,
das sich „Letzte Verteidigungswelle“ nannte. Man stehe vor einer
„großen Herausforderung“, bekennt
der Präsident des Bundeskriminalamts,
Holger Münch.
Umso
wichtiger wäre es, dass der Staat ein genaues Bild von der Szene und
ihren Taten hat. Doch daran mangelt es.
Seit
inzwischen 25 Jahren dokumentiert eine Langzeitrecherche des ZEIT-Teams die Toten rechtsmotivierter Gewalt in Deutschland. Mindestens
203 Menschen
kamen seit der Wiedervereinigung durch derartige Taten ums Leben.
Doch die offizielle
Statistik
verzeichnet
lediglich 117 von ihnen – 86 Tote fehlen also.
Das Rechercheteam hat über Jahre Hunderte Interviews geführt, mit Hinterbliebenen und Nebenklagevertretern, mit Richtern und
Staatsanwältinnen, mit Zeugen und Opferberaterinnen. Das Team hat Gerichtsurteile und
Lokalzeitungsberichte ausgewertet, teils konnte es Einblick in
Ermittlungsakten nehmen. Gezählt wurden am Ende nur jene Fälle, die
sich eindeutig als politisch rechtsmotiviert einstufen ließen. Bei
weiteren 74 Fällen konnten letzte Zweifel nicht ausgeräumt werden,
dazu später.
Die
Recherche zeigt: Rechte Gewalttaten werden in der alltäglichen
Arbeit von Polizei und Justiz häufig immer noch nicht erkannt,
obwohl
die Erfassungsweise der sogenannten „Politisch motivierten
Kriminalität“ (PMK)
mehrfach reformiert wurde. Immer
noch wird nicht genau genug auf politische Motive geachtet, ist die
Vorstellung von rechter Kriminalität häufig veraltet, machen
interne Abläufe die Korrektur von Fehlentscheidungen schwer.
Da ist
zum Beispiel der Fall von Mahdi Ben Nasr: In der Nacht vor
Heiligabend 2023 trifft den 38-jährigen Geflüchteten aus Tunesien in
seiner Unterkunft ein Schuss in den Kopf, abgefeuert aus einer
illegalen Waffe.
Der Täter Patrick E. verbringt mit seiner Familie in der Nähe die
Weihnachtstage. Er zerstückelte die Leiche seines Opfers und
versenkt sie im Rhein. Die Polizei übersieht ein Projektil am
Tatort, ermittelt anfangs im Drogenmilieu. Erst Monate später werden
die sterblichen Überreste von Ben Nasr gefunden. Daraufhin stellt
sich Patrick E. den Behörden.
Mahdi Ben Nasr stammte aus einer Stadt bei Tunis, im Dezember 2023 wird er in seinem Zimmer im Südschwarzwald erschossen. © Privat
Die
Polizei findet im Wohnhaus des evangelikalen Christen 38
Schusswaffen, die E. als Hobbyjäger besaß, außerdem
NS-Devotionalien und rassistische Cartoons auf seinem Handy, dazu ein
Benutzerkonto im Webshop der AfD. An der Garage ist der Schriftzug
„Deutsches Schutzgebiet“ angebracht, über der Hundehütte
die Aufschrift „Wolfsschanze“. Patrick E. behauptet, er
habe sich bedroht gefühlt, weil Mahdi Ben Nasr von Allah gesprochen
habe und davon, dass er alle umbringen werde. Das Landgericht
Waldshut-Tiengen verurteilt E. wegen Totschlags und illegalen
Waffenbesitzes zu 6 Jahren und 10 Monaten Haft – Rassismus als
Tatmotiv spielte im Prozess jedoch keine Rolle. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Die offizielle Definition wird oft nicht angewandt
Das
Problem liegt weniger in der Theorie. Die Definition, die als
Grundlage der Erfassung dient, wird von einem Fachgremium der
Innenministerkonferenz regelmäßig aktualisiert,
zuletzt geschah das 2024. Sie umfasst alle einschlägigen Feindbilder
rechtsextremer Ideologien und wird auch von Wissenschaftlern gelobt.
Der komplexen Definition
zufolge gelten Delikte unter anderem dann als rechtsmotiviert,
„wenn
in Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des
Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie […] sich gegen die
freiheitlich-demokratische Grundordnung bzw. eines ihrer
Wesensmerkmale […] richten oder […] gegen eine Person wegen
ihrer/ihres zugeschriebenen oder tatsächlichen politischen Haltung,
Einstellung und/oder Engagements gerichtet sind bzw. unmittelbar
aufgrund von Vorurteilen des Täters bezogen auf Nationalität,
ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit,
Weltanschauung, sozialen Status, physische und/oder psychische
Behinderung oder Beeinträchtigung, Geschlecht/geschlechtliche
Identität, sexuelle Orientierung oder äußeres Erscheinungsbild
begangen werden“.
(kompletter Text in diesem
Dokument
des Bundeskriminalamts, PDF-Seite 5)
Bei
ihren Recherchen legt die ZEIT ebenfalls die offizielle Definition
zugrunde. Doch offenkundig wird sie in den 16 Bundesländern
unterschiedlich oder falsch angewendet. Taten gegen Wohnungslose zum
Beispiel fallen besonders häufig durchs behördliche Raster,
obwohl sie unter die Definition fallen („sozialer Status“).
Anscheinend entsprechen sie nicht der üblichen Vorstellung von
rechter Gewalt.
Aber
auch Staatsanwaltschaften und Gerichte sind ein Problem. Eigentlich
sollen sie laut Paragraf 46 Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuchs in
Ermittlungsverfahren und bei der Strafzumessung stets „die
Beweggründe und die Ziele des Täters“ berücksichtigen sowie „die
Gesinnung, die aus der Tat spricht“. Eine aktuelle
Studie aus Nordrhein-Westfalen
zeigt jedoch, dass sogenannte Vorurteilsmotivationen nur in rund
einem Fünftel der Urteile strafverschärfend berücksichtigt wurden. Ein Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesjustizministeriums, dessen Ergebnisse im September veröffentlicht werden sollen, empfiehlt unter anderem eine stärkere Schulung und „Sensibilisierung“ zum Thema innerhalb der Behörden, wie ein Ministeriumssprecher mitteilt.
Und
dann gibt es noch eine ganz praktische Schwierigkeit: Das Formular
über die Einstufung als „rechts motiviert“ für die offizielle
Statistik wird bei der Polizei schon ganz zu Beginn der Ermittlungen
ausgefüllt und weitergeleitet. Doch Motive stellen sich oft erst
später heraus.
Neue Tätertypen
Die
lückenhaften Zahlenwerke der Sicherheitsbehörden sind aus mehrerlei
Gründen problematisch. Zum einen beklagen Angehörige und
Hinterbliebene, es sei für sie ein Schlag ins Gesicht, wenn Taten
aus Hass gegen Minderheiten in der Öffentlichkeit als unpolitische
Kriminalität wahrgenommen werden. Zum anderen sind verlässliche
Statistiken essenziell für die Behörden. Denn sie bilden eine
wichtige Basis für Gefahrenanalysen und Lagebilder, auf deren
Grundlage dann Polizei und Justiz den Einsatz ihrer Kräfte planen
oder Innenpolitiker ihre Prioritäten setzen. Wird jedoch Gewalt von
Rechtsaußen systematisch unterschätzt, kann der Staat nicht
angemessen reagieren.
Die
Arbeit der Sicherheitsbehörden ist in den vergangenen Jahren
zweifellos komplizierter geworden. Etliche Täter treibt heute eine
diffuse Mischung aus Motiven. In einigen Fällen mischen sich zudem
psychische Erkrankungen mit rechten Ideologiefragmenten – manche
dieser Taten verzeichnen die offiziellen Statistiken, andere nicht.
Seit
mehr als einem Jahrzehnt gewinnt außerdem die Reichsbürger-Szene an
Zulauf, in der sich krude antisemitische Wahnvorstellungen mit
Demokratie- und Rechtsstaatsfeindlichkeit und rechtsextremen
Ansichten vermengen. Anfangs hatten Polizei und Justiz dieses Milieu
kaum auf dem Radar. Das hat sich 2016 geändert, als im bayerischen Georgensgmünd ein Reichsbürger einen SEK-Beamten erschoss. Doch
selbst wenn Taten aus diesem Milieu als politisch motiviert erkannt
werden, kreuzen die ermittelnden Beamten in ihren Erfassungsbögen
häufig nicht „PMK rechts“ an, sondern „Sonstige“.
Zudem
haben sich spätestens seit der Coronapandemie verschiedene, oft antisemitische Verschwörungsideologien ausgebreitet. Der
Politikwissenschaftler Gideon Botsch vom Moses-Mendelssohn-Zentrum an
der Universität Potsdam warnt: „Sie werden nicht einfach wieder
aus den Köpfen der Menschen verschwinden, die sie rezipiert haben.“
Wie
unterschiedlich Behörden mit Tötungsdelikten umgehen, bei denen
Verschwörungsideologien eine Rolle spielen, zeigen zwei Fälle, die
nur wenige Monate auseinanderliegen.
Alexander W. arbeitete im September 2021 an einer Tankstelle in Idar-Oberstein, sein Mörder will ein gewaltsames Zeichen gegen die Coronapolitik setzen, heißt es im Urteil. © Thomas Lohnes/Getty Images
Im Dezember 2021 tötet ein Lehrer im gemeinsamen Haus in Senzig seine Frau und seine drei Töchter, er hing antisemitischen Verschwörungsmythen zur Coronaimpfung an. © [M] Bernd Friedel/imago images
Im
Dezember 2021 tötet der Berufsschullehrer Devid R. im
brandenburgischen Senzig seine Ehefrau und die drei gemeinsamen
Töchter, vier, acht und zehn Jahre alt.
Er hatte sich in der Coronapandemie obsessiv mit Verschwörungmythen
beschäftigt, immer mehr Zeit in einschlägigen Kanälen auf dem
Messengerdienst Telegram verbracht. Ermittler finden später krude,
teils antisemitische Nachrichten zu einer vermeintlichen jüdischen
Weltherrschaft und einer drohenden „Halbierung der Menschheit“
durch Coronaimpfungen. Als ein gefälschtes Impfzertifikat
auffliegt, das R. für seine Frau besorgt hatte, fürchtet er
offenbar deren Entlassung,
Strafverfolgung, den Entzug der Kinder – und bringt alle um. Das
Landeskriminalamt hat die Tat als rechtsmotiviertes Delikt
eingestuft.
Ganz
anders in Rheinland-Pfalz: In Idar-Oberstein erschießt
im September 2021 ein 49-jähriger Mann den Tankstellenmitarbeiter
Alexander W.,
weil er ihn zum Einhalten der damals geltenden Maskenpflicht
auffordert. Der Täter hatte sich bereits Jahre zuvor rassistisch
geäußert und den Klimawandel geleugnet. Sein „Hass auf Politiker
und Andersdenkende verstärkte sich mit dem Beginn der
Corona-Pandemie“, stellt das Landgericht Bad Kreuznach später in
seinem Urteil fest. In Chats hatte der Täter geäußert, Politiker
müsse man in eine „Gaskammer“ stecken. Der 49-Jährige habe
Alexander W. als „Zeichen des gewaltsamen Widerstands gegen die
gesellschaftlichen und politischen Maßnahmen“ erschossen,
stellvertretend für die verantwortlichen Politiker, urteilen die
Richter. Das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt sortierte den
Mord in der PMK-Kategorie jedoch unter „Sonstige“ ein.