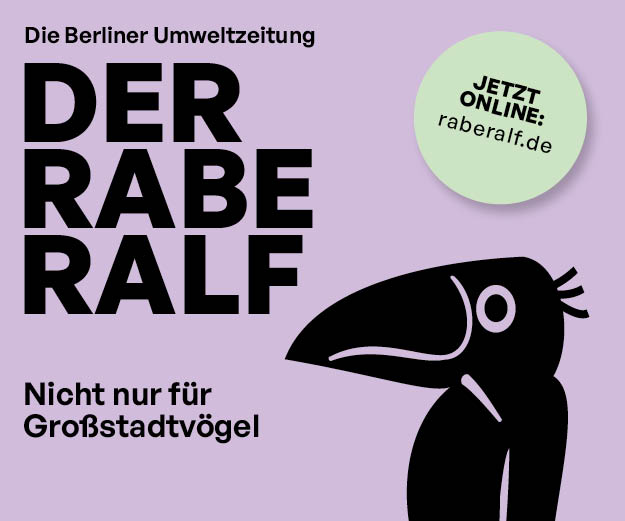Christopher Festersen im Gespräch mit anderen Fachleuten beim „Hafenratschlag“ der Stadt Münster. (Bild: Heiner Witte/Stadt Münster)
Klimareporter°: Herr Festersen, die Stadt Münster beschloss 2023 einen „Leitfaden Klimagerechte Bauleitplanung“. Das sorgte zunächst für eine Menge Aufregung. Einige Medien echauffierten sich über ein angeblich beschlossenes Verbot von Einfamilienhäusern. So eine Vorschrift stand sicher gar nicht zur Debatte?
Christopher Festersen: Dass Münster mit dem beschlossenen Leitfaden Einfamilienhäuser verbietet, war wirklich eine Legende. Dennoch hat das die Presse ziemlich lange beschäftigt.
Als Reaktion darauf stellten wir eine Liste mit Fragen und Antworten ins Netz, ein „FAQ Einfamilienhäuser“. Darin klärten wir als Planer auf, was wir unter einem Einfamilienhaus verstehen. Landläufig ist damit nur das frei stehende Eigenheim gemeint. Als Städteplaner befürworten wir aber vor allem gereihte und verdichtete Bauweisen, die trotzdem über einen individuellen Hauseingang je Wohnung verfügen.
Inzwischen hat sich die Aufregung über Münster gelegt. Aufgrund der älter werdenden Einwohnerschaft stehen in den nächsten Jahren ohnehin viele frei stehende Einfamilienhäuser zum Verkauf. Von einem Verbot, diese Häuser weiterhin zu nutzen, kann auch hier keine Rede sein.
Das Eigenheim im Grünen gilt noch immer als das Traumziel vieler Bürgerinnen und Bürger. Wie kann die Stadtplanung darauf reagieren?
Genau dazu hat sich die Stadt Münster den Leitfaden für eine klimagerechte Bauleitplanung gegeben. Er dient der Nachhaltigkeit, soll für einen schonenden Umgang mit dem wertvollen Boden sorgen sowie den Zwängen steigender Bodenpreise begegnen.
Ziel der Bauleitplanung ist es unter anderem, mit den Ressourcen sparsam und verantwortungsvoll umzugehen. Zu berücksichtigen ist dabei: Münster wächst von Jahr zu Jahr bei der Einwohnerzahl. 2024 haben wir erneut etwa 1.500 Einwohner und Einwohnerinnen dazugewonnen.
Wir fragen uns deswegen: Muss die Stadt schnell weiterwachsen oder vielleicht nur moderat? Lösen wir mit der Stadtplanung möglicherweise Prozesse aus, durch die Einwohner in die Nachbargemeinden abwandern, was dann Pkw-Pendelverkehr hervorruft? Über diese Fragen fand eine intensive fachliche Auseinandersetzung statt.
Wie kann man sich das konkret vorstellen?
2023 schrieb die zuständige Regionalplanungsbehörde Nordrhein-Westfalens den Regionalplan Münsterland fort. In ihrer Stellungnahme dazu bündelte die Stadt Münster Antworten auf entscheidende Zukunftsfragen: Wie viel Siedlungsraum müssen wir vorhalten, damit wir als Stadt noch Spielräume haben, Vorsorge betreiben können und nicht von Flächeneigentümern unter Druck gesetzt werden können?
Christopher Festersen
leitet seit 2018 das Stadtplanungsamt in Münster. Davor war er in Oldenburg stellvertretender Leiter des Planungsamtes und für den Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung verantwortlich. Festersen engagiert sich auch im Verein Münster Modell, einer Initiative von Stadt, Hochschulen, Architekturverbänden, Unternehmen und Einzelpersonen zur Förderung des baukulturellen Diskurses.
Schon lange beschäftigt sich Münster mit den Problemen von Versiegelung und Siedlungsentwicklung. Da geht es nicht nur ums Wohnen, sondern eben auch um die Verfügbarkeit von Siedlungs-Freiflächen sowie den Flächenbedarf für erneuerbare Energien. Auf diese Weise wollen wir die steigende Flächenkonkurrenz in den Griff bekommen.
All das mündete im „Integrierten Flächenkonzept Münster“. Das wurde im September 2024 vom Stadtrat beschlossen, parallel mit der erwähnten Stellungnahme zum Regionalplan.
Welchen Zweck verfolgt so ein Konzept?
Das integrierte Flächenkonzept ist, vereinfacht gesagt, ein „Flächennutzungsplan light“. Wir gehen für Münster zwar weiter von einem Wachstumsszenario für die Stadt aus, lenken aber die Richtung, wo dieses Wachstum stattfinden soll.
Münster hat sich dabei gegen den Bau neuer Stadtteile entschieden, also gegen neue „Satelliten“-Siedlungen am Stadtrand. Unser Ziel ist vielmehr, dass sich die wachsende Stadt an vorhandene Stadtteile gewissermaßen „anschmiegt“.
In Münster soll zum Beispiel dort neu gebaut werden, wo der öffentliche Nahverkehr schon Haltestellen hat oder diese nicht allzu weit von der Bebauung sind. Wir können es uns heute nicht mehr leisten, alles, was das moderne tägliche Leben erfordert, städtebaulich gänzlich neu zu schaffen.
Gibt es Erkenntnisse aus dieser Planung?
Für Münster haben wir keine pauschale Antwort. Die Stadt ist sowohl sehr urban als auch sehr ländlich. Für uns gilt: Je zentraler ein neues Baugebiet liegt, desto dichter kann es bebaut werden. Unser Ziel bleibt immer, sparsam mit der Fläche umzugehen.
In diesem Sinne haben wir 2023 und 2024 insgesamt vier städtebauliche Wettbewerbe durchgeführt. In den entsprechenden Ausschreibungen spiegelte sich der Geist der klimagerechten Bauleitplanung wider.
Steht also, statt „auf der grünen Wiese“ neu zu bauen, die Idee im Vordergrund, eine vorhandene Infrastruktur für die Stadtentwicklung zu nutzen und den Stadtraum so in gewisser Weise effizient zu verdichten?
So lässt sich das auf den Nenner bringen. Im Hintergrund spielt die Idee der 15-Minuten-Stadt mit, in der die Bedürfnisse des täglichen Lebens innerhalb eines Radius von 15 Minuten Wegstrecke zu erledigen sind. Nimmt man diese Idee ernst, muss man die städtebauliche Entwicklung darauf ausrichten.
Bei der Vergabe von Bauland orientiert sich die Stadt seit 2014 an ihrem Baulandbeschluss zur sozial gerechten Bodennutzung Münster, abgekürzt „SoBoMü“. Dieses Konzept wird seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert.
Es schreibt bei der Vergabe von Bauland zum Beispiel einen Mindestanteil geförderter Wohnungen vor. Das kann ich als Modell weiterempfehlen. Im Münster gilt auch die Beschlusslage, in städtebaulich bedeutsamen Lagen vorrangig, aber nicht ausschließlich Grundstücke in Erbbaurecht zu vergeben.
Weil Wohnen in Städten oft teurer ist, ziehen Familien ins Umland. Das kann zu verstärktem Bauen auf der grünen Wiese führen. Was lässt sich dagegen tun?
Das Problem haben wir bei der Erstellung des integrierten Flächenkonzepts mitdiskutiert. Zum Glück ist Münster Teil einer Stadtregion, in der die Stadt sowie die elf Umlandkommunen zusammen an diesem Thema arbeiten. Ziel ist, das Kirchturmdenken zu überwinden. Diese Art freiwillige Zusammenarbeit ist bundesweit noch selten, funktioniert bei uns aber seit einigen Jahren.
Von einer Kreislaufwirtschaft bei den Flächen sind wir aber noch ein gutes Stück entfernt. Zudem sind die Möglichkeiten der Konversion endlich, also der Nutzbarmachung „alter“ Flächen. Solange viele gesellschaftliche Entwicklungen auf weiteres Wachstum hinwirken, ist es enorm schwer, die Nullversiegelung zu erreichen. Allerdings gelingt es uns als Stadt, die Quote der Versiegelung zurückzufahren.
Anzeige