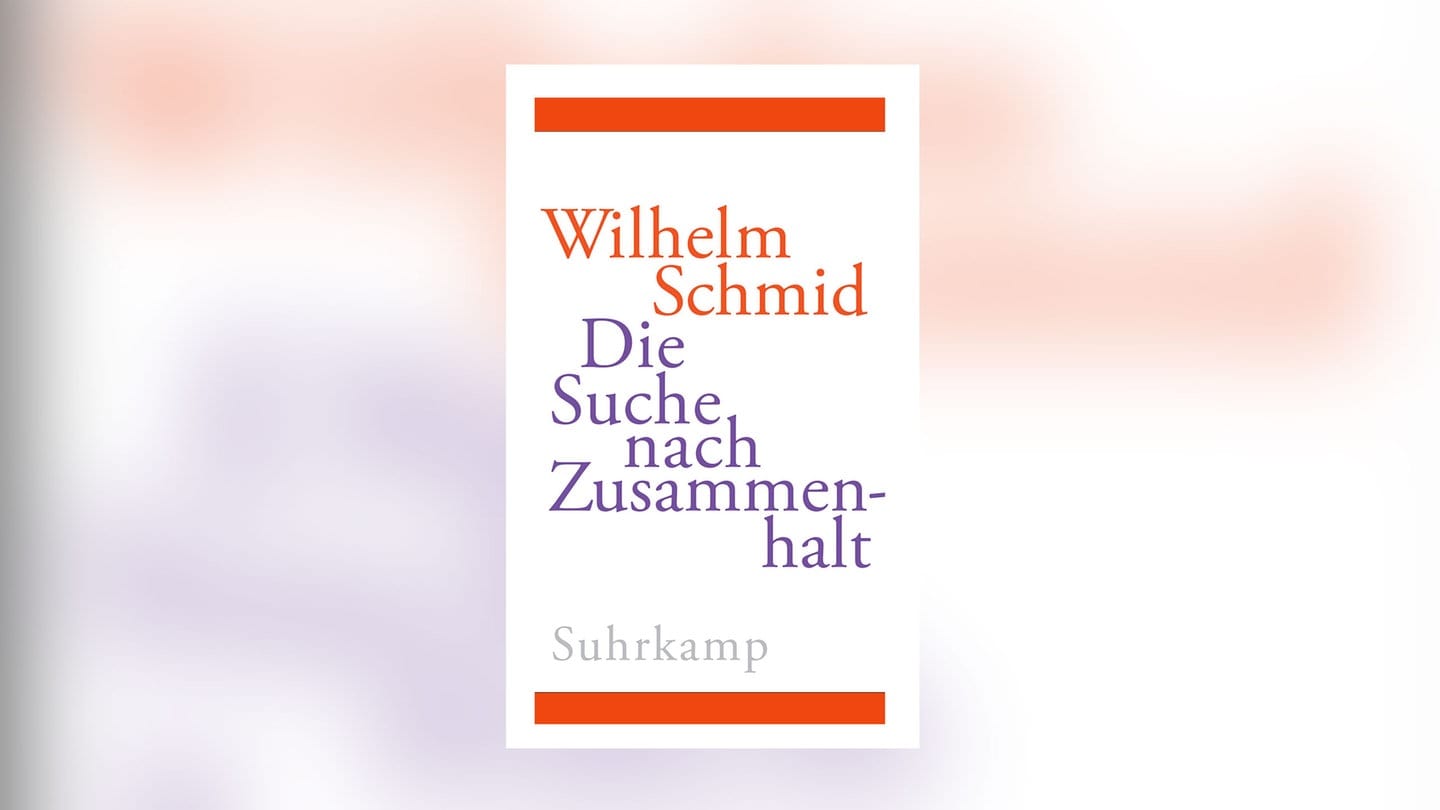In seinem Buch zeigt Wilhelm Schmid, dass Zusammenhalt weniger eine Folge staatlicher Maßnahmen ist, sondern dass es auf die Praktiken ankommt, mit denen Menschen füreinander da sind.
Als sich Anfang der 1980er Jahre nach den Ölpreiskrisen das dauerhafte Ende der hohen Wachstumsraten abzeichnete, entwickelte sich daraus auch eine gesellschaftliche Krise. Die Aussicht auf eine Wohlstandswelt für alle verringerte sich merklich. Arbeitslosigkeit wurde zum Dauerzustand. Und Margaret Thatcher läutete eine neue Ära der Eigenverantwortung ein.
War bis dahin mit dem gesellschaftlichen Fortschritt auch eine gemeinsame Perspektive verbunden, stellte sich nun zunehmend die Frage, was die Gesellschaft eigentlich zusammenhält, wenn sich jeder vor allem um sich selbst kümmert. Seitdem hat die Debatte darüber, wieviel Gemeinschaft eine Gesellschaft braucht, nichts an Aktualität eingebüßt.
Die Praktiken des Zusammenhalts
In seinem Buch „Die Suche nach Zusammenhalt“ hat der Philosoph Wilhelm Schmid nun versucht, das Thema aus der gängigen Sichtweise einer Konkurrenz zwischen dem Ich und dem Wir herauszulösen. Sein Vorschlag lautet, den Zusammenhalt nicht in der großen Politik zu suchen, sondern die alltäglichen Praktiken des Füreinanderdaseins in den Blick zu nehmen:
Ein Ich muss bereit sein und die Kraft dafür haben, Anderen zur Seite zu stehen. Die Wahrscheinlichkeit für die Bereitschaft dazu oder gar die Freude daran wird größer, wenn es mit sich selbst gut zurechtkommt. Wer sich auf den Umgang mit sich versteht, kann sich auch eher Anderen zuwenden.
Die Gesellschaft der Sorge
Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die neue Aufmerksamkeit für die Sorgearbeit, die heute viel weiter gefasst wird als traditionell üblich. Ursprünglich als Fürsorge im familiären Bereich verstanden, die vor allem von Frauen unentgeltlich und hingebungsvoll zu leisten war, lässt sich die Sorgearbeit inzwischen in fast allen Lebensbereichen auffinden.
Das gegenwärtige Spektrum reicht von der Sorge um sich selbst bis zur Sorge um andere oder auch um die Natur. Man kann sich um sein Seelenheil kümmern oder um das Gemeinwohl oder den Erhalt der natürlichen Umwelt. Wo etwas zum Gegenstand einer Pflege wird, wird auch Sorgearbeit geleistet, wie Schmid am Beispiel der Kultur ausführt:
Das Carework der Kultur ist eine Arbeit am Gemeinwohl, […]. Nicht nur äußerliche, körperliche und materielle Faktoren tragen dazu bei, sondern auch innerliche, seelische und geistige, sei es als Fürsorge für aktuelle Bedürfnisse, als Vorsorge in Form von frühzeitiger Aufmerksamkeit auf problematische Entwicklungen oder als Nachsorge im Sinne einer ‚Reparatur‘ und Heilung des Lebens.
Die kuratierte Gesellschaft
Nicht nur die Kultur, auch viele andere Aktivitäten von der Bildung bis zum Sport lassen sich so als Sorgearbeit auffassen, die zugleich auf das Ich und das Wir abzielt. Und selbstverständlich gehört für Schmid, der in zahlreichen Büchern das antike Ideal einer Lebenskunst für unsere Gegenwart wiederentdeckt hat, auch die Philosophie dazu.
Die Suche nach Zusammenhalt
Ich und Wir: Vom schönen und schwierigen Leben in Gesellschaft
![]()
Wilhelm Schmid – Die Suche nach Zusammenhalt
Dass das Bedürfnis nach einem sorgsamen Umgang mit sich selbst und anderen groß ist, hat inzwischen allerdings auch das Marketing verstanden. Heute werden nicht nur Ausstellungen in Museen kuratiert, sondern die gesamte Konsumwelt ist zu einem großen Showroom geworden, in dem die Dinge mit besonderer Sorgsamkeit präsentiert werden:
Dass das Kuratieren von der Kunst auf andere Bereiche übergreift, könnte ein Zeichen dafür sein, dass Menschen in wachsendem Maße bereit sind, nicht nur für sich, sondern auch über sich hinaus Sorgende sein zu wollen, die sich für das, was sie tun, verantwortlich fühlen.
Auch wenn diese optimistische Einschätzung des Autors nicht jeder teilen wird, lohnt es sich sehr, seiner Suche nach Zusammenhalt mit ihren überraschenden Wendungen zu folgen. Sein Buch kommt zur richtigen Zeit. Angesichts der politischen Lage dürfte inzwischen den meisten deutlich vor Augen stehen, wie zerbrechlich unsere Gesellschaft geworden ist.