Die im Friedrich-Jubiläumsjahr 2024 geweckte Neugier auf den epochalen Künstler kann mit der von den drei Romantik-Forschern Johannes Grave, Petra Kuhlmann-Hodick und Johannes Rößler besorgten Neuedition „Sämtliche Briefe und Schriften“ gestillt werden. Alle Fragen zu Friedrichs Kunsttheorie und Philosophie hinter den Bildern, die in den zahllosen Ausstellungen nur angerissen werden konnten, erschließen sich durch das Borges-hafte Mosaik eines Lebens in Briefen.
Zugegeben, die Veröffentlichung von Tagebüchern dient nicht selten als Futter für den Voyeurismus. Instinktiv regen sich Bedenken gegenüber einem möglicherweise zu intimen Eintauchen in das Privatleben Friedrichs. Aber wie sollte man sonst bei einem Künstler, der außerhalb der Briefe so gut wie nichts über Erläuterungen seiner Bilder hinterlassen hat, Fehldeutungen und Überinterpretationen vermeiden, zumal bei einem Maler, der dem eigenen Anspruch zufolge stets „innere Bilder“ anstelle von Äußerlichkeiten in Farbe zu bannen versuchte. Derartig gefühlte Bilder lassen sich nun einmal nahezu ausschließlich aus Äußerungen von Innerlichkeit im Schutzraum des Briefs an Angehörige und enge Freunde destillieren.
Details über die Produktion der Bilder
Die Aufzeichnungen sind so offenherzig wie aufschlussreich. An seine Frau Caroline (ein weiteres wesentliches Verdienst der Edition: die bisherige Transkription der Ansprache seiner Ehefrau als „Liene“ wird endlich auf „Liena“ revidiert, weil sich die liebgewonnene, aber falsche alte Schreibweise de facto nirgendwo in den Briefen finden ließ) schreibt er auch über Stoffe, wie ihm der (Ostsee-)Schnabel, der durchgängig „jenial“ für „genial“ nutzt, gewachsen ist:
Der seidendurchwirkte Stoff „Gros de Naples“ als letzter Schrei des Jahres 1822 wird ihm dem Hörensagen nach zu „Grodtenabel“, was manche irrige Deutung als Naturmetapher „Grottennebel“ in Bezug auf sein in dem Brief erwähntes Bild der „Gescheiterten Hoffnung“ evozierte. Derartige, oft erstmals überhaupt vorgenommene Richtigstellungen waren allein die immense Arbeit wert, die in dem Band steckt – wirklich jeder Begriff und jeder Schritt Friedrichs an den jeweiligen Tagesdaten wird aufgeführt.
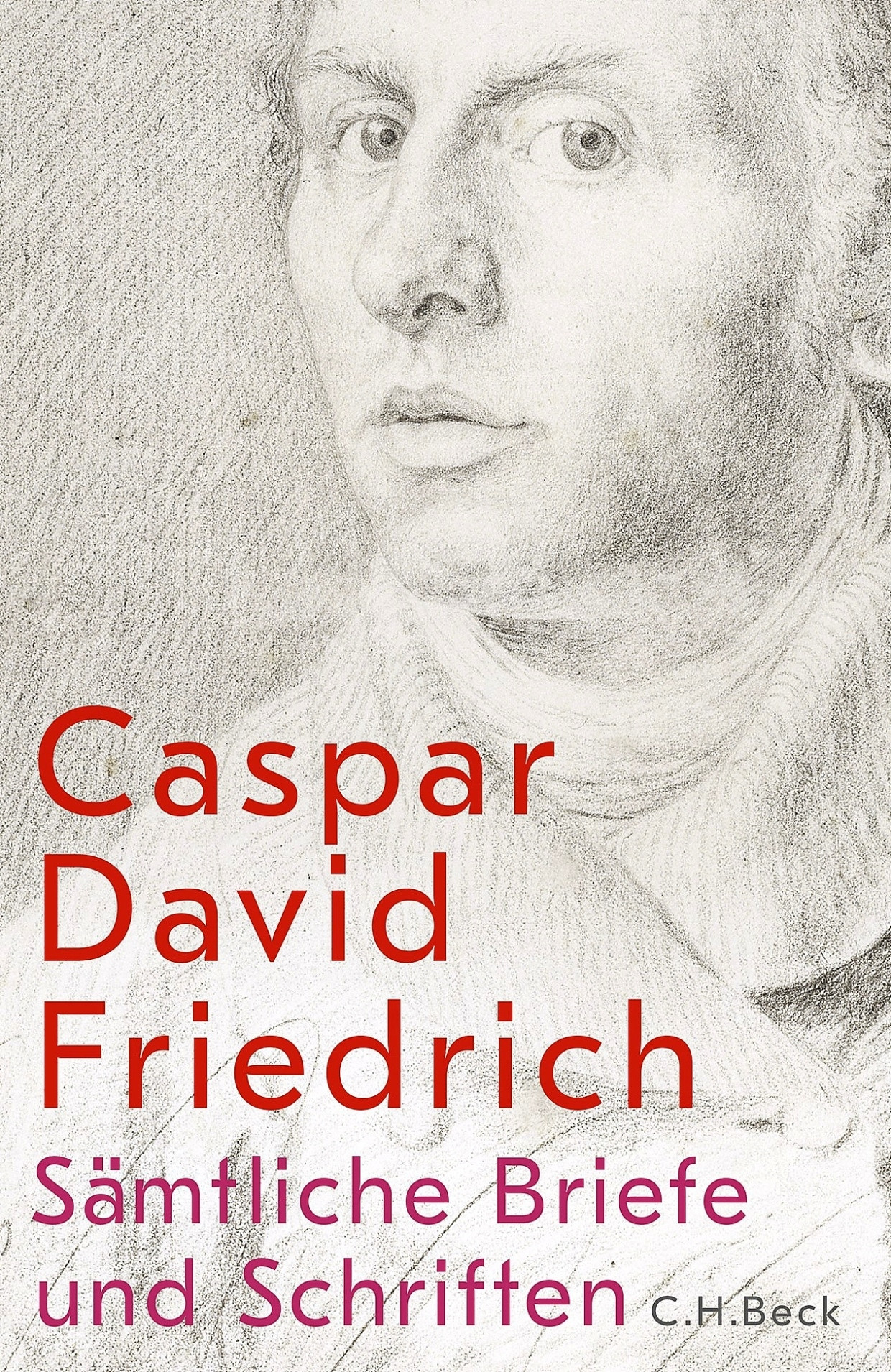 Caspar David Friedrich: „Sämtliche Briefe und Schriften“. Herausgegeben von J. Grave, P. Kuhlmann-Hodick und J. Rößler.C.H. Beck
Caspar David Friedrich: „Sämtliche Briefe und Schriften“. Herausgegeben von J. Grave, P. Kuhlmann-Hodick und J. Rößler.C.H. Beck
Doch erfährt der Leser eben auch zahlreiche Details über die Produktion der Bilder wie auch für den Künstler existenzielle Fragen des Transports etwa nach Russland zu seinem Mäzen Wassili Schukowski, der sich über das Ausbleiben der Gemälde beklagt hatte, woraufhin ihn der Maler wortreich in mehreren Briefen und mit Zeichnungen vertröstete.
Wie prekär die ökonomische Lage Friedrichs nach seinem Schlaganfall in den letzten Lebensjahren tatsächlich war, zeigen die berührenden Schilderungen seiner Situation sehr deutlich: „Bei meinen vorgerückten Jahren wo die Abnahme meiner Kräfte immer fühlbarer werden, und die Tähtigkeit immer minder und Bedürftniß immer mehr, da stellen sich nathürlich die Nahrungssorgen immer häufiger ein.“ So der Brief vom 19. November 1835 an den „Hochwohlgeborenen Herrn Staatsrath“.
„Wie willenlos ist alles“
Sorgfältig baut Friedrich raum- und kostensparende Transportkisten für seine Kunst, bei denen der Boden zugleich das mit Wachsleinwand geschützte Bild ist, und gibt präzise Anweisung, wie das Gemälde nach Ankunft noch mit Mastix zu firnissen sei. Ohnehin ist man erstaunt, wie er für den Bruder Christian eine komplette Innenausstattung für einen Kaufmannsladen in Greifswald entwirft und in der Zeichnung zentimetergenau skizziert (Brief vom 22. September 1821).
Auch den Aufbau seiner hinterleuchteten Transparentbilder zu einer Art avantgardistischer Dia-Schau, auf deren transluzent-magische Wirkung er spürbar stolz war, gerät Friedrich zur schulischen Vorgangsbeschreibung: „Wenn man zuerst den Schieber F. eröffnet hat, und den Deckel X loßgeschraubt und die nicht angestrichenen Leisten aus der Kiste genommen, wird man bald sehen, wie die Bilder aus der Kiste zu heben sind. Die größt von den beiden kleinen Kisten enthält zwei Glaßkugeln, die kleinere eine Lampe und einen Klotz.“ Beigegeben sind der Gebrauchsanweisung Zeichnungen der zu installierenden Lampe und eines Klotzes.
Nichts bleibt bei ihm je dem Zufall überlassen, den er hasst. Heißt es doch in seinen scharfen Kurzgutachten über die Bilder einer Sammlung etwa: „Wie willenlos ist alles, alles ist dem Zufall überlassen. Wenn der hohe Berg so im Nebel liegt, wie kann dann in der Niederung alles so klar erscheinen?“ (Bogen XXII).
Aufschlussreich sind auch seine Äußerungen gegenüber dem Malerfreund und Arzt Carl Gustav Carus, der in der Natur einen einzigen großen Gesamtorganismus sah – was Friedrichs christlichem Weltbild zuwiderläuft. Was aber lässt sich Neues über die Deutung der Bilder aus den Schriften und Briefen entnehmen?
Die im Brief an die Herzensfreundin Louise Seidler gegebene Erklärung seines wohl symbolistischsten Bildes „Kreuz auf Rügen“, auf dem lediglich das roh gezimmerte Marterholz an dunklem Meeresgestade aufragt, ein Anker der Hoffnung davor liegt und die dritte christliche Tugend „Caritas“-Liebe seltsam fehlt, kann hier pars pro toto stehen: „Das Bild für Ihre Freundin bestimmt ist bereits angelegt, aber es kommt keine Kirche darauf, kein Baum, keine Pflanze, kein Graßhalm. Am nackten steinigen Meeresstrande steht hoch aufgerichtet das Kreutz, denen so es suchn ein Trost, denen so es nicht suchn ein Kreutz.“ Wer sich durch den verdienstvollen Band in den Friedrich-Sound eingelesen hat, findet in den wenigen Zeilen alles zum Verständnis von dessen inneren Bilder.
Caspar David Friedrich: „Sämtliche Briefe und Schriften“. Herausgegeben von J. Grave, P. Kuhlmann-Hodick und J. Rößler. C.H. Beck Verlag, München 2024. 821 S., Abb., geb., 78,– €.
