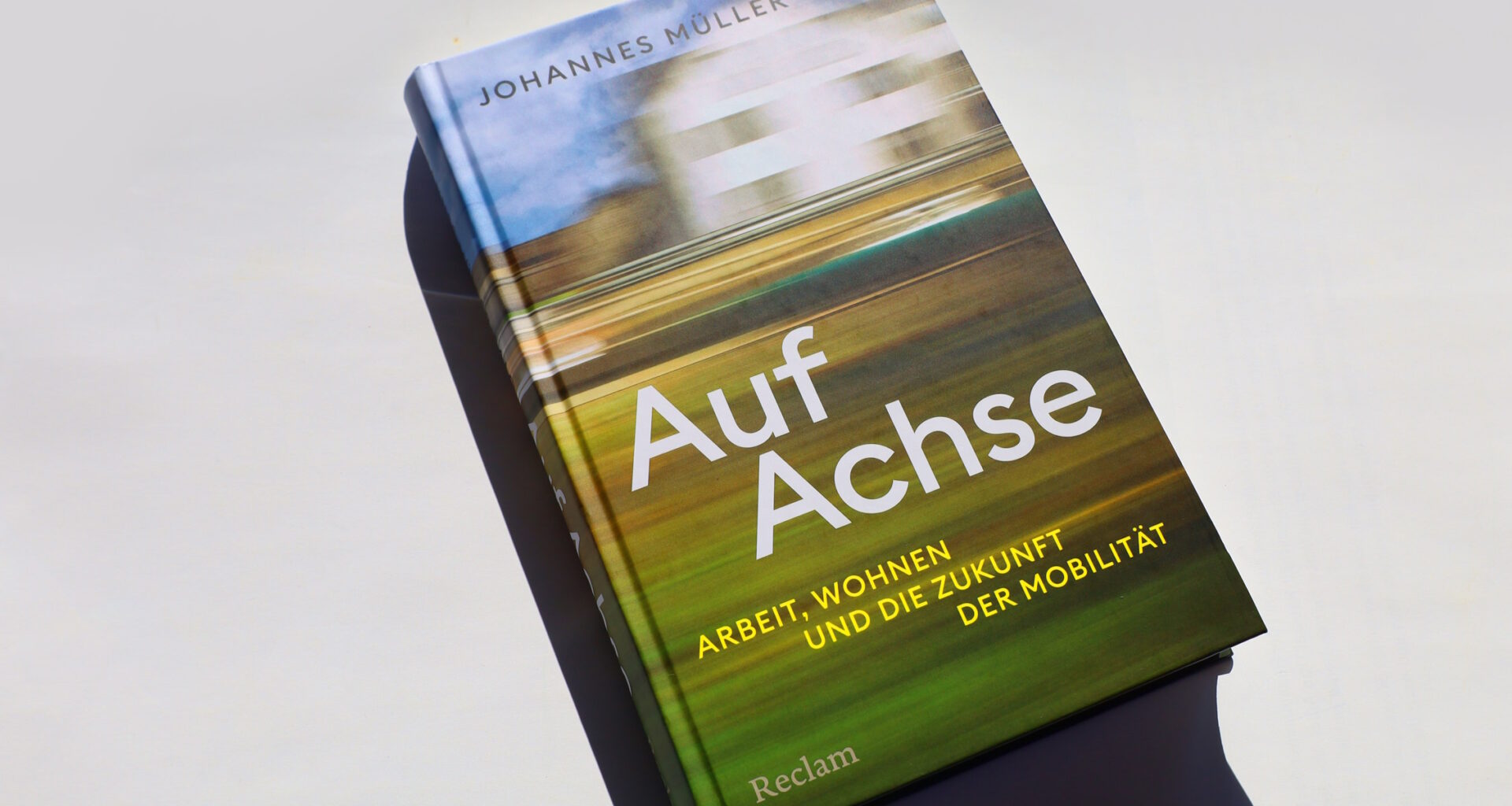Dass unsere Städte so aussehen, wie sie aussehen, hat eine lange Vorgeschichte. Und natürlich Folgen, die auch in Leipzig regelmäßig in heftige Debatten ausarten, wenn es um die Umverteilung von Verkehrsraum zugunsten schwächerer Verkehrsteilnehmer geht. Oh nein, schallt es dann aus allen Autos: Die nehmen uns die Straße weg! Klingt ein bisschen übertrieben. Ist aber immer so gemeint. Der Mensch hat extreme Verlustgefühle, wenn er auf alte Gewohnheiten verzichten soll. Aber es geht nicht nur um Gewohnheiten. Sondern auch um Status, Macht und Zwang.
Aber wie das wirklich funktioniert, erfährt man nicht in Stadtratsdebatten. Dafür muss man sich – wie es der Philosoph Johannes Müller-Salo in diesem Buch tut – mit der Entstehung unserer modernen Städte beschäftigen. Man kann sich auch mit den Städten des Mittelalters beschäftigen und wird dort garantiert auch auf die Rolle der Mobilität als Statusmerkmal und Symbol der Freiheit stoßen.
Eine Freiheit, die aufs engste mit dem Rang in der Gesellschaft, dem Arbeitsfeld und dem Geld zu tun hat, da einer zur Verfügung hat. Stellenweise geht Müller-Salo auf einige der Frühformen von Mobilität ein. Auch weil sie deutlich machen, warum sich die Städte Europas ab dem 19. Jahrhundert so dramatisch verändert haben.
Raus aus der Stadt …
Alles begann mit der Trennung von Wohnen und Arbeit. Eine Entwicklung, die tatsächlich erst im 19. Jahrhundert begann, als die großen Fabriken entstanden und die Menschen begannen, zu Millionen in die frühen Fabrikstädte abzuwandern. Städte, in denen es bald rußte und qualmte und eigentlich nicht mehr heimelig war. Und so kann Müller-Salo anhand vieler Befunde aus den großen Städten Europas – insbesondere London und Paris – schildern, wie es zuallererst die gut Betuchten waren, die aus der Stadt flohen und ihre Villen in grünen Vororten mit frischer Luft bauten.
Er hätte auch Leipzig nehmen können. Hier ist dasselbe passiert. Aus der „dirty old town“ konnte aber nur wegziehen, wer es sich leisten konnte, am anderen Tag wieder an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Also zu pendeln. Die Kutsche war dazu das erste Vehikel, bevor überhaupt Omnibusse und Straßenbahnen erfunden wurden, die anfangs überhaupt nicht für die Habenichtse gedacht waren.
Von Anfang an bedeutete Mobilität Prestige.
Noch waren die meisten Städte klein genug, dass die Malocher ihren Weg von der armseligen Herberge zu ihrem dreckigen Arbeitsplatz zu Fuß zurücklegen konnten. Die Reichen und Betuchten fuhren mit der Kutsche und zeigten schon durch das Vorfahren mit Pferden und Kutscher, dass sie einer anderen Klasse angehörten.
Aber dabei blieb es nicht. Denn was die Reichen vorgemacht hatten, wurde bald auch zum Vorbild für die Mittelklasse der Angestellten, die sich zwar keine Villa leisten konnten, aber eine eigene Schuhschachtel zum Wohnen in einem extra hochgezogenen Ortsteil vor der Stadt. Wert pendelte, zeigte, dass er es sich leisten konnte. Ansporn für die Reichen, noch weiter rauszuziehen. Es waren die Reichen und Gutverdienenden, die zuerst wirklich Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort brachten. Und damit etwas „erfanden“, was heute die Verkehrsplaner zur Weißglut bringt: das Pendeln.
Eine verhängnisvolle Charta
Denn damit hatten sie einen Prozess angestoßen, der sich im Lauf der nächsten Jahrzehnte immer weiter verschärfte. Mit einem Höhepunkt im Jahr 1933, als Architekten und Städteplaner in Athen die Charta von Athen formulierten, die etwas zur Grundlage der Stadtplanung machte, das die modernen Städte regelrecht verwüstete, die „funktionale Trennung von bebauten Quartieren nach Wohnungen (…) Büros, Einkaufsmöglichkeiten, Gewerbe und Industrie, sowie die ‘autogerechte Stadt’“, um an dieser Stelle Wikipedia zu zitieren.
Erst dieses radikale Ausdifferenzieren von Städten sorgte dafür, dass die Stadtbewohner gezwungen waren, zum Erledigen der selbstverständlichsten Dinge mobil zu sein. Pendeln wurde zur Massenerscheinung. Und ist es bis heute geblieben. Mit all den Zuschreibungen, denen die Mobilität auch schon im 19. Jahrhundert unterlag – vom Status und Prestige bis hin zu zutiefst menschlichen Fragen wie Identität und Anerkennung.
Und Müller-Salo wird sehr deutlich, wenn er Stück für Stück analysiert, wie die heutigen Strukturen unserer Städte genau diese Dinge definieren. Wir leben in einer „institutionalisierten und gebauten Ordnung, die auf die Anerkennung einer spezifischen Pendelform und, damit verbunden, auf die Auszeichnung bestimmter Lebens- und Arbeitsformen hin angelegt ist“.
Sie „enthält immer auch Urteile über abweichende Formen des Pendelns, des Wohnens und Tätigseins.“ Dazu brauchte es gar nicht erst das Auto, auch wenn dessen Siegeszug genau mit diesen Formen der Anerkennung zu tun hat. Motto: Sage mir, womit du pendelst, und ich sage dir, was du bist.
Prestigeobjekt Auto
Es geht im täglichen Gerangel im Berufsverkehr auch um diese ganz elementaren Fragen. Nur denkt kaum noch jemand darüber nach. Wir haben das verinnerlicht, dass fehlende Mobilität auch ein Grund für Abwertung ist. Auch für gesellschaftliche Ignoranz: Wer sich Mobilität nicht leisten kann, ist raus. Spielt gesellschaftlich keine Rolle. Denn mit dem Pendeln ist auch gesellschaftliches Prestige verbunden.
Pendelpolitik ist Anerkennungspolitik, stellt Müller-Salo fest. Und kann dazu auch all die Milliarden-Summen benennen, mit denen heute das Pendelverhalten der als „gesellschaftlich wertvoll“ betrachteten Personen subventioniert wird. „Pendelpolitik richtet sich nach denen, die als Leistungsträger gelten. Und wenn es sich für Leistungsträger gehört, am Morgen mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, bleibt keine Wertschätzung für diejenigen übrig, die spätabends oder in der Nacht mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren müssen.“
Die Geringschätzung von Menschen, die nicht zu den Gutbezahlten im Herzen der City gehören, spricht sich in Fahrplänen aus, in fehlenden Bus- und Zugverbindungen. Auch in Parkgebühren, wie Müller-Salo feststellen kann, in ausgebauten Straßeninfrastrukturen sowieso, die in den vergangene Jahrzehnten allesamt vor allem für eine Mobilitätsform ausgebaut wurden – den Pkw.
Dabei war im 19. Jahrhundert sogar das Fahrrad schon auf dem Vormarsch zum Fortbewegungsmittel Nr. 1, wenn es um das Pendeln ging. Doch es war nicht das Fahrrad, das in den Straßenverkehrsordnungen und den Verkehrsplanungen des 20. Jahrhunderts den Vorrang bekam, sondern das Auto. Es war Politik, die bestimmte, welche Verkehrsmittel den Löwenanteil am Verkehrsraum und bei den Verkehrsinvestitionen bekamen. Und welche nicht.
Blind für die Kosten
Da stecken wir mittendrin. Vielen Leuten ist überhaupt nicht bewusst, dass wir in eine fürs Auto umgebauten Stadt leben. Und dass die Benachteiligung anderer Verkehrsarten System hat. „Die Erfolgsgeschichte des Autos beruht entsprechend auch auf dessen systematischer Bevorzugung gegenüber allen konkurrierenden Verkehrsmitteln, wobei vor allem die drei Dimensionen Recht, Geld und Infrastruktur zu betrachten sind“, schreibt Müller-Salo.
Dem als Philosoph nur zu bewusst ist, wie diese gewollten Strukturen auch unser Denken über Mobilität, Status und Anerkennung prägen. Und es macht uns blind für die externen Kosten, die der – noch heute größtenteils von fossilen Brennstoffen getriebene – Autoverkehr verursacht. Leser des Buches dürfen sich freuen über die vielen Seiten, die Müller-Salo zum Thema Mobilität aufblättert. Und die in den üblichen Diskussionen meist keine Rolle spielen, weil sie uns gar nicht (mehr) bewusst sind.
Das geht bis zum Kostendeckungsgrad der verschiedenen Verkehrsmittel. Was wir ja eigentlich längst wissen: Der ÖPNV in all seinen Formen hat einen viel höheren Kostendeckungsgrad als der Pkw-Verkehr. Er nimmt – gemessen an den transportierten Fahrgästen, viel weniger Raum in Anspruch, ist viel demokratischer und er schafft etwas, was Autos gar nicht können: Räume der Begegnung.
Wer mit dem ÖPNV reist, begegnet zwangsläufig verschiedensten Menschen. Fremden Menschen. Wer mit Bus und Bahn unterwegs ist, lernt ganz automatisch Dinge wie Rücksichtnahme, Respekt, Akzeptanz, den friedlichen Umgang mit Fremden. Denn hier kann man sich nicht ausweichen. Hier muss man Regeln des Miteinanders beachten, damit es nicht zu Konflikten kommt. Hier lernt man, wie wohltuend es ist, wenn Andere sich genauso rücksichtsvoll benehmen wie man selbst.
Etwas, was scheinbar in unserer Gesellschaft immer seltener geworden ist. Aber was sich gerade in den Verkehrsdebatten auch im Leipziger Stadtrat immer wieder zeigt: Wenn es um das Auto mit seinem Prestige- und Statusdenken geht, dominiert das gekränkte Ego. Dann wird das Aushandeln von Verkehrskompromissen immer zu einem Wir gegen Die. Dann wird – bildlich gesprochen – gehupt und gedrängelt. Ohne dass auch nur ein Gedanke daran verschwendet wird, dass die autogerecht umgebaute Stadt von Anfang an eine Entscheidung aus Macht und Einfluss war.
Gentrifizierung und Verdrängung
Es waren Entscheidungen, die gleichzeitig Vorstellungen von separierten Lebensräumen verinnerlicht haben, die unsere Städte regelrecht entkernt haben. Aber Stadt könnte anders sein. Da ist sich auch Müller-Salo sicher. Denn die Notwendigkeiten, die vor 150 Jahren dazu geführt haben, dass die Stadt in ihren Funktionen regelrecht auseinandergerissen wurde, gibt es so nicht mehr.
Die Bausubstanz der alten Innenstädte kann ihre Schönheit wieder entfalten. Was auf einmal den Effekt hat, dass die Gutverdiener wieder zurückziehen in die Stadt, sich die schönsten Viertel aussuchen und damit einen Prozess auslösen, den man inzwischen Gentrifizierung nennt. Die Mieten steigen. Wer sich die Miete nicht mehr leisten kann, wird verdrängt.
Mit dem Ergebnis, dass es nicht mehr die Gutverdiener sind, die täglich pendeln müssen, sondern die Geringverdiener, die auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum an den Rand der Stadt abgedrängt werden. Es ist wie gehabt: Pendeln erzählt von Status und Anerkennung. Und von Identität, was Müller-Salo gar nicht oft genug betonen kann.
Denn wo die ursprünglichen Räume, wo Menschen einander jeden Tag begegnen konnten, verschwunden sind, wird das Pendeln zum Ort, an dem man sieht und gesehen wird. Hier erfährt man, welchen Platz man in der Gesellschaft einnimmt. Und wie viel oder wie wenig Wertschätzung dieser Platz im Gefüge bekommt.
Oder mit den Worten Müller-Salos: „Was im täglichen Berufsverkehr gilt, beschreibt zugleich die demokratische Grundsituation. In der demokratischen Gesellschaft begegnen wir uns als Fremde in einem Raum, in dem bestimmte Regeln gelten, die sowohl interpretations- als auch durchsetzungsbedürftig sind.“
Nur ist in der Regel kein Aufpasser da, der dafür sorgt, dass sich alle an diese Regeln halten. Das tun wir nämlich selbst. Freiwillig. Weil nirgendwo so deutlich die Naturgesetzformel gilt, wie sie Immanuel Kant formuliert hat: „… handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollt.“
Die Gesellschaft im ÖPNV
Hier wird erlebbar, wie eine Gesellschaft funktioniert. Und da geht es sowohl um Demokratie als auch um Anerkennung. Erstaunlich, dass man das erst formulieren muss. Aber ganz offensichtlich haben das auch viele gewählte Politiker nicht begriffen, nie gelernt, wel sie nie Rücksicht auf Andere nehmen mussten. Müller-Salo: „Die Achtung grundlegender Regeln des Miteinanders ist dabei auch für die Anerkennung des Einzelnen zentral. Indem sich signifikante andere mir gegenüber an allgemeine Regeln halten, erkennen sie mich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft an.“
Logisch, dass Müller-Salo für einen völlig anderen Umgang mit städtischen Räumen plädiert, für eine Stadt, die wieder Kommunikations- und Begegnungsräume eröffnet. Und damit auch für eine Verkehrspolitik, die den Menschen wieder Respekt und Anerkennung gibt – gerade dann, wenn sie scheinbar nur „schwache“ Verkehrsteilnehmer sind und auf verlässliche Regeln angewiesen sind, die ihnen das Überleben in der Stadt ermöglichen.
Für alle, die sich in den aktuellen Mobilitätsdiskussionen immer noch fremd fühlen, ist Müller-Salos Essay im Grunde eine Türöffner – nicht nur zum Verständnis unserer auseinanderdividierten Städte mit ihrer erstarrten Verkehrspolitik, die das Recht auf der Straße nach den PS der stärker Motorisierten definiert.
Aber man erfährt eben auch, dass Mobilitätspolitik aufs engste verzahnt ist mit Wohnungspolitik, mit Identität und Respekt. Beziehungsweise fehlendem Respekt, den viele Menschen nicht mehr bekommen, weil ihre Arbeit, ihre Mobilität, ihr Pendlerweg in den Sonntagsreden der Politiker keine Rolle spielen.
Johannes Müller-Salo „Auf Achse“ Reclam, Ditzingen 2025, 26 Euro.