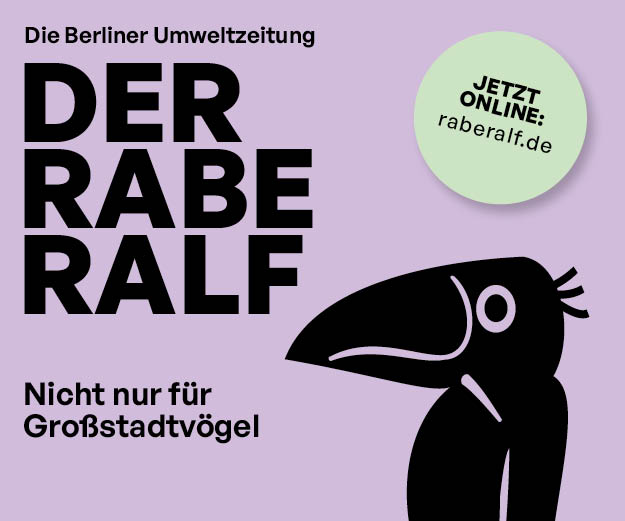Es ist längst klar: Die Klimakrise ist ohne einen Wandel des Ernährungssystems nicht zu lösen. Vor allem die Tierhaltung ist dafür verantwortlich. Doch politisch tut sich wenig bis nichts – nicht erst seit mit Alois Rainer ein Metzgermeister das Bundeslandwirtschaftsministerium leitet. Zu groß das Konfliktpotenzial, zu mächtig die Lobbys, zu laut die Proteste.
Doch die Tierzahlen müssen runter. Fachleute wie Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, wiederholen sich ständig: Ohne diesen Wandel können wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen.
In Deutschland gehen 83 Prozent der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft auf das Konto der Tierhaltung. Mehr pflanzenbasierte Ernährung bedeutet: weniger Emissionen, weniger Flächenverbrauch, mehr Aufforstung und Wiedervernässung.
Einzig Dänemark hat eine Strategie. Mit einem „Plant Based Action Plan“ baut das Land Alternativen auf.
Dänemark hat es inzwischen geschafft, seine ganzheitliche Strategie auf den Weg zu bringen. Der „pflanzenbasierte Aktionsplan“ fördert dort seit 2023 sowohl die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln als auch die Nachfrage. Die Däninnen und Dänen haben verstanden: Ohne einen Wandel im Ernährungssystem lassen sich die Klimaziele des Landes nicht erreichen.
Dem gefürchteten Kulturkampf begegnet man dort mit Diplomatie – breite Bündnisse und positive Anreize machten das Konzept mehrheitsfähig.
Diese dänische Diplomatie könnte jetzt auch außerhalb des Landes Bewegung in die Sache bringen. Denn Dänemark hat seit Anfang Juli den EU‑Ratsvorsitz inne – und nutzt diese Schlüsselrolle für nachhaltige Ernährungspolitik. Auf der Tagesordnung steht die Diskussion über einen gemeinsamen EU-Aktionsplan. Die Devise: dänische Lösungen für europäische Probleme.
Mehr Nachfrage und Produktion durch Kulturwandel
Die Logik des dänischen Aktionsplans: Wenn pflanzliche Gerichte lecker, leicht zugänglich und bezahlbar sind, greifen mehr Menschen zu – nicht nur im Supermarkt, sondern auch in Schulen, Kantinen und öffentlichen Einrichtungen.
Durch Studien ist gut belegt: Die Gestaltung der „Ernährungsumgebung“ beeinflusst persönliche Konsumentscheidungen maßgeblich. Wer das Angebot verbessert, verändert auch Gewohnheiten – und kann gleichzeitig gesunde Lebensweisen fördern und Emissionen senken.
Leckeres Angebot statt Kulturkampf: In Kantinen und Mensen lässt sich eine Ernährungswende organisieren. (Bild: Dragan Mujan/Shutterstock)
Besonders groß ist die Chance dort, wo viele Menschen gemeinsam essen. In Dänemark werden täglich 650.000 Gerichte in öffentlichen Kantinen serviert. Deshalb wurden im vergangenen Jahr nicht nur die offiziellen Ernährungsempfehlungen überarbeitet – sie raten nun ausdrücklich zu weniger Fleisch –, es gibt auch verbesserte Nachhaltigkeits-Richtlinien für die öffentlich getragene Gemeinschaftsverpflegung sowie Schulungen in den Küchen, wie sich leckere pflanzenbasierte Gerichte zubereiten lassen.
Der Wandel fällt vielen Menschen jedoch noch schwer. Damit pflanzenbasierte Gerichte besser den Geschmack der Dän:innen treffen, fördert die Regierung auch gezielt innovative Produktentwicklung.
Zudem soll ein Klima-Label im Einzelhandel für mehr Klarheit sorgen. Denn würden sich alle an die Ernährungsempfehlungen halten, könnte der Klimaabdruck der Ernährung um nicht weniger als 45 Prozent sinken.
Steigt die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln – etwa durch bessere Angebote in Schulen, Kantinen oder im Einzelhandel – entstehen theoretisch auch neue Anreize für Landwirt:innen, von tierischer auf pflanzliche Produktion umzustellen. Verlässliche Absatzmärkte könnten so den wirtschaftlichen Wandel unterstützen. Das Ziel des Aktionsplans ist es, einen erfolgreichen pflanzenbasierten Sektor aufzubauen.
Dänemark lässt sich die Ernährungswende etwas kosten
Im dänischen Aktionsplan gibt es konkrete finanzielle Unterstützung für einen Wandel in Nachfrage und Produktion. Über einen sogenannten Pflanzenfonds wurden seit 2023 in zwei Runden 24 Millionen Euro bereitgestellt, und in diesem Jahr sollen über 28 Millionen an Projekte vergeben werden. Aus dem Fonds wurden zum Beispiel die Entwicklung von Fleischersatzprodukten aus Pilzfermenten, Lupinenforschung vom Acker bis ins Supermarktregal sowie kreative Gemüsekompetenz für Kinder gefördert.
Auch über den Pflanzenfonds hinaus werden im Rahmen des Aktionsplans gezielt staatliche Mittel bereitgestellt. So finanzierte die Regierung ein branchenübergreifendes Innovationsforum, das Fachleute aus Forschung, Industrie und Verwaltung zusammenbringt, um entscheidende Hürden im Innovationsprozess zu erkennen, etwa bei der Zulassung neuer Produkte.
Ein Teil der Finanzierung kommt auch aus EU-Mitteln. So wurden im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) über die dänische GAP-Strategie gezielt Maßnahmen zur Förderung des heimischen Pflanzenanbaus unterstützt. Die Regierung setzt sich auch dafür ein, bestehende EU-Programme stärker für pflanzenbasierte Ernährung zu nutzen – etwa die EU-Schulprogrammförderung für Obst und Gemüse.
Die Motivation, den Aktionsplan gemeinsam umzusetzen, scheint in Dänemark groß – doch ein echter Kulturwandel braucht Zeit. Als bisher größter Teilerfolg gilt die Verstetigung des Pflanzenfonds, dessen Mittel seit der ersten Runde aufgestockt wurden. Dänemark setzt nun mit seiner „Plant-Based Diplomacy“ darauf, andere EU-Mitgliedsstaaten zu inspirieren, und nutzt dafür den Ratsvorsitz.
Bewegung in Brüssel – oder nur Lippenbekenntnisse?
Dabei hat politische Vorarbeit in der EU durchaus stattgefunden. Ein europäischer Aktionsplan für pflanzenbasierte Ernährung wurde bereits im Konsens-Schlussdokument des strategischen Dialogs zur Zukunft der EU-Landwirtschaft im vergangenen September gefordert.
Für diesen Prozess hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 29 zentrale Akteure aus Landwirtschaft, Umwelt, Zivilgesellschaft, ländlichen Regionen und Wissenschaft zusammengebracht. Sie sollten eine gemeinsame Vision für die Zukunft der europäischen Agrar- und Ernährungssysteme formulieren.
Lisa Elena Kettemer
ist promovierte Meeresbiologin und erforschte bislang die Verhaltensmuster von Wildtieren. Bei der Denkfabrik Faba Konzepte engagiert sie sich für die klimagerechte Transformation des Ernährungssystems, mit Schwerpunkt auf dem Abbau der Tierhaltung und der Förderung pflanzenbasierter Ernährung.
Doch der frisch angetretene EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung, Christophe Hansen, scheint bisher nicht überzeugt. In der politischen „Vision“ des christlich-konservativen Luxemburgers kommt der Aktionsplan mit keinem Wort vor.
Immerhin eröffnete Hansen im Juni per Videobotschaft eine Veranstaltung, bei der Abgeordnete aus fünf Fraktionen des Europäischen Parlaments öffentlich über den Plan diskutierten. Neben Sozialdemokraten, Grünen und Linken beteiligten sich auch Christdemokraten und Liberale – so viel Einigkeit ist in der EU-Agrarpolitik äußerst selten.
Tilly Metz, luxemburgische Grünen-Abgeordnete im Europaparlament, betonte: „Die Förderung einer stärker pflanzlichen Ernährung bedeutet nicht, Fleisch zu verbieten – es geht darum, unsere Auswahlmöglichkeiten zu erweitern und zu gesünderen, ausgewogeneren Essgewohnheiten überzugehen.“
Auch mehr als 130 zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen die Initiative. Darunter sind einflussreiche Dachverbände wie das Europäische Umweltbüro EEB und der Bioverband IFOAM.
Stellvertretend präsentierte der Verbraucher-Dachverband BEUC bei der Veranstaltung einen „Blueprint“ für den Aktionsplan mit konkreten Vorschlägen: von verbindlichen Richtlinien für nachhaltige Schulverpflegung über innovationsfreundliche Förderprogramme bis hin zu mehr Agrarbildung mit Fokus auf Hülsenfrüchte.
Diese „Blaupause“ ist mehr als eine Ideensammlung. Angelehnt an das dänische Modell soll sie Mitgliedsstaaten helfen, die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen zu bündeln. Genau das fordern auch Denkfabriken wie Agora Agrar in einem aktuellen Report. Ernährungspolitik brauche koordinierte Strategien, die Klima, Gesundheit und Versorgungssicherheit zusammendenken.
Der Plan könnte über grüne Kreise hinaus überzeugen
„So breite Unterstützung sehen wir hier in Brüssel fast nie“, sagt Rafael Pinto vom europäischen vegetarischen Dachverband EVU, der die Ernährungspolitik in Brüssel begleitet – und derzeit ungewöhnlich hoffnungsfroh ist.
Eine positive Erzählung der Ernährungswende – über Innovation, regionale Wertschöpfung und wirtschaftliche Unabhängigkeit – könnte politische Mehrheiten gewinnen, weil sie klassische Konfliktlinien um Verzicht meidet und Unterstützung aus Gesundheit und Wirtschaft mobilisiert.
Der Vorschlag bietet Lösungen für mehrere Probleme zugleich: Klimakrise, Nitratbelastung, Wassermangel und Gesundheitsrisiken durch Fleischkonsum. Zugleich eröffnen sich wirtschaftliche Chancen für Landwirt:innen, die auf neue pflanzliche Märkte setzen – das könnte Schnittmengen zur konservativen Agenda schaffen.
Und die Finanzierung? Neue Milliardenprogramme braucht es nicht unbedingt, sagen die Verbände. Es reiche, bestehende EU-Mittel umzulenken – vor allem in der Gemeinsamen Agrarpolitik. In der GAP fließt bisher ein Großteil der Gelder in die Tierhaltung. Auch Programme wie Horizon Europe oder der Green-Deal-Fonds könnten gezielt Projekte zur pflanzenbasierten Ernährung fördern.
Doch genau hier zeigt sich das Dilemma: Die Neuverhandlung der GAP wird derzeit von rechten und konservativen Kräften dominiert, die hart erkämpfte ökologische Standards rückabwickeln wollen. Zudem steht eine grundlegende Umstrukturierung des Agrarhaushalts ab 2028 im Raum – am 16. Juli will Kommissar Hansen dazu erste Pläne vorlegen. Dann beginnt in der EU-Kommission auch die Debatte über den mehrjährigen Finanzrahmen, der das Budget dafür festlegt.
Eins ist klar: Solange zentrale Hebel wie die EU-Agrarpolitik ungebremst die Tierindustrie subventionieren, wird es selbst mit einem gut durchdachter Aktionsplan schwer, ernstzunehmende Klimaerfolge zu erzielen.
Symbolpolitik oder echter Wandel?
Auch in Dänemark gibt es durchaus Kritik am dortigen Aktionsplan. Zwar wird der Plan durch andere Maßnahmen flankiert, etwa durch eine Steuer auf Agrar-Emissionen und Initiativen zur Renaturierung landwirtschaftlicher Flächen.
Doch die Abgabe ist so gering bemessen, dass sie kaum eine Abkehr von der Tierhaltung bewirken dürfte. So werden nur die theoretisch durch Technologie einzusparenden 40 Prozent der Treibhausgasemissionen besteuert – das entspricht 2030 effektiv 16 Euro pro Tonne CO2‑Äquivalent und soll bis 2035 auf 40 Euro erhöht werden.
Zudem fehlen in der Strategie messbare Ziele und echte Anreize für Landwirt:innen, tatsächlich umzusteigen. In der Tat ist dies auch nicht das erklärte Ziel des dänischen Modells. Die Emissionseinsparungen sollen durch technologische Lösungen erzielt werden, nicht durch einen Abbau der Tierhaltung.
Hinzu kommt: Dänemark produziert enorme Mengen Schweinefleisch für das Ausland. Gegen diese Exportorientierung hilft ein reduzierter Inlandsverbrauch wenig.
Kritik kommt auch aus der dänischen Klimabewegung. Die Kosten für den Aktionsplan zahle nicht die Tierindustrie, sondern die Öffentlichkeit, bemängelt ein dänisches Klimabündnis. Das Verursacherprinzip werde verletzt. Dieses Prinzip gehört zu den zentralen Grundsätzen der EU-Umweltpolitik und besagt, dass Kosten für Umweltfolgen von den Verursachern selbst getragen werden sollen.
Trotz dieser Bedenken ist die Initiative für einen EU-weiten pflanzenbasierten Aktionsplan eine vielversprechende Chance. Denn der Kulturwandel zu mehr pflanzlicher Ernährung ist entscheidend, und eine positive Erzählung könnte hier den Weg ebnen für weitere, konkrete Maßnahmen zum Abbau der Tierzahlen. Für das Klima wäre das unerlässlich.
Ob die dänische Diplomatie zunächst politische Mehrheiten für einen pflanzenbasierten Aktionsplan in der EU gewinnen kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Vielleicht überzeugen die guten Argumente ja sogar einen Metzgermeister.
Anzeige