Zehn Jahre ist es her: Durch die Entwicklung und Einführung der neuesten Generation antiviraler Medikamente wandelte sich Hepatitis C (HCV) von einer leidlich behandelbaren zu einer heilbaren Erkrankung. Im Unterschied zu den früheren interferonbasierten Therapien, die über das Immunsystem wirken, greifen die Direct Acting Antivirals (DAAs) gezielt bestimmte Proteine des HC-Virus an und blockieren somit die Virusvermehrung. Das Ergebnis: Selbst bei stark fortgeschrittenen Krankheitsverläufen, wie einer fortgeschrittenen Leberzirrhose oder einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz, sind hohe Heilungsraten möglich – und das bei einer Therapiedauer von zwei bis drei Monaten.
Hepatitis C: Eine hohe Dunkelziffer Vulnerable Zielgruppen: Betroffene fallen oft schon bei der Testung durchs Raster. Foto: ©iStock.com/jarun011
Vulnerable Zielgruppen: Betroffene fallen oft schon bei der Testung durchs Raster. Foto: ©iStock.com/jarun011
Rein aus dem Blickwinkel der Medizin betrachtet ist die HCV-Eliminierung also kein Problem – vielmehr scheint es an organisatorischen Fragen zu liegen, warum in Deutschland immer noch mehr Menschen neu diagnostiziert (2023: 10.452) als behandelt (7.922) werden. Die forschenden Pharmaunternehmen Gilead Sciences und AbbVie haben deshalb führende Expert:innen an einen Tisch geholt, um die Hürden zu identifizieren, die die Elimination verzögern oder verhindern. Daraus ist das Whitepaper „Die Elimination von Hepatitis C in Deutschland“ entstanden. Immerhin: Die Zahl der HCV-Betroffenen ist im vergangenen Jahrzehnt um rund 85.000 Fälle gesunken. Doch noch immer tragen rund 180.000 Menschen das Virus in sich – eine Schätzung. Wohl mehr als die Hälfte von ihnen weiß das gar nicht.
Hier wird die erste große Herausforderung deutlich: Viele der Betroffenen stammen aus den so genannten vulnerablen Zielgruppen. „In Deutschland haben wir konzentrierte Hepatitis-C-Epidemien in Gruppen mit erhöhtem Risiko“, sagt Martin Flörkemeier, Senior Director Public Affairs bei Gilead Sciences. „Das sind besonders Drogengebrauchende, Menschen im Strafvollzug oder in Obdachlosigkeit und Migrant:innen aus Ländern mit höherer Prävalenz.“ Diese haben gemeinsam, dass sie kaum Zugang zum Gesundheitssystem finden. „Sie fallen bereits bei der Testung häufig durch das Raster. Sie haben kaum Anbindung an die hausärztliche Versorgung und werden daher über die bestehenden Screening-Angebote nicht erreicht“, so Flörkemeier.
HCV: Vom Test zur Therapie Hepatitis C: Tests zu den Menschen bringen. Foto: ©iStock.com/kasto80
Hepatitis C: Tests zu den Menschen bringen. Foto: ©iStock.com/kasto80
Deshalb schlagen die Autor:innen des Whitepapers vor, neue Wege zu gehen: „Wir müssen den Betroffenen dort Test- und Behandlungsmöglichkeiten anbieten, wo sie sich aufhalten“, findet Flörkemeier. In Schleswig-Holstein übernimmt das zum Beispiel ein Testbus im Rahmen eines Pilotprojektes. „Der fährt im ländlichen Raum Orte an, wo sich Menschen, die Drogen konsumieren, aufhalten. Dort sind Tests möglich und die zu Behandelnden können sogar zum Arzt begleitet werden, wenn sie das wollen.“ „Linkage-to-Care“ nennen das die Fachleute; dahinter steht das Konzept, dass auf einen Test auch schnell eine Behandlung folgen soll.
Gleichzeitig müssten Aids-, Drogen- und Suchthilfen, aber auch Kontakt- und Beratungsstellen finanziell besser ausgestattet werden. Nur mit verbesserten strukturellen und personellen Rahmenbedingungen – auch das geht aus dem Whitepaper hervor – wird es gelingen, das HC-Virus in diesen Gruppen entscheidend zurückzudrängen. Lückenhaft ist auch das Management der Infektionskrankheit im deutschen Strafvollzug. Zwar empfiehlt die entsprechende Leitlinie eine Diagnostik bei allen Gefangenen – tatsächlich findet das aber nur bruchstückhaft statt.
Ein Meilenstein: HCV-Test im Rahmen des „Check-up 35“
Seit Oktober 2021 ist ein Test auf HCV im Rahmen einer allgemeinen präventiven Gesundheitsuntersuchung ab 35 Jahren Teil des Leistungskataloges der Gesetzlichen Krankenkassen. Damit wurde erstmals eine breite Zielgruppe angesprochen und das „mit Erfolg“, bestätigt Flörkemeier. „Bereits ein Jahr später sahen wir einen stetigen Anstieg der neu diagnostizierten Infektionen. Das sind alles Menschen, die von ihrer Infektion nichts wussten und nun erfolgreich behandelt werden können. HCV-Infektionen sind zwar vermehrt in Risikogruppen zu sehen, aber eben keineswegs auf diese beschränkt.“ Deshalb sollte die Testmöglichkeit im Rahmen des Check-ups bekannter gemacht werden. Auch eine bessere Vergütung der Ärzt:innen für die Screening-Maßnahmen könnte eine wichtige Stellschraube sein, um Licht in die Dunkelziffer der HCV-Versorgung zu bringen.
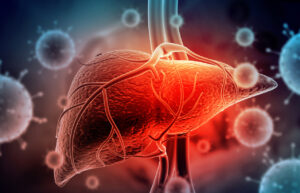 Hepatitis C ist eine Virusinfektion der Leber. Foto: ©iStock.com/Rasi Bhadramani
Hepatitis C ist eine Virusinfektion der Leber. Foto: ©iStock.com/Rasi Bhadramani
Im Jahr 2016 hatte die damalige Bundesregierung auf die neuen pharmazeutischen Entwicklungen im Bereich dieser Lebererkrankung reagiert und eine Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (BIS 2030) vorgelegt. Die Expert:innen fordern nun im Whitepaper, dass auch die Nachfolgeregierungen ein klares Bekenntnis zur Eliminierung abgeben, denn: „Deutschland muss ein gesundes Leben gewährleisten für alle hier lebenden Menschen jeden Alters.“ Es fehle ein nationaler Aktionsplan, um alle Anstrengungen bundesweit zu koordinieren und „Infektionsketten zu durchbrechen und das Hepatitis-C-Virus erfolgreich zu eliminieren.“
Hepatitis C ist eine Virusinfektion der Leber; sie wird über Blut übertragen. Bei etwa 70 Prozent der Patient:innen kann die Infektion chronisch werden und dann drohen Leberfibrose, Zirrhose, Leberzellkrebs und vorzeitiger Tod. Eine Infektion kann mithilfe einfacher Screening- und Diagnosetests nachgewiesen werden. Seit 2014 gibt es moderne, direkt wirkende antivirale Arzneimittel, mit denen sich die chronische Hepatitis C sehr gut behandeln lässt.
Weiterführende Links:
Gilead Sciences und AbbVie, Die Elimination von Hepatitis C in Deutschland. Whitepaper.
Bundesgesundheitsministerium: Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen – BIS 2030.
