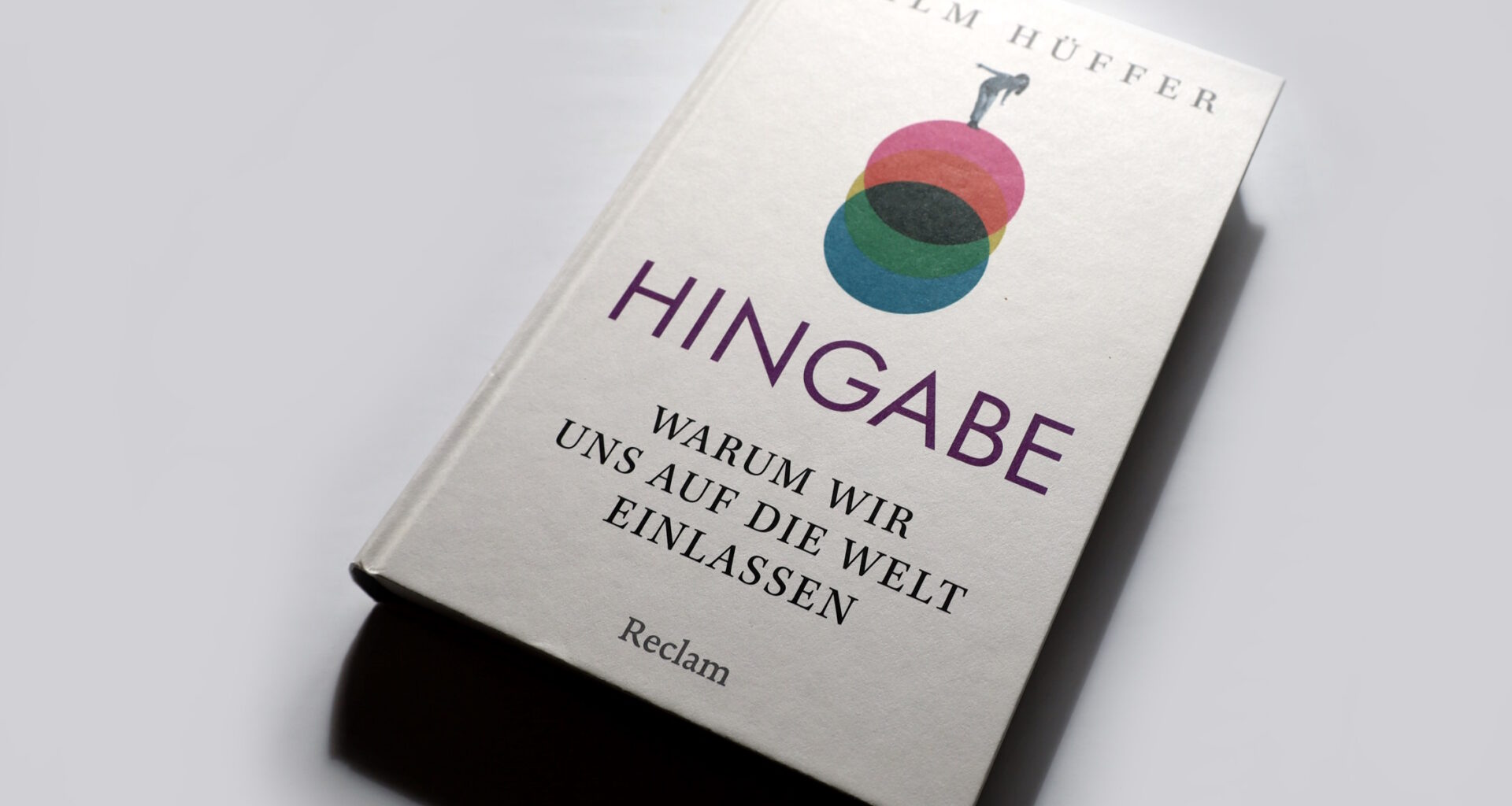Wie lebt man ein erfülltes Leben? Wie bekommt man es überhaupt? Was muss man dafür tun? Oder muss man gar nichts dafür tun? Eigentlich sind das alles Fragen, die sich spätestens in der Pubertät stellen und mit dem Schulabschluss akut werden. Nur: Kein Mensch bereitet einen auf diese wichtigsten Weichenstellungen vor. Und so sah sich Radiomoderator Wilm Hüffer dazu angeregt, einmal ein ganzes Buch über Hingabe zu schreiben. Ein durchaus vertrackter Begriff. Aber ohne Hingabe gibt es kein erfülltes Leben. Selbst wenn es viele nicht glauben.
Der Begriff ist hochaktuell – gerade weil er unsere vom Kommerz und Wettbewerbsdenken beherrschte Gesellschaft scheinbar überholt ist, Teil einer vergangenen Welt, in der sich Menschen noch Ideen, Aufgaben oder schlicht dem Dienst an der Gemeinschaft widmeten. Alles von gestern?
Wenn man sich die derzeitige Politik so anschaut: Ja. Der Egoismus triumphiert. Rücksichtslosigkeit wird als Tugend verkauft. Jeder denkt nur an sich. Was man braucht, kann man sich ja im Internet bestellen. Und dann wird man glücklich …
Wird man natürlich nicht, stellt Hüffer fest, der auf seiner Suche nach dem richtigen Weg glücklich zu werden natürlich auch auf die Existenzialisten des 20. Jahrhunderts – und insbesondere Sartre – zu sprechen kommt. Jene Gedankenpaläste, auf denen die heutigen Ansprüche von Selbstverwirklichung beruhen.
Die aber vor allem den Weg zur Erfüllung im eigenen Kopf suchen. Egoshooter nennt sie Hüffer. Nicht ganz unbegründet. Er geht bis zu René Descartes und seinem berühmten „Cogito ergo sum“ zurück, das seit dem Jahr 1641 in philosophischen Debatten für maximale Verwirrung sorgt.
Selber schuld
Es ist eine Kurzformel, die schon die Radikalismen der Zukunft andeutet. Und damit auch die Zerrissenheit des heutigen Menschen zwischen den radikalen Ansprüchen, in denen er sich gestresst und verloren fühlt. Denn wer – wie Hüffer – die Folgen dieses Denkens, man sei erst deshalb da, weil man denkt, dechiffriert, merkt bald, dass Descartes damit das Wesentliche aus unserem Dasein einfach rausretuschiert hat.
Darauf kommt Hüffer erst spät. Er meint es wirklich ernst mit seinen Lesern. Denn er weiß, wie dieses „Cogito ergo sum“ fest in den Köpfen sitzt, eng verschwistert mit dem Spruch „Jeder ist seines Glückes Schmied“ und den politisch etablierten Vorwürfen an alle, die nie auf einen grünen Zweig kommen, dass sie selbst schuld wären an ihrem Versagen.
Sie hätten sich eben nicht selbst verwirklicht. Als stecke unser Leben schon als Schablone in unseren Köpfen und wir müssten nur daran gehen, es einfach in die Welt zu setzen. Rücksichtslos.
Was aber vielen Menschen nicht gelingt. Denn wir sind – das hat Descartes an dieser Stelle einfach ausgeblendet, nicht voraussetzungslos in der Welt. So allein, wie es der Spruch andeutet, schon mal gar nicht. Wir sind nicht mal allein wir selbst. Denn wer sich auch nur ein bisschen genauer anschaut, wie aus einem Neugeborenen ein lebendiger, taten- und ideenreicher Mensch wird, der sieht, dass die Ich-Werdung von Anfang an ein gemeinschaftlicher Prozess ist.
Wir werden erst dadurch, dass wir von und mit anderen lernen. Was übrigens auch bedeutet, dass wesentliche Teile unseres Ichs ohne die Gemeinschaft, die uns geformt hat, nicht denkbar sind. Wir sind von Anfang an ein gemeinschaftliches Wesen. Das ignorieren freilich die Prediger des Egoismus ganz bewusst. Denn diese Ignoranz kommt ihnen zupass. Sie ermöglicht erst eine solche Gesellschaft der Rücksichtslosen, Raffgierigen und Gefühllosen, die wir haben.
Wie konnte das passieren?
Kurz aufatmen. Denn: Diesen Teil der Geschichte erwähnt Hüffer nicht. Das ist schade. Denn genau hier wird die soziale zur politischen Dimension, wird aus einem (bewusst) falschen Denken über menschliche Selbstentfaltung ein ganzer Topos ideologischer Vorbehalte, die unsere Gesellschaft verwüsten, kaltherzig und unsolidarisch machen.
Das musste hier gesagt sein. Weil das eben auch in all die Prozesse der Selbstfindung hineinwirkt, die Hüffer beschreibt. Die markanten Beispiele entnimmt er bekannten Werken der Weltliteratur. Denn natürlich haben sich Autorinnen und Autoren immer schon Gedanken darüber gemacht, warum so viele Menschen ein verfehltes Leben leben. In dem sie verzweifeln, am Ende versagen und trotzdem nicht wissen, wie das passieren konnte.
Wobei Hüffer eben auch akribisch feststellen kann, dass die Entwicklung zum Egoshooter nur das eine Extrem ist, in das die Menschen der Gegenwart geraten auf ihrer Jagd nach dem einzig richtigen und wahren Glück. Oft genug endet die Jagd in Orientierungslosigkeit, dem Gefühl, einem gescheiterten Lebensplan nachgejagt zu haben und nun auf dem Gipfel des Erfolges zu merken, dass etwas fehlt.
Das Glück nicht zu haschen ist. Steckt die Vorstellung von dem, was uns glücklich macht, doch nicht in unserem Kopf? Ist es völlig sinnlos, sich in der Jugend darauf zu konzentrieren, all die Dinge anzupacken, die man schon immer machen wollte?
Dass das allein nicht genügt, ist Thema von ganzen Bergen weltbekannter Romane – von Stendhal bis Updike. Die Schicksale einiger dieser gescheiterten Helden nimmt Hüffer sehr genau unter die Lupe, folgt den Intentionen der Autoren, um deutlich herauszuarbeiten, warum all diese Helden an ihren eigenen Ansprüchen scheiterten. Und dabei sogar die tatsächlichen Alternativen verpassten, ein erfülltes und akzeptiertes Leben zu führen.
Die falsche Freiheit
Auch das so eine Stelle, die Hüffer nur kurz streift, die aber eigentlich ein eigenes Buch wert wäre: Wie wir in dem Glauben, wir würden nur radikalen eigenen Ideen folgen, tatsächlich den falschen Erwartungen und Ansprüchen einer Gesellschaft folgen, die Menschen ganz selbstverständlich in Schubladen sortiert – und danach auf- und abwertet.
Auch damit haben viele der Romanfiguren zu kämpfen. Das wird mit Julien Sorel in Stendhals Roman „Rot und Schwarz“ genauso deutlich wie mit Constanze Chatterley in D. H. Lawrence Roman „Lady Chatterley“. Es ist eben nicht nur die Unfähigkeit dieser tragischen Heldinnen und Helden, die sie am Ende scheitern lässt, sondern es sind auch die starren Konventionen einer Gesellschaft, die ihren Mitgliedern sehr wohl sehr enge Grenzen setzt, innerhalb derer sie agieren dürfen.
Im Grunde kann man Hüffers Buch auch als Bilanz eines Scheiterns lesen – des Scheiterns der individuellen Befreiungsbewegungen seit dem 19. Jahrhundert. Gescheitert an Schranken, Grenzen und oft unausgesprochenen Moralvorstellungen einer Gesellschaft, in der Freiheit fast immer falsch verstanden wird.
Was dann wieder mit dem zu tun hat, was Hüffer so gründlich untersucht. Denn wenn er das Wort Hingabe umkreist und das, was es tatsächlich bedeutet, dann umkreist er eigentlich auch unseren Begriff von Freiheit. Was eben noch deutlicher wird, wenn er immer weiter auf unsere Vorstellungen von Hingabe eingeht – und die meist falsch verstandenen Konnotationen.
Was auch mit den Missverständnissen beim Thema Hingabe zu tun hat. Das Wort ist gerade im Deutschen moralisch überladen, wird meist mit sexueller Hörigkeit, mit devoter Untertänigkeit oder völliger Selbstaufgabe in Verbindung gebracht. Womit auch hier deutlich wird, dass unsre Interpretation des Begriffs ins Extrem tendiert. Und so auch praktiziert wird.
Wollen und Können
Es bleibt ja nicht bei Constanze Chatterleys gescheitertem Versuch, sich in völliger sexueller Hingabe aus ihren gesellschaftlichen Fesseln zu befreien. Gerade das 20. Jahrhundert war geprägt von Ideologien, die von ihren Anhängern völlige Hingabe verlangten.
Und auch dieser Mechanismus ist vielen Menschen wie eine Krücke im Leben – die völlige Opferung für eine Sache, eine Ideologie, einen Staat erlöst – scheinbar – von der schieren Not, dem eigenen Leben selbst einen Sinn zu geben.
Logisch, dass Hüffer sehr viel Energie darauf verwendet, diese extremen Vorstellungen von Hingabe zu sezieren. Und nach und nach dahin zu kommen, wo sich die beiden scheinbaren Extreme vereinen – das „innere Bild“ von dem, was wir sein möchten, mit den äußeren Bedingungen, die ermöglichen, was wir sein können.
Denn wer nur ein bisschen darüber nachdenkt, merkt ja nicht nur, dass wir von Anfang an gemeinschaftliche Wesen sind und die vorgefundene Welt die Bedingungen vorgibt, innerhalb derer wir etwas werden können.
Der merkt auch, dass es gerade diese Verflechtung mit den Menschen um uns herum ist, die uns überhaupt erst das Instrumentarium in die Hand gibt, wir selbst werden zu können. Wir können gar nichts werden, wenn uns das nicht viele, viele andere Menschen ermöglichen.
Wir sind eben auch, was wir mit Hilfe anderer geworden sind. Und wir werden das, was uns die Hilfe anderer ermöglicht. Wir können gar nicht anders. Auch wenn es die Egoshooter unter uns anders sehen und rücksichtslos ihre Mitmenschen ausnutzen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und dann oft genug in Schleifen enden, die letztlich auch wieder nur vom Scheitern erzählen.
Denn – auch das wird deutlich – unser Gefühl, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, hängt eben nicht nur vom Cogito in unserem Kopf ab. So sehr, wie wir auf andere angewiesen sind, ein erfülltes Leben zu gestalten, so sehr sind wir auch auf ihre Anerkennung angewiesen.
Ohne Hingabe geht es nicht
Was eben auch heißt: Erfüllung finden wir nicht in den einsamen Plänen, die wir im Kopf schmieden und dann ohne Rücksicht auf Verluste umsetzen. Das funktioniert nicht. Denn auch zur Umsetzung unserer Lebensträume brauchen wir die Gemeinschaft. Und da wird es spannend, denn genau da sind wir auf die Angebote unserer Mitwelt angewiesen, die Einladungen, uns auf Dinge, Wege, Menschen einzulassen.
Oder eben: uns hinzugeben. Hingabe eben nicht als Verzicht auf jede persönliche Selbstentfaltung, sondern als Weg zur Verwirklichung unserer Träume und Wünsche, indem wir uns tatsächlich hingeben. Auch an Menschen.
Man merkt es an dieser Stelle, dass es – neben dem großen fragilen Feld erlebter Freiheit – auch um das Thema Vertrauen geht. Noch so eine Tür in ein völlig anderes Buch, das unsere Gesellschaft einmal unter diesem Blickwinkel beleuchten würde – wie sehr der um sich greifende Egoismus, der verbreitete Glaube, jeder hätte das Recht, seine Interessen unbedingt gegen alle anderen durchzusetzen, sofort Dinge wie Misstrauen und Angst im Gefolge hat.
Denn diese Art, sein Ich unbedingt durchzusetzen, sorgt dafür, dass wir einander nicht mehr vertrauen können. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir von Anderen respektiert und rücksichtsvoll behandelt werden.
Man merkt schon: Wenn man Hüffers Gedankenwege weitergeht, kommt man zu einer ziemlichen Generalkritik an einer völlig von sich selbst abgekommenen Gesellschaft, die ausgerechnet das, was Menschen tatsächlich erst Halt und Zutrauen gibt, fortwährend zerstört. Es in eine Ware verwandelt, die sich immer weniger Menschen leisten können.
Einsamkeit
Dabei macht gerade Hüffers akribische Untersuchung deutlich, dass wir ohne die Menschen um uns herum nicht einmal die Chance hätten, irgendetwas, was uns wichtig ist, zu verwirklichen. Die Selbstverwirklichung gibt es nur in der Gemeinschaft – und in der Akzeptanz, dass eben nicht alles allein auf unserem Mist gewachsen ist.
Dass wir zu einem großen Teil erst durch unsere Mitwelt wurden, was wir sind. Und dass wir unser Menschsein nur verwirklichen können, wenn wir uns nicht nur unseren Kopfgeburten hingeben, sondern auch der Gemeinschaft, mit der wir sie gemeinsam umsetzen können.
Niemand schafft etwas allein aus sich heraus. Und niemand wird glücklich, wenn er sich einer Aufgabe, einer Tätigkeit, anderen Menschen nicht hingeben kann. Denn wenn er das nicht kann, bleibt er einsam. Findet sich – wie die Figuren Kafkas – in endlosen Schleifen des Nicht-Wahrgenommen-Werdens wieder. Die Vorstellungen, die wir im Kopf tragen, sind nicht das, was wir in der Welt vorfinden.
Einen goldenen Weg, für unsere Wünsche und Träume im Leben Erfüllung zu finden, gibt es nicht, kann Hüffer feststellen. Wir leben mit der Janusköpfigkeit der eigenen Person, sind hin- und hergerissen. „Egomanie und Devotion sind immer das Ergebnis radikaler Versuche, die Spannung des eigenen Lebens aufzuheben“, schreibt Hüffer.
„Man flüchtet sich in die Selbstbespiegelung, weil die Kompromisse des Lebens allzu deprimierend wirken, oder begnügt sich mit den toten Routinen des Alltags, weil die eigenen Wünsche ohnehin unerreichbar scheinen.“
Gefangen im Dilemma?
Dieses Dilemma macht viele Menschen mutlos. Und so unterlassen sie lieber alle Versuche, an ihrem Dilemma etwas zu ändern. Und dabei gehört in unserem Leben eben auch dazu, dass selbst die Dinge scheitern können, die wir von ganzem Herzen wollen.
Unser Lebe ist kein Zustand, der irgendwann an einen Punkt der vollsten Zufriedenheit kommt. „Es gilt also, sich aufzurappeln und von neuem nach Balance zu suchen“, kann Wilm Hüffer letztlich feststellen. Und die findet man eben auch nicht bei sich allein. Dazu braucht es ein Gefühl, wie wir uns dabei mit anderen verorten und verbinden.
„Daher führt die eigene Abwägung immer auch zu der Frage, ob sich eine Aufgabe so ausführen, Verantwortung so wahrnehmen lässt, dass sie zu jener Welt einen Beitrag leisten kann. Hingabe gewinnt ihren größten Wert, wenn sie eine gemeinsame Chance des Gelingens eröffnet, eine gemeinschaftliche Verantwortung für das Ganze zum Leben erweckt.“
Das könnte ein Motto für unsere korrumpierte Gegenwart sein, in der das Egoshooting scheinbar die Maßstäbe setzt für ein „gelingendes Leben“, das sich allein an materielle Maßstäbe bindet, aber vergisst, dass es menschliche Erfüllung nur in der Hingabe an ein Gemeinsames gibt. Das es zu finden gilt.
Spätestens da merkt man, dass all unsere Selbstachtung eben auch davon abhängt, ob und wie wir von anderen gesehen werden. Wahrgenommen werden. Hingabe wird – wenn man sich nicht selbst verleugnet – mit Resonanz belohnt. Noch so ein Wort, das über den Rahmen des Buches hinausweist. In eine Welt, in der immer mehr Menschen nach Resonanz lechzen, die sie in eine Welt der Egoshooter einfach nicht mehr bekommen.
Wilm Hüffer Hingabe Reclam, Ditzingen 2025, 24 Euro.