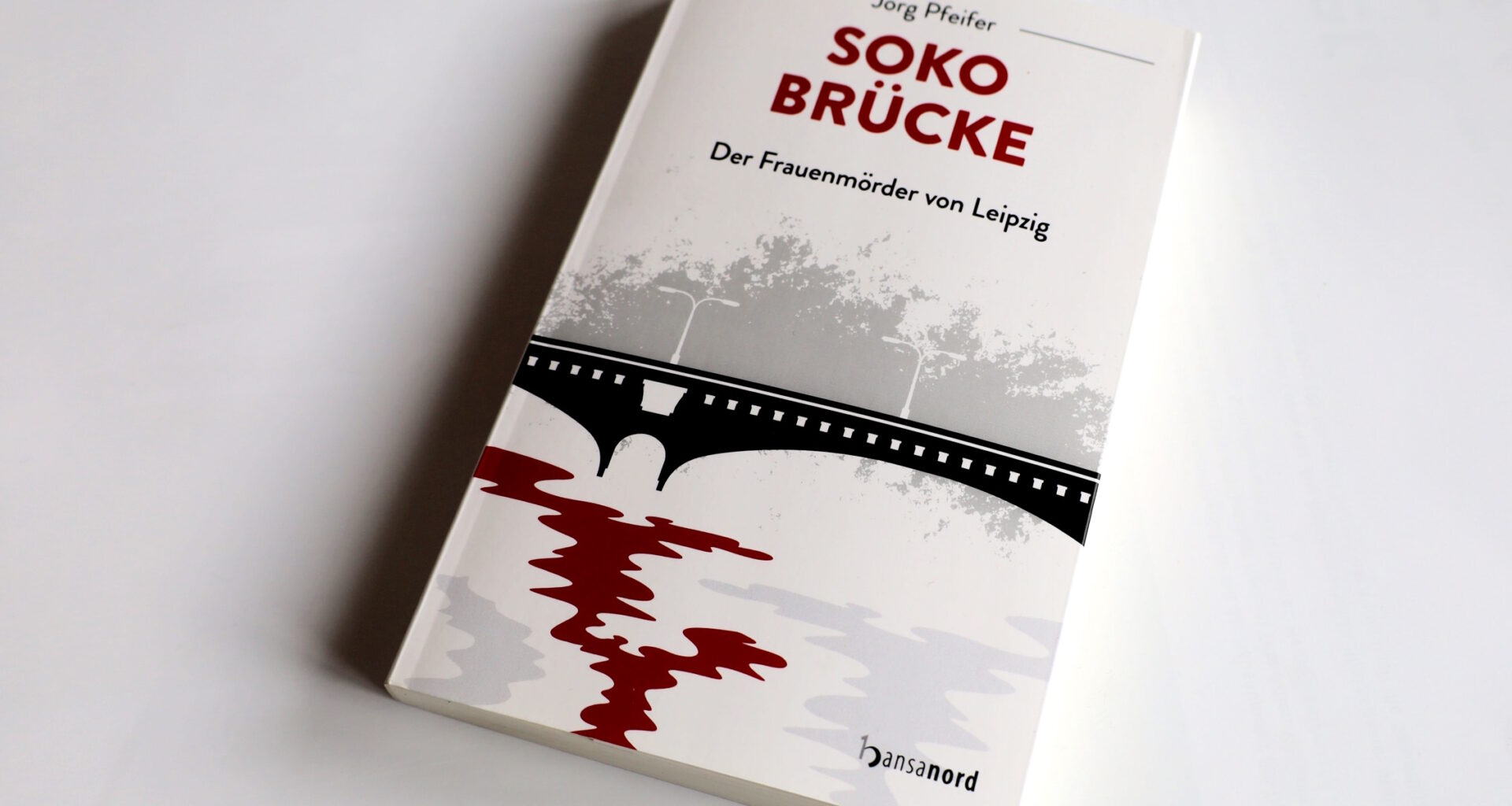Verbrechen passieren nicht nur anderswo. Sie passieren auch in Leipzig. Und manchmal sorgen sie für ein Entsetzen, das kaum noch zu fassen ist. So wie 2016, als im Elsterbecken die zerstückelten Teile einer Frau gefunden wurden. Noch ein weiterer Mord würde geschehen, bis die Polizei des Täters habhaft werden würde. Ab 2017 berichtete auch Lucas Böhme als Gerichtsreporter in der LZ über den Fall, den der Journalist Jörg Pfeifer in diesem True-Crime-Buch noch einmal ganz von Anfang an aufrollt.
Denn während in vielen Kriminalromanen der Mörder schon nach wenige Tagen von einem hektisch agierenden Kriminalbeamten gestellt wird, sieht die Realität meistens ganz anders aus. Auch im Fall des „Frauenmörders von Leipzig“. Pfeifer geht es dabei nicht um das Sensationelle, aus dem Boulevardmedien meist ihre Geschichten basteln. Er begleitet viele Fälle oft jahrelang, spricht mit den Ermittlern, mit Staatsanwälten, Zeugen und – wenn diese es zulassen – auch mit den Tätern. Und irgendwann wird daraus dann eine dichte Dokumentation für das Fernsehen oder – wie in diesem Fall – auch ein Buch.
Und auch Pfeifer empfand pures Entsetzen, als er 2016 erstmals über den Fall las, den die Boulevard-Medien kurzerhand zum „Stückel-Mord“ machten. Während die Polizisten, die mit der Aufklärung des Falles beschäftigt waren, im wahrsten Wortsinn jeden Stein umdrehten, durch die Bars in Lindenau gingen, um mögliche Bekannte der getöteten Frau zu finden und so vielleicht Hinweise auf den Täter zu bekommen. War der Täter ein Teil dieses Milieus, in dem auch die ermordete Portugiesin unterwegs war? Kannte er sie näher? War es gar ein tätowierter Mann, der auf einmal nicht mehr greifbar schien?
Ein tiefer Blick in die Polizeiarbeit
Jörg Pfeifer zeigt, wie die Leipziger Polizei vorging, welche Kriminalabteilungen alles mit dem Fall befasst waren und wie systematisch alle nur möglichen Spuren gesammelt wurden, die benötigt werden, wenn ein Täter vor Gericht anhand klarer Beweise verurteilt werden soll. Denn die Ermittler müssen von Anfang an an beides denken – Spuren zu sichern, die sie zum Täter führen. Und alles zu dokumentieren, was am Ende auch beweist, dass die Tat so stattgefunden hat, wie sie in den Ermittlungen rekonstruiert werden konnte. Erst recht, wenn der Täter am Ende schweigt oder – wie in diesem Fall – wohl auch nicht in der Lage war, über das Vorgefallene tatsächlich zu sprechen.
Wobei Pfeifer auch großen Wert darauf legt, die Motive und Handlungen des Täters zu verstehen, der sich am Ende tatsächlich als einer der Gäste in den Bars rund um den Lindenauer Markt erwies. Eigentlich ganz ähnlich in Leipzig gestrandet wie die Frau aus Portugal, die er getötet hat. Er selbst kam aus der Mongolei und hatte eine gescheiterte Beziehung hinter sich. Vieles im Leben kann sich dann zu solchen Ausnahmesituationen ballen, auch wenn Pfeifer berechtigterweise feststellen kann, dass die wenigsten Menschen dann so aus der Spur geraten.
Zusätzliche Dramatik bekam der Fall durch einen weiteren Fund von Leichenteilen am Baggersee in Thekla, auch wenn es sich hier um einen anderen Täter handelte, dessen die Polizei tatsächlich schnell habhaft werden konnte. Während sie für die Lösung des Falles von der Landauerbrücke tatsächlich volle 312 Tage brauchte, bis sie bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall tatsächlich auf den unscheinbaren Mann trafen, der nicht nur den nun zweiten Tötungsfall gestand, sondern auch den an der getöteten Portugiesin.
Wie schwer wiegt die Schuld?
Womit die akribische Beweiserhebung nicht endete. Und auch nicht Pfeifers Bericht. Denn jetzt ging es darum, den Gerichtsprozess vorzubereiten und beide Tötungsfälle so eindeutig zu belegen, dass der Richter eine belastbare Entscheidungsgrundlage bekam. Und noch etwas musste nun noch geklärt werden: War der Täter tatsächlich vollumfänglich für seine Tat verantwortlich? Denn das entscheidet darüber, wie hoch das Strafmaß am Ende ausfällt und ob der Verurteilte überhaupt je wieder in die Freiheit entlassen werden kann.
Oft beschäftigen sich ganze Verhandlungstage mit dieser Frage und geben den Gerichtsreportern ausgiebig die Gelegenheit, die Schwierigkeiten eines solchen Falles nachzuvollziehen und auch die Polizisten und Gutachter kennenzulernen, die vor dem Gericht ihre Aussagen machen. Bekannte und Verwandte des Täters werden befragt. Der Täter kann sprechen, muss aber nicht. Und wer nicht mit vorgefertigtem Urteil im Gerichtssaal sitzt, kann nachspüren, wie schwer das Ringen um die Wahrheit ist. Und auch oft genug an Grenzen stößt, wenn der Täter zum Beispiel über seine Taten nicht sprechen will oder kann.
Dann bleiben logischerweise auch für Ermittler und Beobachter Fragen offen. Jede Menge Fragen, die es sowieso schon zu jedem aufsehenerregenden Mord gibt. Denn letztlich wollen alle auch verstehen, wie es zu den Taten kam. Wie ein Mensch in Situationen kommen kann, in denen er wehrlose Menschen tötet, um sie danach mit geradezu kalter Überlegung irgendwo in der Stadt zu „entsorgen“. Denn auch hinter der Zerstückelung der Leiche steckt ja Überlegung. Und eine gewaltige Gefühlsdistanz. Das spürt man auch in Pfeifers Rekonstruktionen diese Szenen.
Wie erzählt man so einen Fall?
Denn Jörg Pfeifer hat natürlich nicht einfach nur pur die Ermittlungsakten abgeschrieben, sondern versucht die Geschichte auch anhand echter Charaktere zu erzählen. Einige der Auftretenden sind tatsächlich echte Leipziger Beteiligte an diesem Fall, andere sind eine Konstruktion aus mehreren Ermittlern, wie Pfeifer erklärt. Und auch nicht alle erscheinen unter Klarnamen. Auch nicht der Täter.
Was dann einige Kunstgriffe braucht, um die Ereignisse trotzdem lebendig zu erzählen. Da bekommt dann einer der zentralen Ermittler auch gleich noch eine eigene, berührende Familiengeschichte. Denn Polizisten sind natürlich auch Menschen mit Sorgen, Freuden, Lieben. Nur weil das so ist, können sie sich auch in die Täter hineinversetzen.
Und Pfeifer arbeitet natürlich einen Aspekt besonders heraus, der ihm wichtig ist, weil er in unserer heutigen Gesellschaft meist nicht wahrgenommen wird: „Diese Geschichte handelt – neben den Ermittlungen in einem aufsehenerregenden Kriminalfall – von Gefühlen der Ausgrenzung, konkret: wenn Menschen nicht mehr wahrgenommen werden. Wenn sie aus einem anderen Sozial- und Kulturkreis stammen. Wenn es keinen regulierenden Austaush mehr gibt. Wenn Menschen ihrer eigenen ‚Blase‘ oder ‚peer group‘ überlassen werden. Wenn sie alleine bleiben. Wenn es keinen gibt, der sich für ihre innere Zerrüttung interessiert. Wenn Angst und Rückzug vorherrschen.“
Man merkt schon: Da geht es nicht nur um Menschen aus Portugal, der Mongolei oder von anderswo, die in Leipzigs nicht so noblen Ortsteilen gelandet sind. Da geht es um viele solcher Abschottungen und Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft. Hier kommen auch die Opfer ins Bild. Denen Pfeifer natürlich auch einige Kapitel widmet. So wird die Welt deutlicher, in der alles geschah.
Für alle, denen die damaligen Sensationsgeschichten aus diversen Medien bis heute schlaflose Nächte machen, ist Pfeifers Buch eine Einladung, auch einen der rätselhaftesten Fälle der jüngeren Leipziger Kriminalgeschichte ein wenig besser zu verstehen. Was einem – wie den Ermittlern – oft erst gelingt, wenn man tatsächlich ein gewisses Verständnis entwickelt für die Menschen, die in so einen Fall verstrickt sind.
2020 gab es dann noch ein Nachspiel zum Prozess, in dem es um die Schwere der Schuld ging. Darüber berichtete Lucas Böhme hier.
Jörg Pfeifer „Soko Brücke. Der Frauenmörder von Leipzig“ hansanord Verlag, Feldafing 2025, 17 Euro