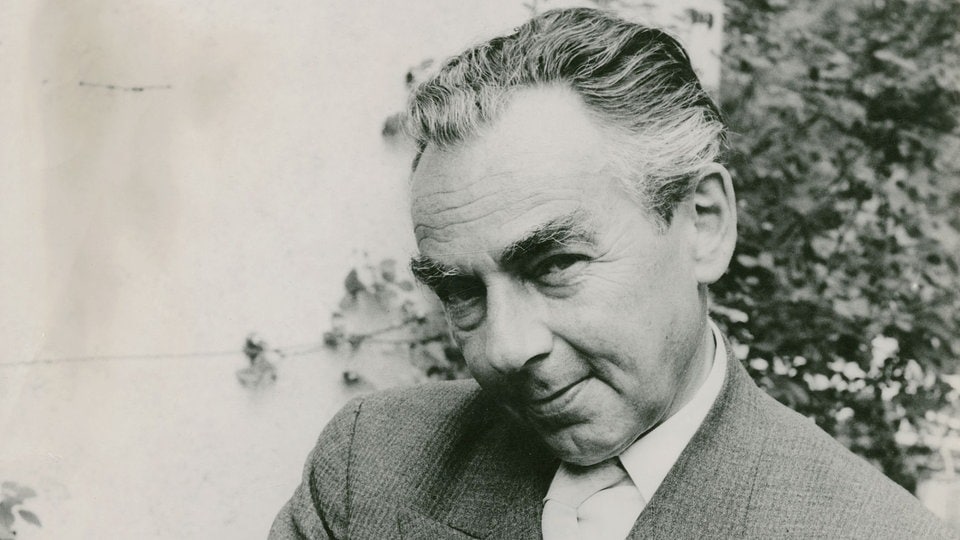7. Kästner bleibt während der NS-Zeit in Deutschland
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten entschied sich Erich Kästner gegen eine Emigration. Zweimal wurde er von der Gestapo verhaftet und verhört, aber wieder freigelassen. Trotz offiziellen Schreibverbots konnte er zunächst weiterhin schriftstellerisch tätig sein und veröffentlichte unter verschiedenen Pseudonymen. So verfasste er etwa 1941 das Drehbuch zum Filmklassiker „Münchhausen“. Ab 1943 erhielt er dann ein endgültiges Schreibverbot. Er lebte vom Verkauf seiner Bücher im Ausland.
8. Der geplante Roman über die Nazi-Zeit erschien nie
Ein Grund, warum Kästner Nazi-Deutschland nicht verließ, war sein Anspruch, als Chronist zu bleiben, um später über die Zeit schreiben zu können. Während des Zweiten Weltkriegs verfasste er ein geheimes Kriegstagebuch in Kurzschrift. Hier sammelte er Heeresberichte, Flüsterwitze und dokumentierte den Alltag in Berlin. Bei Bombenalarm nahm er das Buch mit in den Luftschutzkeller. Doch der große Zeitroman über das „Dritte Reich“ erschien nie. Nach einem Gespräch mit einem Auschwitz-Überlebenden erkannte Kästner, dass er mit seinen Aufzeichnungen dem Ausmaß dessen, was wirklich passiert war, nicht gerecht werden konnte. Lediglich seine Tagebuch-Notizen erschienen später. Unter dem Titel „Das blaue Buch“ wurde 2018 eine kommentierte Ausgabe des Kriegstagebuchs herausgegeben.
9. Kästner blieb unverheiratet und hatte einen Sohn
Erich Kästner hat nie geheiratet, hatte aber zahlreiche, teils parallellaufende Affären und Liebesbeziehungen. Die Journalistin Luiselotte Enderle war seine langjährige Lebensgefährtin und erste Biografin. Seinen einzigen Sohn Thomas bekam Kästner allerdings mit Friedel Siebert, mit der er über Jahre hinweg ein Verhältnis hatte. Thomas Kästner wurde 1957 geboren. Für einige Jahre pendelte Kästner im Fünfwochenrythmus zwischen Sohn und Freundin in Berlin und Enderle in München.
10. War in der Nachkriegszeit politisch aktiv
Nach dem Ende des Zweiten Weltkreigs zog Kästner nach München. Hier gab er die Kinder- und Jugendzeitschrift „Pinguin“ heraus, wurde Präsident des westdeutschen P.E.N.-Zentrums und war einer der Begründer der Internationalen Jugendbibliothek in München. In den Nachkriegsjahren engagierte sich Kästner politisch. Er protestierte gegen Atomwaffen und trat bei den Ostermärschen als Redner auf. Später beteiligte er sich an Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Am 29. Juli 1974 starb Kästner an Speiseröhrenkrebs. Er wurde auf dem St.-Georgs-Friedhof in München-Bogenhausen beigesetzt.
Quellen: Munzinger Online, Sven Hanuschek: „Keiner blickt dir ins Gesicht. Das Leben Erich Kästners“, Homepage Erich-Kästner-Museum
Redaktionelle Bearbeitung: Lilly Günthner