Frau Borogan, Herr Soldatov, ein Öl-Manager fällt aus dem Fenster, ein Minister erschießt sich am nächsten Tag mutmaßlich selbst, die Chefin des Obersten Gerichts stirbt überraschend an Krebs … Insgesamt sind in den vergangenen drei Jahren 19 Personen aus den höchsten Machtetagen Russland unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Sie beide decken seit 25 Jahren Strukturen und Mechanismen der russischen Geheimdienste auf. Was geht da vor sich?
BOROGAN: Die Vorfälle sind ein Zeichen dafür, unter welch großem Druck des Kremls Angehörige der russischen Machtelite stehen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Geheimdienste: Alle relevanten russischen Unternehmen und die Ministerialbürokratie sowieso stehen unter ständiger Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes FSB. Das passiert in den meisten Fällen nicht offen, sondern durch ein System von Offizieren im besonderen Einsatz, die beispielsweise in Unternehmen als Sicherheitsbeauftragte in den Vorständen platziert werden. Sie sammeln belastendes Material. Ununterbrochen.
Das kann der Kreml oder auch Putin persönlich in einem System, in dem beispielsweise die Korruption endemisch ist, jederzeit nutzen, um alle Funktionsträger permanent in einer Atmosphäre der Spannung, der Angst und der Psychose zu halten. Jeder in diesen Kreisen weiß: Heute trifft es diesen Minister, morgen kann ich an der Reihe sein. Mir scheint, manch einer sieht dann offenbar keinen anderen Ausweg mehr als den Selbstmord.
Zu den Personen
Irina Borogan, 50, und Andrei Soldatov, 49, sind investigative Journalisten. Ihr Spezialgebiet sind die Operationen des russischen Geheimdienstes. Gemeinsam gründeten sie im Jahr 2000 die Online-Plattform agentura.ru, die über Strukturen, Arbeitsweise und Aktionen der Agenten berichtet. Borogan und Soldatov arbeiteten für kremlkritische Publikationen wie „Echo Moskwy“ und die „Nowaja Gazeta“. Seit fünf Jahren leben sie in London im Exil und unter Polizeischutz. Ihr jüngstes Buch trägt den Titel „Our Dear Friends in Moscow – The Inside Story of a Broken Generation“ (PublicAffairs).
Sie leben schon seit fast fünf Jahren in London im Exil. Mit welchen Gefühlen blicken sie auf Russland?
SOLDATOV: Das sind sehr tief gehende Emotionen. Da gibt es auch deutliche Unterschiede zu den Emigranten aus den Zeiten des Kalten Krieges. Wir haben immer noch engen Kontakt, nicht nur, weil dort Verwandte und Freunde leben. Heute spielen ja Online-Verbindungen eine zentrale Rolle: Wir sprechen jeden Tag mit Leuten in Russland. Vom journalistischen Standpunkt aus gesehen sind diese Möglichkeiten natürlich toll, aber emotional ist das schwierig. Physisch bewegst du dich in London, aber dein Kopf, deine Gedanken sind praktisch ununterbrochen in Russland. Diese emotionale Anspannung lässt einen ermüden.
Ihr Vater, Andrei, sitzt in Russland im Gefängnis. Er ist wegen angeblicher „Amtsanmaßung“ verurteilt worden.
SOLDATOV: Ja, inzwischen seit mehr als einem Jahr. Ich habe keinen direkten Kontakt zu ihm. Er befindet sich derzeit in einem Straflager im Gebiet Rjasan. Er ist ein alter Mann, sein Gesundheitszustand ist ziemlich schlecht. Das belastet mich sehr.
Ich verstehe nicht, warum ich meine Staatsbürgerschaft aufgeben sollte. Das ist ein absurder Gedanke. Ich habe sie nicht von Putin.
Irina Borogan
Gegen Sie selbst hat Russland ein Haftbefehl erlassen. Leben Sie beide in Angst?
SOLDATOV: Wir leben in dem Bewusstsein für das Risiko. Wir stehen in London unter Polizeischutz. Wir bemühen uns immer, daran zu denken, wer was über unsere Lebensweise weiß, mit wem wir uns treffen, wo wir uns treffen. Wir sind sehr aufmerksam, was unsere Kommunikation angeht. Aber ein Risiko bleibt, das wissen wir.
Fühlen Sie, dass der russische Geheimdienst in London Sie im Blick hat?
BOROGAN: Ja, manchmal sind sie ziemlich nahe. Und sie wollen auch, dass wir das merken. Das ist schon sehr unangenehm.
Die deutschen Sicherheitsdienste warnen in letzter Zeit verstärkt vor den Aktivitäten der russischen Geheimdienste. Halten Sie das für übertrieben?
SOLDATOV: Gar nicht, die Gefahren sind real. Und sie sind sogar ernster als zu Zeiten des Kalten Krieges. Die russischen Geheimdienste haben ihre Arbeit verstärkt, weil westliche Staaten nach dem Beginn des vollumfänglichen Krieges gegen die Ukraine 2022 russische Diplomaten in großer Zahl ausgewiesen haben.
Die russischen Dienste müssen deshalb seither auf Leute zurückgreifen, die keinen Diplomatenpass haben. Viele von ihnen sind nicht einmal russische Staatsbürger. Sie werden oftmals auch nur für eine einzige Operation angeheuert, was es erschwert, solche Aktionen aufzudecken.
Befindet sich Deutschland schon mitten in dem „hybriden Krieg“, von dem jetzt so oft die Rede ist?
SOLDATOV: Ich verstehe den Begriff „hybrider Krieg“ nicht so richtig. Der Kreml befindet sich im Krieg gegen den Westen, und er nutzt darin alle Mittel, deren Einsatz er für notwendig hält. Diese Mittel sind um ein Vielfaches aggressiver als alles, was wir vor dem Überfall auf die Ukraine 2014 und dann 2022 gesehen haben.
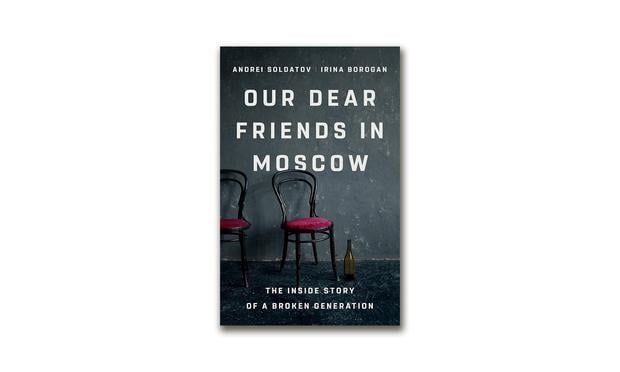 Irina Borogan und Andrei Soldatov – „Our Dear Friends in Moscow, The Inside Story of a Broken Generation“ – PublicAffairs
Irina Borogan und Andrei Soldatov – „Our Dear Friends in Moscow, The Inside Story of a Broken Generation“ – PublicAffairs
© Public Affairs
Was ist für den russischen Geheimdienst in Deutschland besonders interessant?
SOLDATOV: Vor allem sind das die Betriebe der Rüstungsindustrie, wie Rheinmetall. Das ist einer der wichtigsten Lieferanten für die Verteidigung der Ukraine. Wir wissen, dass es Planungen für ein Attentat auf den Vorstandsvorsitzenden gab. Dieses Vorgehen, Sabotage und Attentatsplanungen, gab es beim russischen Geheimdienst früher nicht. Im Kalten Krieg ging es um klassische Spionage, Informationsbeschaffung. Putin verfolgt ein anderes Konzept. Er betrachtet den Krieg gegen die Ukraine als Teil des Krieges gegen den Westen insgesamt. Ihm geht es nicht mehr „nur“ um Spionage, er setzt auch auf Sabotage.
Welche Rolle spielt die russische Diaspora in Deutschland?
BOROGAN: In keinem Fall halte ich eine Hexenjagd für angebracht.
Sie seufzen.
BOROGAN: Die russische Diaspora in Deutschland ist sehr groß, aber die allerwenigsten sind wohl aus politischen Gründen nach Deutschland gekommen. Die Russlanddeutschen sind schon ganz lange dort, etwa zwei Millionen Menschen, wenn ich richtig informiert bin. Mir scheint, dass die meisten von ihnen im Krieg gegen die Ukraine leider die Positionen des Kremls vertreten. Das heißt noch lange nicht, dass sie sich vom russischen Geheimdienst rekrutieren lassen. Das heißt aber auch nicht, dass der Kreml in diesen Kreisen keine Anwerbungen versucht: entweder weil diese Menschen mit dem Kreml sympathisieren oder weil sie Geld brauchen.
Der FSB will sein eigenes, paralleles Lagersystem, das außerhalb jeglicher Kontrolle steht.
Andrei Soldatov
Das Komitee für Staatssicherheit KGB heißt jetzt FSB, aber der berüchtigte Geheimdienst hat den Untergang der Sowjetunion faktisch überlebt. Was ist da in den 90er Jahren schiefgelaufen?
BOROGAN: Dafür ist vor allem Putins Vorgänger Boris Jelzin verantwortlich. Der wusste schon sehr gut, was der KGB ist – und er hat ihn nicht geliebt. Er hatte große Angst, aber noch größere Angst hatte er vor der Kommunistischen Partei Russlands.
Die stellte tatsächlich eine Gefahr für seine Macht dar, besonders als die ökonomischen Reformen scheiterten und die Bevölkerung verarmte. Jelzin fürchtete eine „rote Revanche“. Deshalb hat er nie auf „Säuberungen“ im KGB-Apparat gedrängt. Er hielt es für seine wichtigste Aufgabe, die Kommunisten von der Macht fernzuhalten. Deshalb ging er mit den alten KGB-Kadern sogar ein Bündnis ein. Das ist für mich eine sehr bedrückende Erinnerung.
SOLDATOV: Wir können sogar noch weiter zurückgehen. Es ist inzwischen ziemlich vergessen, dass der KGB die Perestroika von Michail Gorbatschow unterstützt hat. Aus einem ganz einfachen, pragmatischen Grund: Auch die Führung des KGB war außerordentlich unzufrieden mit der Kommunistischen Partei, sie hatten die Kontrolle der Partei satt und wollten sie loswerden.
Deshalb wurde der KGB nicht nur zum Verbündeten von Jelzin, er war es schon für Gorbatschow. Das war eine furchtbare Fehleinschätzung. Das System des KGB war schon zu diesem Zeitpunkt schrecklicher als der Kommunismus. Der war da schon eine tote Idee, wie Sie sich erinnern. Aber den Leuten vom KGB ist es gelungen, den Gedanken zu vermitteln, sie könnten nützlich sein. Im Ergebnis haben wir in Russland Geheimdienste, die völlig außerhalb jeglicher Kontrolle stehen.
Es heißt, jeder Staat habe einen Geheimdienst, aber in Russland habe der Geheimdienst einen Staat.
SOLDATOV: Ja, das hat gar nichts mit Putin zu tun. Sondern das ist schon passiert, bevor Putin an die Macht kam.
Der ehemalige KGB-Offizier Putin soll, als er Präsident wurde, gesagt haben, er habe jetzt „seinen Auftrag“ erfüllt. War das nur einer seiner zynischen Scherze, oder gab es tatsächlich so etwas wie einen KGB-Auftrag für ihn?
SOLDATOV: Es gab tatsächlich eine Versammlung der Führung der Geheimdienste am 20. Dezember 2000, dem „Tag der Tschekisten“. Im vollen Ernst sagte er da in seiner merkwürdigen Diktion, er habe seine Aufgabe, in die Regierung und in den Kreml zu gelangen, erfüllt. Damals hielten das tatsächlich viele für einen Scherz. Putin liebte es, Scherze über seine KGB-Vergangenheit zu machen. Aber leider müssen wir feststellen, dass Putin schon in den ersten zwei, drei Jahren an der Macht viele seiner alten Gefährten in Schlüsselpositionen der Macht gebracht hat.
Sie schreiben, der KGB versuche, das Gulag-System wiederzuerrichten. Was hat es damit auf sich? Die furchtbaren Lager gibt es ja noch, wie wir nicht erst seit dem Tod des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny wissen.
SOLDATOV: Ja, aber sie unterstehen seit den 90er-Jahren nicht mehr dem Geheimdienst, sondern einer speziellen Justizbehörde. Der FSB will dieses System nicht etwa zurück, sondern er will sein eigenes, paralleles Lagersystem, das außerhalb jeglicher Kontrolle steht. In den Gesetzesvorlagen ist vorgesehen, dass der FSB seine Strafverfolgung von den Justizorganen abkoppeln kann, dass er seine eigenen Gerichte haben wird, eigene Transportmittel für den Gefangenentransport und so weiter. Ein absolut geschlossenes System.
Für Ihr gerade erschienenes neuestes Buch „Our Dear Friends in Moscow“ haben Sie lange mit vielen der Freunde gesprochen, mit denen Sie vor einem Vierteljahrhundert Ihre Karriere begonnen haben. Diese Kollegen sind heute an wichtigen Positionen des russischen Propagandaapparates. Eine ist russische Kulturministerin. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Ihre ehemaligen Freunde so willig Putin gefolgt sind?
SOLDATOV: Zunächst: Unsere Freunde sind keine „Verführten“, das sind hochgebildete Leute, denen kannst du nicht einfach „das Hirn vernebeln“. Die bekommen ihre Informationen nicht aus dem Staatsfernsehen, dessen Kreml-Propagandisten beeinflussen ihr Denken nicht. Sie treffen ihre Entscheidungen selbst. In unseren Gesprächen wurde klar, dass ihnen die imperiale Geschichte Russlands sehr nahe ist. Sie sind Imperialisten. Sie treibt ein großes nostalgisches Gefühl. Das war auch schon so, als wir miteinander befreundet waren.
Und das ist es, was Sie trennt?
BOROGAN: Hinzu kommt, dass diese Leute fest davon überzeugt sind, dass Demokratie ein für Russland untaugliches Konzept ist. Das Land lasse sich nur von einem Iwan Grosny, einem Stalin oder einem Putin mit harter Hand und Gewalt regieren. Diese Menschen, die sich selbst zur Elite rechnen, glauben nicht im Geringsten an das russische Volk. Am Ende heißt das für sie als Journalisten: Nicht mit dem Regime zusammenzuarbeiten, bedeutet, gar nicht in Russland arbeiten zu können. Ansonsten machen sie sich sogar strafbar.
Mehr Interviews aus dem Angebot von Tagesspiegel Plus Greifen China und Russland gemeinsam den Westen an? „Ein Atomwaffeneinsatz wäre in letzter Konsequenz nicht mehr auszuschließen“ „Verlogener, heuchlerischer, gaunerhafter Mensch“ Wer ist Putins Chefunterhändler Wladimir Medinski? Initiator von Störaktion gegen Weidels Sommerinterview „Ist Widerstand nur für den Geschichtsunterricht?“
Sie haben einen anderen Weg gewählt. Warum?
SOLDATOV: Für unsere früheren Freunde war es das Wichtigste, dass sie Russen sind. Für uns beide war das Wichtigste, dass wir Journalisten sind. Für uns ging es immer darum: Wie machen wir unsere investigativen Recherchen, wie schreiben wir unsere Bücher? Zunächst haben wir noch für Medien arbeiten können, die Distanz zum Kreml hielten. Aber das ist längst nicht mehr möglich. Wir beide sind der Ansicht, dass wir weiter journalistisch arbeiten müssen. Das ist nur noch aus dem Ausland möglich. In unserem Buch beschreiben wir, wie unsere Freunde dagegen die Grenze zwischen Journalismus und Propaganda und sogar auch der Arbeit für die Sicherheitsdienste ganz seelenruhig überschritten haben.
BOROGAN: Uns hat auch die journalistische Freiheit, die es in unserem Land in den 90er Jahren gab, viel zu sehr gefallen. Unsere Eltern hatten in der Sowjetunion noch in Furcht gelebt, die eigene Meinung laut zu sagen. Aber wir konnten das. Wir sind die erste Generation, die das konnte.
Sie sind immer noch russische Staatsbürger. Warum eigentlich?
SOLDATOV: Es fällt mir nicht ein, meine russische Staatsbürgerschaft Putin zu schenken. Ich bin genauso ein Russe wie Putin. Warum soll ich ihm mein Land überlassen?
BOROGAN: Ich verstehe nicht, warum ich meine Staatsbürgerschaft aufgeben sollte. Das ist ein absurder Gedanke. Ich habe sie nicht von Putin.
