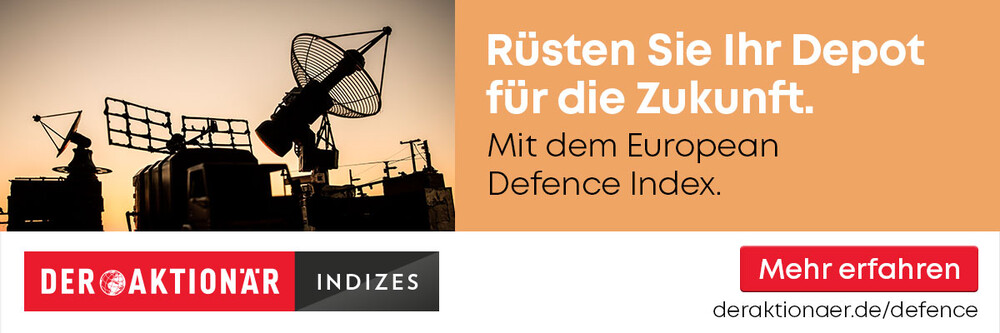Der Konflikt zwischen Donald Trump und Moskau spitzt sich gefährlich zu: Der US-Präsident kündigt an, zwei nuklear bewaffnete U-Boote in Richtung Russland zu verlegen – ausgerechnet als Antwort auf Drohungen von Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew, der auf Telegram ominös mit dem „Dead Hand“-Nuklearsystem prahlt. In Europa schrillen angesichts dieser Eskalation die Alarmglocken. Die Debatte um eigene atomare Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft gewinnt an Fahrt. Droht ein neues Wettrüsten – und wie sollten Anleger reagieren?
In den frühen Morgenstunden des 1. August ließ Donald Trump die Welt wissen, dass er gegenüber Moskau ernst macht.
„Basierend auf den hoch provokativen Äußerungen des ehemaligen Präsidenten Russlands, Dmitri Medwedew, … habe ich angeordnet, zwei nukleare U-Boote in den entsprechenden Regionen zu positionieren, falls diese törichten und aufrührerischen Äußerungen mehr sind als nur Worte“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Er spielte damit auf eine beispiellose Verbalattacke Medwedews an – und reagierte mit der schärfsten nuklearen Säbelrasselung seiner bisherigen Amtszeit. Die Order, US-Atom-U-Boote vor Russlands Küsten in Stellung zu bringen, ist ein klares Signal der Abschreckung und erinnert an tiefste Zeiten des Kalten Krieges.
Trump, der Russland ein Ultimatum von zehn Tagen für einen Waffenstillstand in der Ukraine gestellt hat, begründete seinen Schritt damit, dass „Worte sehr wichtig sind und oft zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen können“ – eine unverhohlene Warnung an Moskau.
Der Auslöser für Trumps dramatische Ankündigung war ein Schlagabtausch mit Dmitri Medwedew. Der ehemalige russische Präsident und jetzige Vize-Chef des Sicherheitsrats hatte Trump zunächst auf X (Twitter) verhöhnt und dessen Ultimatums-Politik als „Schritt in Richtung Krieg“ bezeichnet.
![]()
Medwedew spottete, Trump solle nicht den „Sleepy Joe“-Pfad einschlagen – eine Anspielung auf Trumps Vorgänger Joe Biden.
Dann legte Medwedew auf Telegram nach und spielte die vielleicht gefährlichste Karte: Er erinnerte Trump an „die Gefährlichkeit der sagenumwobenen ‘Toten Hand’“, wie westliche Medien seine Worte übersetzten.
Dabei handelt es sich um ein halbautomatisches nukleares Zweitschlag-System aus Sowjetzeiten, das im Falle eines enthauptenden Erstschlags gegen Moskau automatisch einen atomaren Vergeltungsschlag auslösen könnte.
Medwedew implizierte, Russland würde im Ernstfall nicht zögern, dieses apokalyptische Arsenal einzusetzen – selbst wenn niemand in Moskau mehr übrig wäre, um den Befehl zu geben.
„Wenn ein paar Worte des ehemaligen Präsidenten Russlands eine derart nervöse Reaktion beim selbstherrlichen US-Präsidenten auslösen, dann ist Russland vollkommen im Recht und wird seinen eigenen Weg weitergehen“, höhnte Medwedew in seinem Post.
Trump konterte prompt und nannte Medwedew einen „gescheiterten Ex-Präsidenten, der aufpassen soll, was er sagt“ – denn er begebe sich auf „sehr gefährliches Terrain“.
Das Ergebnis dieser giftigen Rhetorik: zwei amerikanische Atom-U-Boote, deren Präsenz vor Russlands Haustür nun für neuen Zündstoff sorgt.
Europas Alarm
Die transatlantischen Bündnispartner beobachten die nukleare Eskalation mit wachsender Besorgnis. In Europas Hauptstädten stellt man sich die bange Frage: Wie weit wird dieses Kräftemessen gehen – und sind wir ausreichend gewappnet? Offizielle Verurteilungen blieben zwar bislang aus, doch hinter verschlossenen Türen dürften die Sicherheitsberater rotiert haben. Vor allem Medwedews unverhohlene Drohung mit einem Atomschlag alarmiert Europas Strategen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bereits im Frühjahr vor einer realen Gefahr für Europa gewarnt und angeregt, den französischen „nuklearen Schirm“ mit den europäischen Partnern zu teilen.
Paris signalisiert damit Bereitschaft, notfalls die Rolle des atomaren Schutzpatrons für Europa zu übernehmen – ein Tabubruch, der in Moskau scharf als „nukleare Erpressung“ kritisiert wurde.
Doch Macrons Vorstoß zeigt: Die Diskussion über eine eigenständige europäische Abschreckung ist neu entfacht. Schließlich verfügen in Europa mit Frankreich und Großbritannien nur zwei Staaten über eigene Atomwaffen – und London ist nach dem Brexit außen vor. Sollte das Vertrauen in den US-Schutzschild unter Trump weiter erodieren, könnte eine „europäische Bombe“ vom Schreckgespenst zur ernsthaften Option avancieren, so das Kalkül mancher Sicherheitsexperten. Auch die konventionelle Verteidigungsbereitschaft rückt ins Rampenlicht. In Berlin betont man, man werde die Ukraine trotz aller Drohungen weiter unterstützen – jüngst wurden etwa zusätzliche Patriot-Luftabwehrsysteme zugesagt, um Kiew gegen russische Raketenangriffe zu schützen.
Osteuropäische NATO-Staaten wie Polen und die baltischen Republiken dürften angesichts Medwedews Kriegsrhetorik ihre Bereitschaft zur Landes- und Bündnisverteidigung weiter hochfahren. Die Nervosität ist spürbar: Trumps abrupte Kehrtwendungen in der US-Ukraine-Politik – mal Strafzölle gegen Russland und dessen Handelspartner wie Indien, mal Drohungen in Richtung Moskau – sorgen in europäischen Hauptstädten für Unbehagen und schüren die Angst, Washington könnte sich langfristig von Europa abwenden.
Die aktuelle Zuspitzung bestätigt jene Befürchtungen, denn sie unterstreicht, wie schnell die transatlantische Sicherheitsarchitektur ins Wanken geraten kann, wenn im Weißen Haus ein Hardliner am Werk ist. Als Lehre aus dem Eklat dürften europäische Regierungen noch entschlossener an ihrer militärischen Eigenständigkeit arbeiten – von der Aufstockung der Verteidigungshaushalte bis zur besseren Abstimmung der Rüstungsprojekte innerhalb der EU.
Profiteure der Krise
An den Aktienmärkten sorgt die neue Ost-West-Konfrontation für Bewegung – insbesondere die Werte der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie rücken in den Fokus der Anleger. Erfahrungsgemäß treiben geopolitische Spannungen die Rüstungsaktien an, und auch diesmal zeichnet sich ein ähnliches Muster ab. Schon in den vergangenen Monaten kannten viele Rüstungstitel nur eine Richtung: weiter nach oben. Als Ende Juli klar wurde, dass Trumps harte Linie einen schnellen Frieden in der Ukraine in weite Ferne rücken lässt, schoss der Sektor förmlich durch die Decke. Die Rally der Rüstungsaktien setzte sich fort: Rheinmetall, Renk, Hensoldt und Co markierten neue Rekordhochs, und der European Defence Index ging steil.
European Defence Index
(WKN: SL0QG5)
Dieses Branchenbarometer repräsentiert die wichtigsten europäischen Verteidigungs- und Sicherheitskonzerne. Enthalten sind unter anderem Branchengrößen wie BAE Systems, Rheinmetall, Thales, Leonardo oder Hensoldt, aber auch Spezialisten aus dem Luft- und Raumfahrtbereich wie Rolls-Royce, Saab oder Airbus. Der Index bietet damit einen breit diversifizierten Querschnitt der europäischen Rüstungsindustrie.
Und die Entwicklung kann sich sehen lassen. Getrieben durch die massiven Aufrüstungspakete nach dem Ukraine-Krieg und die anhaltend hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat der European Defence Index in diesem Jahr kräftig zugelegt. Von rund 90 Punkten vor einem Jahr kletterte der Index bis auf zeitweise über 130 Punkte im Frühsommer – ein Zugewinn von fast 45 Prozent. Aktuell notiert der Index nach leichten Gewinnmitnahmen um 120 Punkte und damit weiterhin deutlich höher als noch zu Jahresbeginn.
Foto: Börsenmedien AG
Zum Vergleich: Der breite europäische Aktienmarkt (STOXX Europe 600) liegt im selben Zeitraum nur einstellig im Plus. Die Outperformance der Rüstungsbranche spiegelt die Erwartung wider, dass Europas Verteidigungskonzerne auf Jahre gut gefüllte Auftragsbücher haben werden. Tatsächlich berichten Firmen wie Rheinmetall oder BAE Systems von einem regelrechten Bestellboom seit Beginn der russischen Invasion – Panzer, Munition, Radare, Flugabwehr: Alles ist gefragt.
Auch die politischen Weichenstellungen sprechen für anhaltend hohe Rüstungsausgaben. Allein Deutschland investiert 100 Milliarden Euro Sondervermögen in die Bundeswehr, Frankreich stockt sein Militärbudget ebenfalls deutlich auf, und quer durch Europa wurden die Verteidigungsetats nach Jahrzehnten des Sparkurses kräftig erhöht.
Für sicherheitsnahe Unternehmen bedeutet das goldene Zeiten. Die Börse hat dies antizipiert: Rüstungstitel gelten inzwischen als „Neue Aktienstars“, die in vielen Depots als strategische Beimischung für Krisenzeiten dienen.
Solange harte Töne wie die von Trump und Medwedew dominieren, bleibt Europas Rüstungsindustrie in einer komfortablen Lage. Die jüngste Eskalation hat dies eindrucksvoll vor Augen geführt. Bleibt die Frage, ob die Mächtigen zur Vernunft kommen – oder ob das Säbelrasseln am Ende tatsächlich in reale Konflikte umschlägt. Für die Börse wäre letzteres ein Horror-Szenario, selbst wenn Rüstungsaktien kurzfristig profitieren. Entspannung jedoch käme allen zugute – dem Weltfrieden ebenso wie den Märkten.
Hinweis auf Interessenkonflikte:
Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinba-rung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.