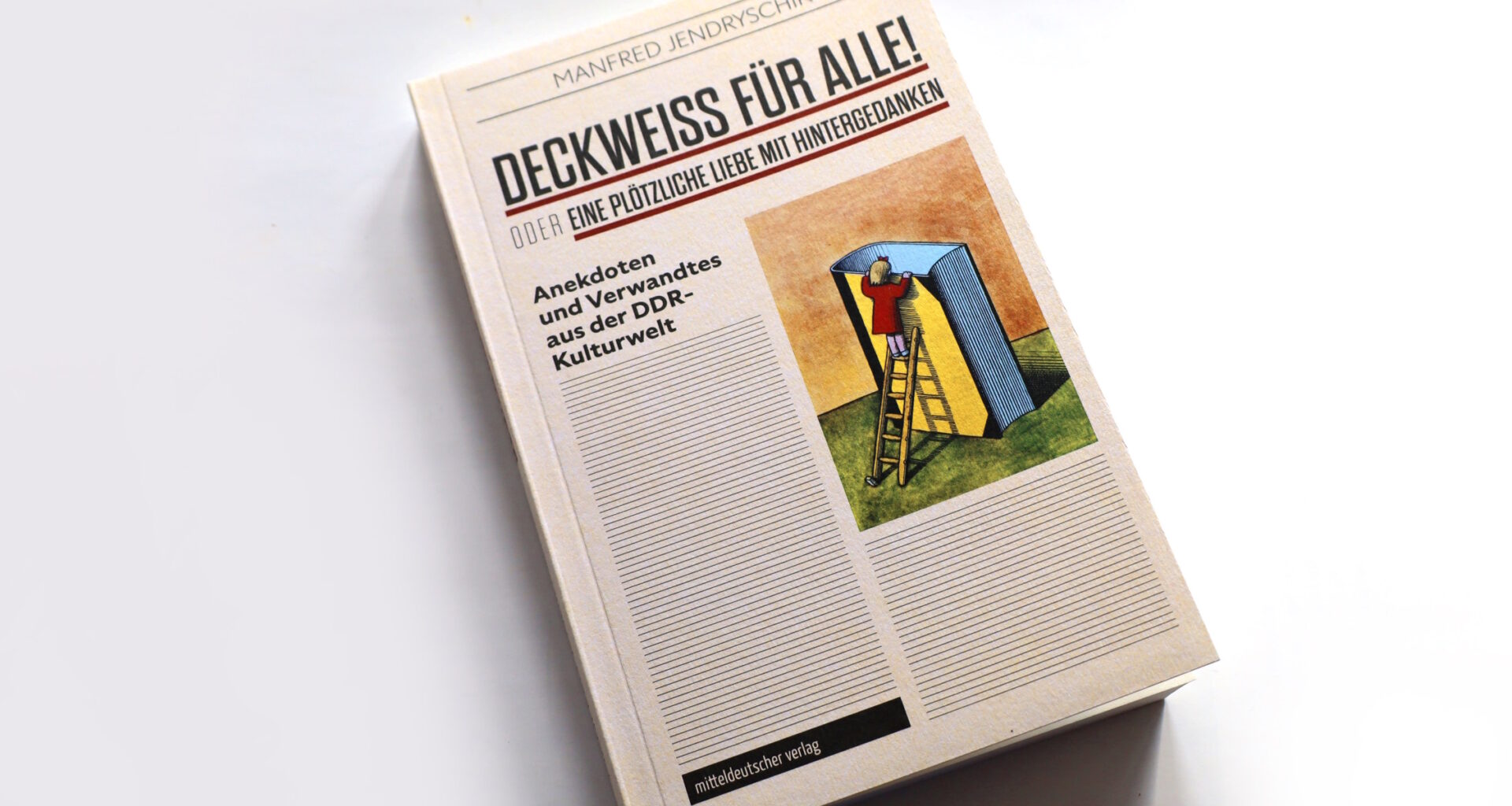Am Ende ging es ihm wie Trude Richter, deren vollständige Memoiren zwei Jahrzehnte lang in der DDR nicht erscheinen durften. Und als es dann 1989 endlich so weit war, dass der Verlag das Buch in Druck geben konnte, starb sie, auch wenn sie zumindest noch erfuhr, dass ihr Buch endlich erscheinen würde. Und auch Manfred Jendryschik war sogar noch dabei, als sein neuestes Buch in die Druckerei geschafft wurde. Die Veröffentlichung erlebte er dann nicht mehr.
Am 18. Juni verstarb er mit 82 Jahren in Leipzig. Dem Mitteldeutschen Verlag war er seit Jahrzehnten sowieso aufs engste verbunden. Der Verlag meldete dann auch seinen Tod kurz vor Erscheinen des Buches: „Der Mitteldeutsche Verlag trauert um seinen Autor Manfred Jendryschik, der am vergangenen Mittwoch in Leipzig verstarb. Er wurde 1943 in Dessau geboren und debütierte nach einem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte in Rostock 1967 mit dem Erzählband ‚Glas und Ahorn‘.
Er wurde Verlagslektor in Halle und publizierte Geschichten, Romane, Essays und Reisebriefe, von 1990 bis 1996 war er dann Kulturdezernent in Dessau. In den Jahren danach veröffentlichte er auch illustrierte Bücher mit Karl-Georg Hirsch, Jusche Fret und Uwe Pfeifer. Sein letztes Buch erscheint Ende Juli: ‚Deckweiß für alle! oder Eine plötzliche Liebe mit Hintergedanken. Anekdoten und Verwandtes aus der DDR-Kulturwelt‘ und versammelt kuriose Anekdoten und bitterböse Episoden. Es ist ein ironisch getönter Abschied von der DDR und aus einem bis in die letzten Tage gestalteten Künstlerleben.“
Tatsächlich war er von 1967 bis 1976 Lektor im Mitteldeutschen Verlag, bevor er freier Schriftsteller wurde. Eins seiner Steckenpferde war immer die Miniatur. Die kleine feine Form der Prosa, die auch schon mal zur Anekdote gerinnen konnte.
Im Container
Trude Richters Memoirenbuch „Totgesagt“ erschien übrigens 1990 ebenfalls im Mitteldeutschen Verlag. Nur war 1990 das denkbar schlechteste Jahr für so eine Publikation. In den 20 Jahren davor hätte es im kleinen Kosmos DDR Furore gemacht, weil es auch Trude Richters Zeit im sowjetischen Gulag beschreibt. Aber 1990 geriet es in die Wirren der Währungsunion – so wie der größte Teil der Buchproduktion in der scheidenden DDR: Die meisten Titel – unter denen hunderte waren, die zuvor keine Druckgenehmigung bekommen hatten – wurden verklappt und makuliert. Man könnte es auch so sagen: Der wohl spannendste Bücherjahrgang der DDR landete im Container.
Um die DDR geht es auch in Jendryschiks letzten Buch. Er hat gesammelt und aufbewahrt. Oder einfach ein Gedächtnis wie ein Elefant gehabt. Denn was er in diesem Band als Miniaturen versammelt, sind all die kleinen Anekdoten, Schrägheiten, Erlebnisse, die die Funktionsweise das Ländchens DDR sichtbar machen – die Engstirnigkeit der Funktionäre, die wilden Exzesse der Zensur, den peinlichen Umgang mit widerspenstigen Köpfen.
Zu denen in gewisser Weise auch Jendryschik gehörte, der sich selbst nie als Dissident begriff oder gar ans Ausreisen dachte. Man sieht so ein parteilich verwaltetes Ländchen mit anderen Augen, wenn man – und da war Jendryschik nicht der einzige – die Verheißungen, Hoffnungen und Versprechungen ernst nahm, mit denen dieses Experiment Sozialismus gestartet war.
Es war ja nicht nur die überzeugte Komministin Trude Richter, die sich von ihren Genossen den Mund verbieten lassen musste. Andere Genossen verbogen sich, versuchten irgendwie den Spagat zwischen ihrem Wissen und den Zumutungen der allwaltenden Partei und sturer Apparatschiks hinzubekommen, die letztlich nur duldeten, was ihren „Kurs“ und ihre Vorstellung vom einzig richtigen Sozialismus bestätigte.
Also Ja-Sager-Literatur. Und einige der hartgesottenen Typen, die sich diesen Ansprüchen beugten, kommen im Buch natürlich auch vor – anekdotisch aufgespießt wie etwa Otto Gotsche oder der Nationalpreisdichter Kuba. Und auch Erik Neutsch bekommt sein Fett weg.
Hinter der Fassade
Es ist auch der Blick der Schriftstellerkollegen, der hier auf die schreibende Zunft und ihre Verrenkungen schaut, mit der sich einige der Berühmten und Gepriesenen versuchten, immer wieder den Empfindlichkeiten der „führenden Genossen“ anzupassen. Manchmal bis zum Kotau. Manchmal auch mit dem kleinen Mut des Widerspruchs, in dem ein wenig von Luthers „Ich kann nicht anders“ steckte.
Denn das, was in der DDR als Sozialismus betrieben wurde, hatte schon einiges von einer Religion. In der sich dann die „führenden Genossen“ auch gern als Päpste und Bischöfe zelebrierten und feiern ließen. Einige der geübten Kultformen in ihren satirischen Auswüchsen hat Jendryschik natürlich auch aufgespießt.
Es sind alles lauter kleine Szenen und Ereignisse, wie sie „damals“ mit Augenzwinkern oft und reichlich in geselligen Runden erzählt wurden. Auch und gerade in litertarisch interessierten Kreisen. Denn letztlich kannte irgendwie jeder jeden. Und auch wenn dergleichen nicht in der Zeitung stand, verbreitete es sich mündlich nur allzu schnell. Es war der Stoff, mit dem eine lähmende Wirklichkeit zu ertragen war. Und eine falsche Fassade wenigstens mit „Hast du schon gehört“ ein wenig demoliert werden konnte. Denn wo eine verkniffene Macht versucht, mit Zensur das Unerwünschte ungesagt sein zu lassen, blühen die Witze, Anekdoten und Eulenspiegeleien.
Und nichts macht schneller die Runde als ein neues Stück Erlebnis mit den Großen und Allmächtigen. Die sich dann bei genauerem Hinschauen als sprachlos, fantasielos, verbohrt und verkarstet erweisen. Ein bis zur Unfähigkeit erstarrter Machtapparat, in dem sich die Untertanen am Ende nicht mehr wundern, wenn sie in den allmächtigen Genossen keinen Ansprechpartner mehr finden, sondern an ruppigen Sprüchen und leeren Wortkaskaden abprallen.
Auf Linie
Und so lernt man mit Jendryschik noch einmal ein Land kennen, in dem die Macht sich in kafkaesken Schlössern verschanzt hat, in dem kleine Karrieristen sich benehmen wie Könige und Opportunisten mit und ohne Parteiabzeichen allerlei Abzeichen, Orden, Ämtern und Ehrungen hinterherhecheln, ohne zu merken, wie schäbig ihre Anbiederung nach außen wirkt.
Natürlich spielen Autoren, Lektoren, Verleger und die zugehörigen stellvertretenden Minister die Hauptrolle in Jendryschiks Miniaturen. Manche hat er selbst begleitet als Lektor. Er hat selbst erlebt, wie „die Partei“ immer wieder in die Arbeit des Mitteldeutschen Verlages hineinregierte, die Leitung auswechselte, wenn sie meinte, der Verlag wäre nicht mehr auf „Linie“, unliebsame Autoren am langen Arm der Zensur verhungern ließ oder die Bücher ihrer parteitreuen Autoren durchdrückte um jeden Preis.
Denn das Volk sollte ja lesen, was die Partei für richtig hielt. Auch wenn das dann Berge unverkäuflicher Druckware wurden, über denen den Buchverkäufern vor Entsetzen die Haare zu Berge standen.
Jendryschik erzählt von kleinen und großen Sekretären, von Kuhhändeln, mit denen „die Partei“ sich ihre Vorzeigeautoren zurechtschmiedete – und ihnen damit das einzige nahm, was diese wirklich befähigte, gute Literatur zu schreiben. Werner Bräunig ist so ein Fall. Aber es gibt auch einige Anekdoten aus der sozialistischen Produktion, dem ganzen irren Versuch, ein zentral verwaltetes Land, bei dem Planzahlen und Produktion nie übereinstimmten, irgendwie am Laufen zu halten.
Und in einigen Miniaturen wird auch die Zeit nach 1990 sichtbar und die erste Zeit Jendryschiks als Kulturdezernent in Dessau. Eine Zeit, in der dann ja auch publik wurde, wer da über wen heimlich Berichte geliefert hatte. Manche gezwungen, manche aus Überzeugung. Manche gekauft.
Und in gewisser Weise war auch Jendryschik überrascht, wie ihn der allwaltende Staatssicherheitsdienst zum Beobachtungsobjekt gemacht hatte und 1.500 Seiten über ihn im Vorgang „Federkiel“ gesammelt hatte. Da fragt sich nicht nur Jendryschik, ob nicht auch diese exzessive Überwachung aller „aufrührerischen“ Vorgänge im Land mit dazu beigetragen hat, das Land wirtschaftlich in den Ruin zu treiben.
Ein bisschen Feudalismus
Nicht alle „Helden“ in seinen so emsig gesammelten Miniaturen hat er mit Namen benannt. Einige tauchen nur als Buchstabe auf, möglicherweise heute noch für einige Betroffene erkennbar. Aber in künftigen Ausgaben wäre dazu wohl ein Register fällig, das auch diese Namen entschlüsselt. Auch weil sie unbedingt dazu gehören, die Verschrobenheit des Landes und seiner Nomenklatura sichtbar zu machen.
Aber man merkt eben auch, wie alle diese kleinen Szenen und Anekdoten dabei halfen, die Hierarchien des „vormundschaftlichen Staates“ sichtbarer zu machen. Denn es gab sie. Jeder wusste es. So manch ein in Ungnade gefallener Funktionär merkte erst bei der Ankunft in der Provinz, wie viele Privilegien seine Funktion vorher mit sich gebracht hatte.
Ein Meer von Geschichten über die Jagdreviere, Sonderzuteilungen und Urlaubsdomizile der Funktionäre wogte durchs Land. Das letztlich deutlich feudale Züge trug. Auch in der Abgehobenheit und Abschottung der Mächtigen, für die dann bei einem Stadtbesuch auch schnell mal die Erdgeschosse der maroden Häuser neu bemalt wurden. Man wollte ja dem hohen Besuch ein blühendes Land zeigen.
Und so machten irgendwie alle allen etwas vor. Und nicht nur das Literatenvölkchen in Halle hatte seinen Spaß beim abendlichen Erzählen immer neuer Anekdoten über die knurrige Obrigkeit.
Auch die Geschichte vom Protestplakat mit der Forderung „Deckweiß für alle!“ erzählt Jendryschik natürlich. Ein kleiner Farbtupfer aus der Welt der Kunst, die genauso in gewollte und ungewollte, honorierte und unhonorierte, staatstragende und „gefährliche“ geschieden war wie die Literatur. Manchmal half dann wirklich nur das gemeinsame Lachen abends bei fließendem Rotwein, in trauter Runde. Auch wenn keiner wusste, wer noch alles mithörte, wenn man sich die kleinen, bissigen Wahrheiten über die Regierenden und ihre getreuen Vasallen erzählte.
Eine Welt aus Phrasen
Jendryschik jedenfalls hat das alles nicht vergessen und erzählt es, als wäre es noch ganz frisch. Als hätte er noch einiges abzumachen gehabt mit diesem Ländchen und seinen Amtsträgern. Und vielleicht ist das auch so. Manches bleibt unfertig. Auch, weil Geschichte nicht einfach endet, wenn der Letzte im Land das Licht ausmacht. Denn nachher haben noch einige der einst Berühmten ihre Memoiren geschrieben, in denen sie wieder ihre eigenen Versionen vom Geschehenen darboten.
Welche Geschichte stimmt den nun? Wen trügt denn eigentlich die Erinnerung? Dass man sich auch täuschen kann, ist Jendryschik nur zu bewusst gewesen. In einer Geschichte zu Johannes Bobrowski schildert er das. Aber auch Berühmtheiten wie Brecht und Weigel bekommen ihr Plätzchen. Schön dialektisch, wie sich das gehört. Beide auch im Anekdotenschatz der DDR schon lange Legende.
Und so gar nicht passend zur grauen, papierenen Funktionärswelt, die das ganze Land bis zum Schluss mit Phrasen und Sprechblasen füllte, von denen selbst die Redner wussten, dass es nur Phrasen waren. Leeres Gerede mit revolutionärem Pathos, das kein Ziel und keinen Inhalt mehr hatte. Nur auf dem WC redeten dann die Herren Funktionäre mal Klartext. Da, wo keiner mitschrieb und nachfragte: Wie hast du denn das gemeint, Genosse?
So gesehen ist hier ein Stück DDR wieder sichtbar, das die meisten schon lange vergessen haben. Das aber fortlebt auch in der Gemütslage vieler, die in diesem Ländchen aufgewachsen sind. Die das verinnerlicht haben und den Zeitpunkt verpasst haben, über all da Lächerliche und Theatralische und Hohle einmal ausgiebig zu lachen, bis die Tränen kommen. Hier ist jetzt die Gelegenheit dazu, das nachzuholen. Auch wenn der Verlag das Buch ohne beigelegte Taschentücherpackung verkauft.
Manfred Jendryschik „Deckweiß für alle!“, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2025, 24 Euro.