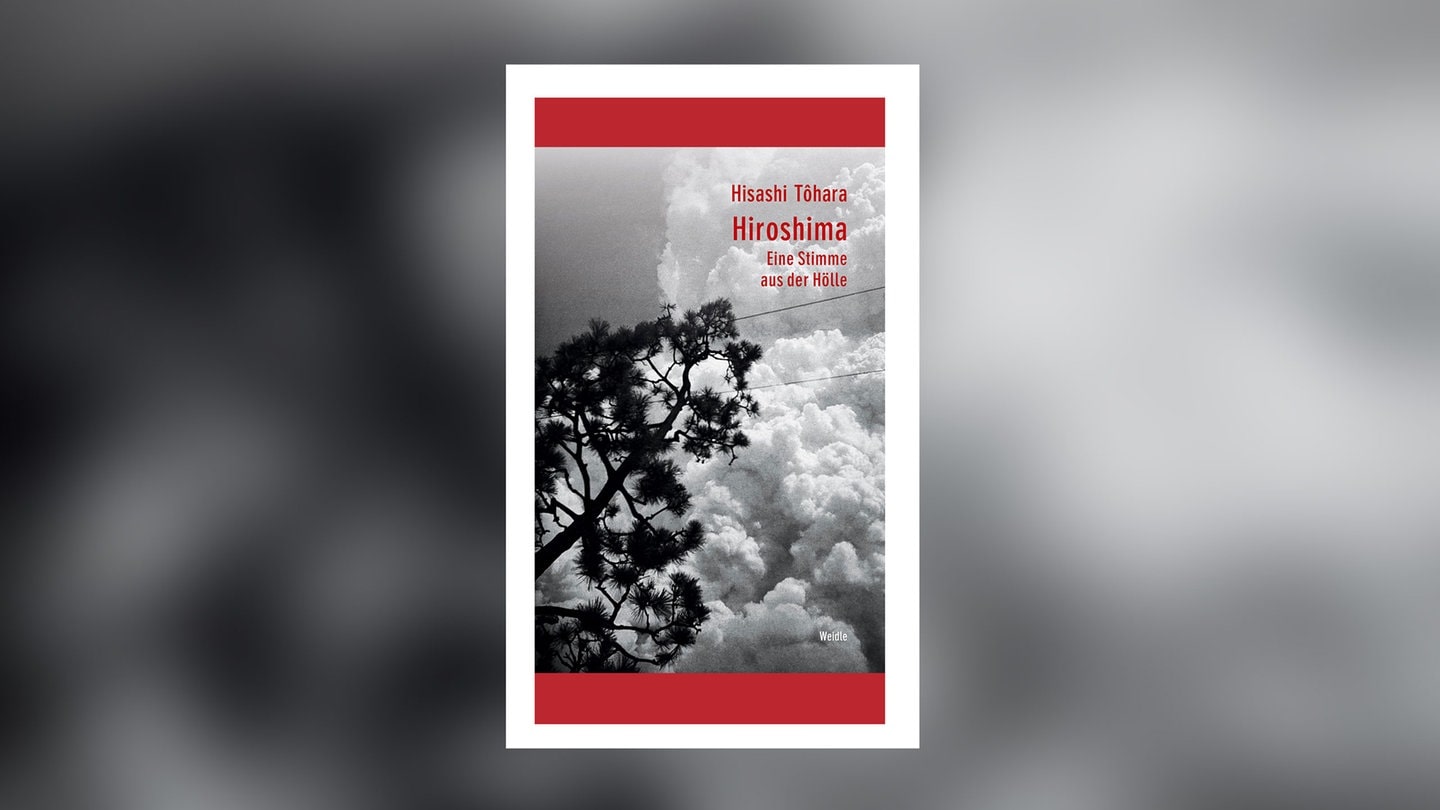Ein Jahr nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima schrieb der damals 19-jährige Schüler Hisashi Tôhara seine Erinnerungen an diesen Tag in „Hiroshima. Eine Stimme aus der Hölle“ auf.
Es gibt Zeitdokumente, die nicht altern. Die Erinnerungen des Japaners Hisashi Tôhara an den Abwurf der Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 sind ein solches Zeitdokument.
Erst jetzt, zum achtzigsten Jahrestag des Bombenangriffs, sind Tôharas Erinnerungen zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen. Diese Aufzeichnungen zeigen, wie tief und nachhaltig die von den USA entwickelte Atombombe auf das Leben der Japaner einwirkte.
Im Sommer 1945 ist der Autor Hisashi Tôhara ein 18-jähriger Teenager, voller Stolz auf seinen neuen Status als Oberschüler, den er sich als „übermenschliches Wesen“ vorstellt, „ein von der Gemeinheit gewöhnlicher Menschen enthobener Held“. Dieses Ideal wird die Atombombe zerstören.
Eine neue Form der Kriegsführung
Die unfassbare Katastrophe trifft die Stadt Hiroshima an einem wolkenlosen Sommermorgen um 8:15 Uhr buchstäblich aus heiterem Himmel.
Hisashi Tôhara sitzt an diesem schicksalhaften Montagmorgen mit einem Schulkameraden im Zug, weil er zu seiner evakuierten Familie in ein Dorf bei Hiroshima fahren will.
Die Schilderung der unbeschwerten Unterhaltung zwischen den beiden Schülern lässt die ungeheure Fallhöhe des Absturzes aus dem Alltag erahnen. Plötzlich scheint die Welt einen Sprung zu machen.
Mit einem Mal wurde es um mich herum so hell, dass die Augen geblendet waren. Zeitgleich mit einem Grollen, als würde die Erde sich bewegen, spürte ich einen brennenden Schmerz im Nacken. Eine Überschwemmung von Licht, es fließt über und flutet Himmel und Erde und bricht als Sturzflut aus dem Fenster hinter mir herein.
Der Krieg zwischen den USA und Japan dauerte zu diesem Zeitpunkt bereits über drei Jahre. Feindliche Flugzeuge und die Bombardierung Tokios sind dem Autor durchaus bekannt. Dass der Einsatz einer Atombombe eine vollkommen neue, unvorstellbare Dimension von kriegerischer Auseinandersetzung bedeutet, machen die Erinnerungen des 19-jährigen Autors auf erschreckende Weise deutlich.
Was passiert gerade? Eine Zugstörung? Kaum, dass ich das hatte denken können, verschwand schlagartig das Licht und tiefschwarzer Rauch umhüllte alles. Als der Rauch sich langsam verzog, fand ich mich auf der Straße wieder. Die umgebenden Häuser waren alle platt zusammengefallen. Ich fühlte mich, als wäre ich in ein völlig fremdes Land gekommen.
Leben nach der Atombombe
„Eine Stimme aus der Hölle“ ist der Untertitel dieser Aufzeichnungen, der die gespenstische Flucht der beiden Schüler durch das tobende Flammeninferno Hiroshimas beschreibt. Hisashi Tôhara überlebte diese Flucht denkbar knapp. Seine Vorstellungen von Mitmenschlichkeit und Moral traten immer stärker in Konflikt mit seinem Selbsterhaltungstrieb.
Hiroshima. Eine Stimme aus der Hölle
Aus dem Japanischen von Daniel Jurjew und Anika Koide
![]()
Hisashi Tôhara – Hiroshima. Eine Stimme aus der Hölle
Dem ersten Hilferuf einer verzweifelten Mutter, deren Kind unter Haustrümmern eingeklemmt war, folgte er noch und verurteilte die Verantwortungslosigkeit seines fliehenden Schulkameraden. Aber seine Todesangst inmitten des Flammenmeeres überwältigte ihn zunehmend.
Ich hörte die Stimme eines Mannes, »Hilfe!«, » Hilfe!«, von einem eingestürzten Haus links. Trotz starker Gewissensbisse hielt ich nicht einmal an. Sogar jetzt leide ich immer noch unter schweren Schuldgefühlen. Ich kann meinen traurigen Selbsthass nicht unterdrücken, wenn mir bewusst wird, dass die Haltung, die in solchen Momenten zum Vorschein kommt, mein wirkliches, unverfälschtes Wesen ist.
Der Schrecken Hiroshimas, sagt der Historiker Patrick Boucheron, beruht auf zwei unvereinbaren Zeiterfahrungen: Der Plötzlichkeit des Augenblicks und der Endlosigkeit des Sterbens, das in gewisser Weise bis heute andauert.
Die gut lesbare Übersetzung macht die Aufzeichnungen des jungen Hisashi Tôhara auch zu einer empfehlenswerten Schullektüre. Wie kriegsentscheidend der Einsatz der Atombombe wirklich war und ob dadurch weitere Kriegsopfer verhindert wurden, halten Historiker heute für zweifelhaft.