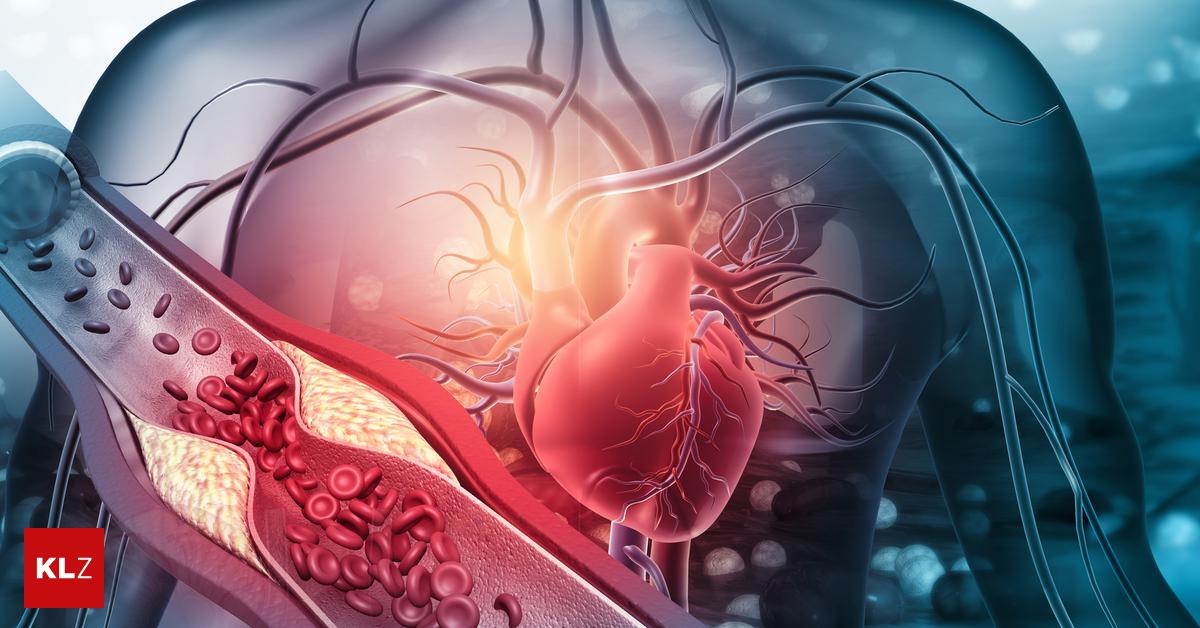Die Daten aus den USA sind eindrücklich: Eine aktuelle Untersuchung zeigt dort, dass die moderne Kardiologie dabei ist, einen weitgehenden Sieg über den Herzinfarkt davonzutragen. Innerhalb von 50 Jahren konnte die Sterberate durch einen Herzinfarkt in den USA nämlich um 90 Prozent gesenkt werden. „Ja, diese Entwicklung sehen wir auch in Europa“, sagt Markus Wallner, Kardiologe an der MedUni Graz/ LKH-Uniklinik Graz. Moderne medizinische Möglichkeiten, bessere und neue Medikamente sowie sinkende Raucherraten haben das möglich gemacht. Allerdings sagt Wallner auch: „Leider sehen wir gerade jetzt, dass die Fortschritte in einigen Ländern stagnieren oder sich sogar umkehren.“

Markus Wallner, Kardiologe der MedUni Graz
© Klz / Nicolas Galani
Doch zunächst zu den guten Nachrichten: „Auch für Europa zeigen Studien, dass die Herzinfarkt-Sterblichkeit seit 1995 um 50 bis 70 Prozent zurückgegangen ist“, sagt Wallner. Gründe dafür gibt es mehrere, entscheidend war sicher der technologische Fortschritt in der Behandlung des akuten Herzinfarkts.
Herzinfarkt: Zeit ist Muskel
Dieses Video könnte Sie auch interessieren
„Zeit ist Muskel“ lautet der Leitspruch in der Herzinfarkt-Behandlung. Das bedeutet: Je schneller der Verschluss des Herzkranzgefäßes wieder geöffnet wird, desto geringer der Schaden am Herzmuskel. Bei einem typischen Herzinfarkt passiert nämlich Folgendes: Ein sogenannter Plaque, also eine Verkalkung im Gefäß bricht auf. Dies löst ein Blutgerinnsel aus, das das Gefäß ganz oder teilweise verschließen kann. So kommt es zum akuten Verschluss einer Herzkranzarterie, einem Herzinfarkt. „Alles Gewebe, das hinter diesem Verschluss liegt, beginnt abzusterben“, sagt Wallner. Daher gilt: den Verschluss so schnell wie möglich zu öffnen. Zwischen der Diagnose Herzinfarkt und der Behandlung mittels Herzkatheter sollten nicht mehr als 120 Minuten liegen – besser noch sind 90 Minuten, sagt Wallner. Ist es nicht möglich, eine Patientin, einen Patienten in dieser Zeit zum Herzkatheter zu bringen, wird versucht, das Blutgerinnsel mittels Medikamenten, der sogenannten Lyse, aufzulösen.
Herzkatheter als Revolution
Das Jahr 1977 markierte den großen Durchbruch in der Kardiologie, als Andreas Grüntzig in Zürich erstmals eine hochgradige Engstelle in einem Herzkranzgefäß mittels eines winzigen Ballons wieder aufdehnte. Heute werden solche Herzkatheter-Eingriffe in den meisten Fällen über die Gefäße am Handgelenk durchgeführt. Die Entwicklung und Einführung von Stents, die die Gefäße dauerhaft offen halten, markierte eine weitere Revolution in der Herzmedizin.
„Aber auch die Medikamente zur Blutverdünnung und Statine, die das erhöhte Cholesterin senken, haben ihren Anteil daran, dass es nach einem Herzinfarkt viel seltener zu einem weiteren Infarkt kommt“, sagt Wallner – durch Medikamente sind Risikofaktoren fürs Herz, wie hoher Blutdruck oder hohe Blutfette viel besser behandelbar geworden. Gerade beim „schlechten“ LDL-Cholesterin sammle sich das Risiko über das ganze Leben an: Je länger diese Werte zu hoch sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Herz-Kreislauf-Erkrankung kommt. Ein weiterer massiver Faktor: Rauchverbote und der damit verbundene Rückgang des Rauchens.
Doch leider zeigen die Zahlen auch ein alarmierendes Bild: „In den neuesten Studien sehen wir, dass sich der positive Effekt in einigen Ländern umkehrt und die Sterblichkeit durch Herz-Erkrankungen wieder ansteigt“, sagt Wallner. Der Hauptgrund dafür: das wachsende Übergewicht und die damit verbundenen Erkrankungen, wie Bluthochdruck und Diabetes. „Das ist ein Riesenproblem“, sagt Wallner: Die vergangenen 40 Jahre waren in der Herzmedizin sehr erfolgreich, doch nun droht die „Übergewicht-Epidemie“ diese Erfolge zunichtezumachen.
Immer mehr Fälle von Herzschwäche
Ein weiterer Effekt aus den Erfolgen der Kardiologie: Immer mehr Menschen überleben den Herzinfarkt, leiden in der Folge aber an Herzschwäche (medizinisch: Herzinsuffizienz). „Zwei Drittel aller Herzschwäche-Fälle treten nach einem Herzinfarkt auf“, sagt Experte Wallner und erklärt dazu: Durch den Gefäßverschluss kommt es zu Schäden am Herzmuskel, eine „Narbe“ entsteht und das Herz verliert dadurch an Pumpkraft. Die Herzschwäche kann zwar behandelt werden, bleibt aber eine chronische Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht.
Das spiegelt die weltweite Entwicklung wider: Während immer mehr Menschen einen Herzinfarkt überleben, steigt die Sterblichkeit durch andere Herzerkrankungen wie Herzschwäche oder Herzrhythmusstörungen. Und bei allen Erfolgen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind noch immer die häufigste Todesursache in Österreich, sie sind für ein Drittel aller Sterbefälle verantwortlich. Wallner fügt an: „Einen Herzinfarkt zu erleben, ist noch immer eine lebensbedrohliche Situation, Patienten berichten häufig von einem Vernichtungsschmerz.“
Den Schrecken verliert der Herzinfarkt also nicht, er ist nur viel besser behandelbar geworden.