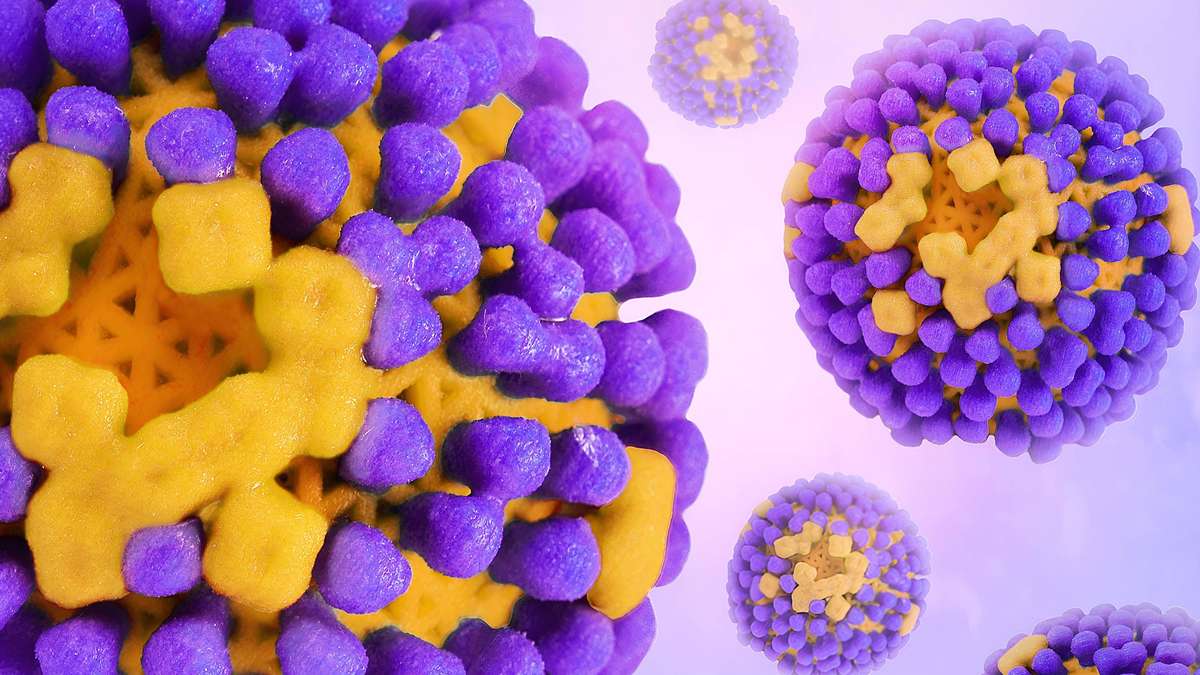DruckenTeilen
Influenza und Covid-19 beeinflussen laut einer US-Studie möglicherweise die Bildung von Metastasen nach einer überstandenen Krebserkrankung.
Frankfurt – Eine Infektion mit dem Grippe- oder dem Coronavirus kann nach durchgemachter Krebserkrankung möglicherweise „schlafende“ Tumorzellen in der Lunge aufwecken und dazu führen, dass sich dort Metastasen bilden. Diese Theorie stellt ein Team mehrerer großer US-Universitäten am Beispiel von Brustkrebs nach Versuchen mit Mäusen und Analysen humaner Gesundheitsdaten aus einem US-amerikanischen Krebsregister und der britischen Biobank auf. Die Studie wurde vergangene Woche im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Bei Expertinnen und Experten aus dem deutschsprachigen Raum stoßen die Schlussfolgerungen der US-Forschenden auf geteiltes Echo.
Auch nach einer überstandenen Krebserkrankung und erfolgreicher Therapie können im Körper noch verstreute Tumorzellen vorhanden sein und in einem inaktiven Zustand verharren – oft jahrelang, manchmal sogar jahrzehntelang. Es bedeutet: Diese bösartigen Zellen teilen und vermehren sich nicht. Das Tückische jedoch: Die „Schläfer“ in anderen Organen und Geweben sind oft schwer zu finden, können aber wieder aktiv werden und Metastasen bilden. Brustkrebs zum Beispiel kann zu Tochtergeschwülsten in Lymphknoten, Knochen, Lunge und Leber führen. Warum schlafende Zellen plötzlich aufwachen und zur Bedrohung werden, ist noch nicht in Gänze erforscht, eine wichtige Rolle können Vorgänge im umliegenden Gewebe spielen.
Welchen Einfluss haben Influenza-A-Viren oder Sars-CoV-2 auf schlafende Tumorzellen?
Die US-Forschenden haben gezielt den Einfluss einer Infektion mit Influenza-A-Viren oder Sars-CoV-2 auf schlafende, ursprünglich von einem Brustkrebs stammende Tumorzellen in den Lungen von Mäusen untersucht. Der Gedanke dahinter: Beide Atemwegsinfektionen lösen Entzündungen im Körper aus. Die Wissenschaftler:innen wollten überprüfen, ob das dazu beitragen kann, Schläferzellen zu aktivieren – denn wie man heute weiß, sind Entzündungsmechanismen auch bei der Metastasierung (und oft auch an der Entstehung von Krebs) beteiligt.
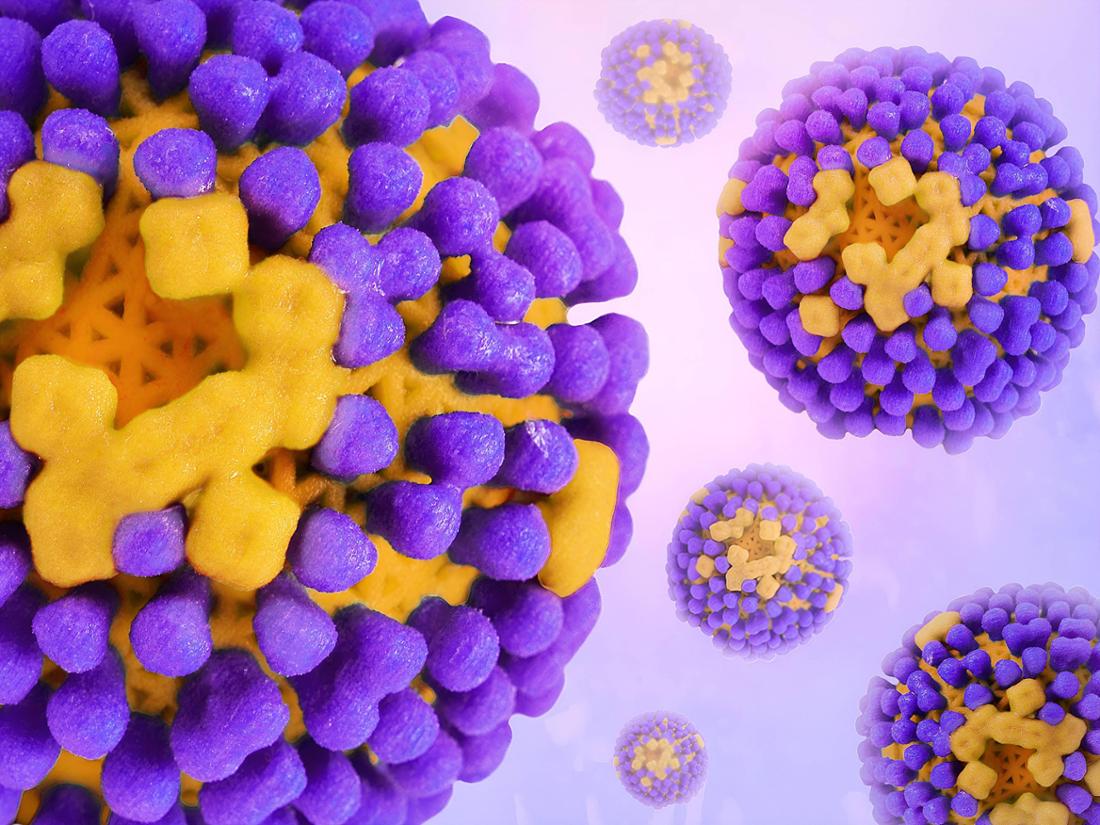 Influenza A-Viren in einer 3D-Darstellung. © Imago Images
Influenza A-Viren in einer 3D-Darstellung. © Imago Images
Dafür nutzten die Forschenden genetisch veränderte Tiere, die zum Teil anfällig für HER2-positiven Brustkrebs waren, dessen Zellen in andere Organe streuten und dort bis zu einem Jahr in einem schlafenden Zustand blieben, bei einigen Mäusen noch länger. HER2 ist ein Protein, das auf der Oberfläche von Brustkrebszellen vorkommt und als Rezeptor für Wachstumsfaktoren fungiert. Rund 15 bis 20 Prozent aller Brustkrebserkrankungen sind HER2-positiv.
Auswirkung einer Grippe-Erkrankung waren stärker als bei Corona
Die Ergebnisse waren besonders frappierend bei einer Grippe-Erkrankung der Mäuse und die Auswirkungen stärker als bei Sars-CoV-2: Zwischen dem dritten und dem 15. Tag nach der Infektion mit dem Influenza-A-Virus stellten die Forschenden eine hundert- bis tausendfache Erhöhung der Belastung mit Metastasen im Lungengewebe der Mäuse fest. Die zuvor schlafenden Tumorzellen präsentierten sich in einem aktiveren Zustand und fingen an, sich zu teilen – begünstigt durch Interleukin 6, einen Entzündungsmarker aus der Familie der Zytokine, der von weißen Blutkörperchen des Immunsystems direkt am Ort einer Entzündung freigesetzt wird.
Auch nachdem die Influenza abgeklungen war, blieben die Tumorzellen in einem aktiveren Zustand. Die Belastung war nach neun Monaten noch auf dem gleichen Niveau wie am 15. Tag der Infektion. Eine wichtige Rolle dabei spielten T-Helferzellen, eine spezielle Art weißer Blutkörperchen, die in diesem Fall bremsend auf die Abwehr wirkten: Sie hemmten Killerzellen, die sich sonst gegen die Tumorzellen gerichtet hätten.
Ebenfalls in die Studie eingeflossen sind menschliche Gesundheitsdaten aus dem Brustkrebs-Register der US-amerikanischen Firma Flaticon Health und der UK-Biobank. Die Analyse der britischen Daten ergab, dass Menschen, die mindestens zehn Jahre vor Beginn der Corona-Pandemie eine Krebsdiagnose erhalten hatten und zu Beginn der Pandemie bis Ende 2021 positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren, häufiger an ihrer Erkrankung starben als nicht mit dem Virus infizierte Tumorpatientinnen. Allerdings: Bezogen auf den gesamten Zeitraum der Pandemie bis Ende 2022 war kein signifikanter Unterschied zu erkennen.
Erhöhen Infektionen mit Atemwegsviren das Risiko eines Krebsrückfalls?
Die Ergebnisse aus dem US-Brustkrebsregister mit den Daten von knapp 37.000 Frauen wiederum zeigten, dass an Covid-19 erkrankte Brustkrebspatientinnen eine höhere Wahrscheinlichkeit für Lungenmetastasen hatten. Für Influenza liegen keine entsprechenden Daten vor, da es für diese Infektion keine breitangelegten Testungen gab wie bei Corona.
Die Versuche und Analysen der Studie zeigten, „wie Infektionen mit Atemwegsviren das Risiko eines Krebsrückfalls erhöhen können“, schreiben die Forschenden. Die Ergebnisse unterstrichen „die Notwendigkeit, Strategien in der Klinik und in öffentlichen Gesundheitssystemen“ zu entwickeln, um die Gefahr der Metastasierung im Zusammenhang mit Atemwegsinfekten einzudämmen.
„Wichtige Erklärung für erhöhte Covid-19-Mortalität bei Krebspatienten“
Der Immunologe Andreas Bergthaler von der Medizinischen Universität Wien misst den Erkenntnissen eine „potenziell große klinische Relevanz“ bei, wie er dem Science Media Center sagte. Die Studie zeige einen „kausalen Zusammenhang“ und beschreibe einen „direkten Mechanismus“, wie Infektionen mit Atemwegsviren über entzündliche Botenstoffe und Immunzellen ruhende Krebszellen reaktivieren und Metastasen begünstigen können. Zudem liefere sie „eine wichtige Erklärung für die erhöhte Covid-19-Mortalität bei Krebspatienten“.
Eine Schwäche der Studie sieht der Immunologe Carsten Watzl vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund darin, dass die epidemiologischen Daten aus der Frühphase der Pandemie stammen, als es noch keine Impfungen gab und die Omikron-Variante noch nicht in Umlauf war, die für weniger schwere Verläufe sorgte als der ursprüngliche Wuhan-Stamm. „Durch eine Impfung wird das Risiko einer schweren Erkrankung und damit einer ausgeprägten Entzündungsreaktion nach einer Influenza- oder Sars-CoV-2-Infektion deutlich reduziert“, erklärt der Immunologe. Weniger Entzündung könnte entsprechend auch mit weniger Metastasenbildung verbunden sein. Das zu untersuchen, solle Gegenstand künftiger Studien sein, sagt Watzl.
Generell zeige die aktuelle Arbeit, dass Atemwegsinfektionen neben dem akuten Effekt auf die Lungen „auch noch andere weitreichende Effekte haben“ – unter anderem sei auch das Risiko für Herzinfarkt erhöht. „Daher sollte man diese Infektionen ernst nehmen und sich durch verfügbare Impfungen gegen die Erkrankung und hoffentlich auch gegen die Sekundärfolgen schützen.“
Epidemiologe äußert sich skeptisch über die Studie
Bei Tierversuchen stellt sich stets die Frage, inwieweit die Ergebnisse auch auf den Menschen zutreffen. Der Onkologe Hellmut Augustin von der Universitätsmedizin Mannheim und dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg sagt dazu: „Die Übertragbarkeit biologischer Mechanismen und Prinzipien ist sehr hoch“. Ein im Mausexperiment identifizierter physiologischer oder pathologischer Mechanismus sei „in aller Regel genauso im Menschen aktiv“. Das gelte „sicherlich auch für die Befunde dieser Studie“.
Der Epidemiologe André Karch von der Universität Münster hingegen äußert sich skeptisch über die aktuelle Arbeit, spricht von möglichen Verzerrungen. Er räumt zwar ein, dass Infektionen den Verlauf einer „bestehenden aktiven Krebserkrankung negativ beeinflussen“. Aber im Fall der für die Studie herangezogenen Daten erscheine es „plausibel“, dass die Influenza- und Sars-CoV-2-Infektionen nicht die „Ursache eines Rezidivs der Krebserkrankungen“ seien, sondern die Folge eines vorher nicht erkannten Rezidivs und einer damit einhergehenden Schwächung des Immunsystems.
„Dies würde einer umgekehrten Kausalität bei der Interpretation der Ergebnisse entsprechen und könnte die Ergebnisse vollumfänglich erklären“, sagt Karch. Auch sei es „sehr gut vorstellbar“, dass die Patientinnen an „Komorbiditäten“ – Begleiterkrankungen – gestorben seien und ihr Tod dann dem Krebs zugeschrieben worden sei. „Aus meiner Sicht erlauben die in der Publikation berichteten epidemiologischen Analysen – aus den genannten Gründen – damit die gezogenen Schlussfolgerungen nicht“, so Karch. Um die Hypothese der Autorinnen und -autoren untermauern zu können, wären „deutlich anspruchsvollere Analysen“ notwendig. (pam)