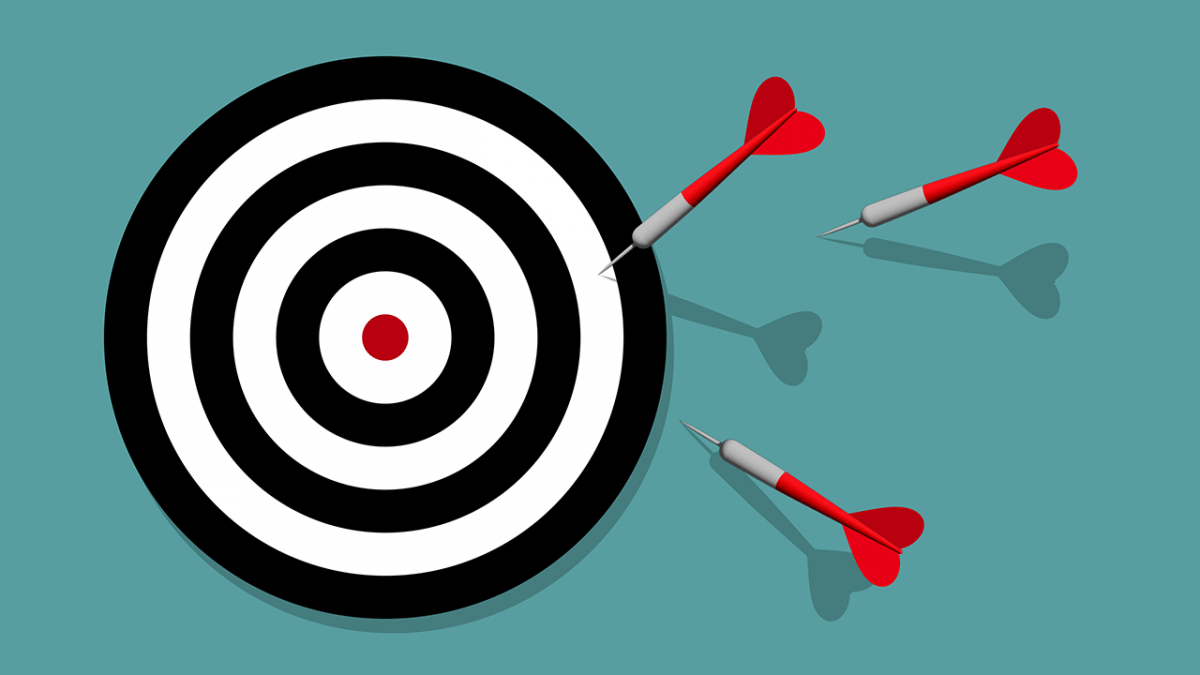23. August 2025
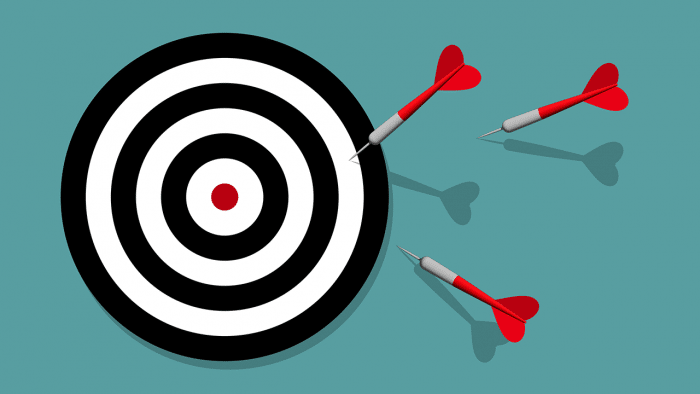
Warum heutige Romane von Krisen, Abstürzen und Fehltritten erzählen – und was das über unsere Gesellschaft verrät.
Die Literatur des Scheiterns erfreut sich wachsender Beliebtheit. Der Altmeister des Scheiterns, Michel Houellebecq, wurde selbst von Progressiven und Linken gelesen, obwohl er aus seiner mitunter eher reaktionären Haltung keinen Hehl macht. In den letzten Jahren sind neue Literaten nachgerückt.
Daniel Schreiber erzählt sein knapp vermiedenes Scheitern an Depression und Alkohol in sanfteren Worten und, im Gegensatz zu Houellebecq, politisch durchweg „korrekt“. Dass er als erfolgreicher Autor offensichtlich am Ende nicht scheitert, sondern Trunk und Depression überwindet, bietet dem Identifikationsbedürfnis des Lesers ein weiches Kissen.
Obendrein sinnt Schreiber auch noch in Venedig über den Untergang der Stadt und des Ökosystems Erde nach. Das macht sicher mehr Spaß als selbiges in Essen oder Wolfsburg zu tun.
Vom Bildungsroman zu den Fuck-up-Partys
Nora Weinelt hat mit ihrem Buch „Figuren des Versagens“ eine Literaturgeschichte des Scheiterns und Versagens vorgelegt und den Unterschied zwischen den beiden herausgestellt. In ihrer Systematik wären Daniel Schreibers Krisen keine Zustände eines Versagers, sondern lediglich vorübergehendes Scheitern eines ansonsten gelungenen Lebens.
Die kalifornische Ideologie und ihre lokalen Ableger haben diese Form des vorübergehenden Scheiterns sogar zum passablen Karrierepfad erkoren. Auf „Fuck Up Parties“ erzählen IT-Pioniere aus der Startup-Szene von ihren gescheiterten Projekten, die schließlich nachträglich zu notwendigen Prüfungen auf dem richtigen Weg zum Erfolg gedeutet werden.
Von diesem Phänomen geht Weinelts Buch aus und schlägt einen großen Bogen vom Bildungsroman des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
Obdachlos in Paris
Den großen aktuellen Roman des zeitgenössischen Versagers hat laut Weinelt Virginie Despentes mit dem Leben des Vernon Subutex geschrieben. Der coole Mittdreißiger in Paris lebt das flotte Bohèmeleben mit Kunst und Musik, billiger Wohnung und geringem Einkommen.
Das heißt – das wollte er, so wie Generationen vor ihm. Doch Paris ist nicht das Berlin der 1990er-Jahre. Vernon landet schließlich auf der Straße, denn die billige Wohnung als Hauptzutat des bohèmistischen Ökosystems ist in Paris nicht mehr nur auf der Roten Liste, sondern ausgestorben.
In Frankreich und in der englischen Übersetzung war der Roman erfolgreich, blieb aber in Deutschland wenig beachtet. Dem Autor dieses Beitrags zumindest war Subutex‘ Kampf mit der Wohnungssuche zu nah am eigenen Leben.
Was die typischen deutschen Leser, zu denen er sich hier auch zählt, gerne lesen, sind soziobiografische Romane des Scheiterns in Lebensphasen, und das am besten weit weg. Die „Rückkehr nach Reims“ (Didier Eribon) und „Wer hat meinen Vater getötet?“ (Édouard Louis) waren auch diesseits des Rheins erfolgreich, wohl eben, weil sie einen größeren Abstand lassen.
Die Autoren ihrer Autobiografien sind im Gegensatz zu Subutex nur phasenweise gescheitert, vornehmlich in Kindheit und Adoleszenz. Subutex hingegen wird schließlich „ein Versager“ in den Augen der anderen. Er wird obdachlos, verlässt Paris und fingiert seinen eigenen Tod, um sich dem Blick und Urteil der Mitmenschen zu entziehen, was Nora Weinelt als einen Moment der Selbstermächtigung würdigt.
Subutex bricht aus der vorgeschriebenen Bahn des Scheiterns aus, in dem er es weder schafft noch scheitert, sondern sich den Konventionen entzieht. Ein Entziehen aus dem System, das Kafka seinen Helden im „Schloss“ nicht zugestanden hat.
Die Konventionen sind das Curriculum Vitae eines „gelungenen“ Lebenslaufes. Doch was ist gelungen?
Von Goethe bis Silicon Valley: Die Ästhetik des Scheiterns
Nora Weinelt zeigt die Entwicklung von Goethes großem Bildungsroman, Wilhelm Meisters Wanderjahre, über den satirischen Antibildungsroman seines Zeitgenossen Gustave Flauberts (L’Éducation sentimentale, deutsch zuletzt von Elisabeth Edl übersetzt mit „Lehrjahre der Männlichkeit„, der sich wohl über Goethe ein wenig lustig machte) bis zum kalifornischen Topos des „schöner Scheiterns“ und Daniel Schreibers Scheitern auf hohem Niveau.
Damit Scheitern schön gewesen sein kann, ist man am Ende am besten Professor für Literatur in Paris (Eribon) oder IT-Milliardär (Steve Jobs).
Im Vergleich der Literaturen im englischen, französischen, italienischen Sprachraum zeigen sich unterschiedliche Vorlieben. Im Deutschen ist trotz Kafka heute nur wenig Toleranz für Scheitern, eben in der Version des goldenen Käfigs. Im englischen Sprachraum hatte „Ein Tag im Leben des Abdul Salama“ von Nathan Thrall einen gewissen Erfolg.
Der Held des Romans stirbt am Ende in der von Mauern und Zäunen zerstückelten Welt des Westjordanlandes und nichts ist gut. In Deutschland blieb das Buch trotz Lesungen von Deborah Feldman im letzten Sommer unbeachtet. Möglicherweise liegt das daran, dass die Hauptfigur ein Palästinenser ist. Wie Berlin Review jüngst berichtete, werde Literatur aus Palästina von Germanistik und Verlagen in Deutschland hauptsächlich ignoriert.
Mehr zu LiteraturMehr anzeigenWeniger anzeigen
Wenn Helden in Romanen scheitern, dann sind es Männer, was lange literarisch begründet ist. Kurt Cobaine und viele andere Musiker sind die neueren Varianten. In Frankreich ist Annie Ernaux höchst erfolgreich mit ihren Romanen geworden, die alle derselben Matrix folgen. Sie entblößt ihr Versagen als Jugendliche und junge Frau an einer glücklichen oder auch nur irgendwie freudvollen Sexualität.
Das erste Mal, die erste Ehe, das erste Kind und das zweite auch, alles missrät und das Missraten wird unter dem Mikroskop ausgebreitet, mit einer Freude am Scheitern. In Frankreich ist das so beliebt, dass von Ernaux 22 autobiografischen Romanen vier verfilmt und fast alle als Theaterstücke adaptiert wurden.
Haben wir auf dieser Seite des Rheins einen Trend verpasst?
Wie Nora Weinelt zeigt, hat sich seit dem Bildungsroman ein Genre des Scheiterns etabliert, in dem Lebenswege vorgegeben werden. Der typische Protagonist war anfangs immer ein junger Mann und scheiterte am Bildungssystem.
Ein Typus von Mensch und die Zuschreibung als „Versager“ wurde daraus im Deutschen, Italienischen und Französischen erst in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg.
Erstmals erwähnt wurde der Typus „Versager“ von Sigmund Freud, jedoch dies nur en passant und auf sexuelles Versagen bezogen. Versager waren auch Kafkas Protagonisten im Schloss. Selbst richtig zu Scheitern war ihnen versagt, denn die Kategorien von Erfolg oder Scheitern erwiesen sich als so verwaschen, dass die zu erfüllende Aufgabe immer undeutlich blieb. So ähnlich, wie ein online-Formular nie sagt, warum der Weiter-Klick nicht geht, er geht eben nicht, und schuld bist immer nur Du.
Die Scham über die vermeintliche Schuld an der gescheiterten Biografie abzuschütteln, ist das erklärte Ziel von Annie Ernaux. Ein Topos, den sie Flauberts Antihelden Frederic aus der „Éducation sentimentale“ entlehnt, nur eben als Frau.
Warum Erfolgsgeschichten so weh tun
Das Erfreuliche an der Erforschung des Scheiterns und Versagens ist die Verkleinerung der eigenen Schmerzen. Wenn hingegen Deutschland Radio Kultur die Karrierestationen einer virtuosen Musikerin herunterbetet, kommt der Verfasser nicht umhin, sich klein, unfähig und irgendwie schuldig zu fühlen: „Warum bin ich nicht vom Stipendium in Tokio nach Mailand und zur hoch bezahlten Stelle in Berlin gehüpft, wo es ja so einfach zu sein scheint?“
Die Vertraulichkeit zwischen Radiosprecher, Musikerin und vermeintlich meiner Person zieht mich in diesen Kreis des Vergleichens. Wie erfrischend plump ist dagegen die Frau, die im Café in ihr Telefon brüllt, dass sie jetzt den „Break-even“ genommen hätten und sie sich alle siebentausend im Monat zahlen. Ein Blick genügt, um zu wissen, dass fast alle im Cafe sie für diesen Moment hassen.
Von Nora Weinelt sind zwei Bücher zu diesem Thema erschienen. Das dünne Büchlein „Versagen“, verlegt bei Matthes und Seitz, ist ein kleiner Einstieg, der an zwei Abenden durchgelesen ist. Das wesentlich dickere Buch „Figuren des Versagens: Poetik eines sozialen Urteils“, verlegt bei De Gruyter, ist eine abwechslungsreiche Forschungsreise in die Literaturgeschichte des Scheiterns und Versagens und sehr zu empfehlen.
Nora Weinelt, Figuren des Versagens: Poetik eines sozialen Urteils, in der Reihe „undisziplinierte Bücher“, de Gruyter 2024.
Nora Weinelt, Versagen, Matthes und Seitz, Berlin 2025.