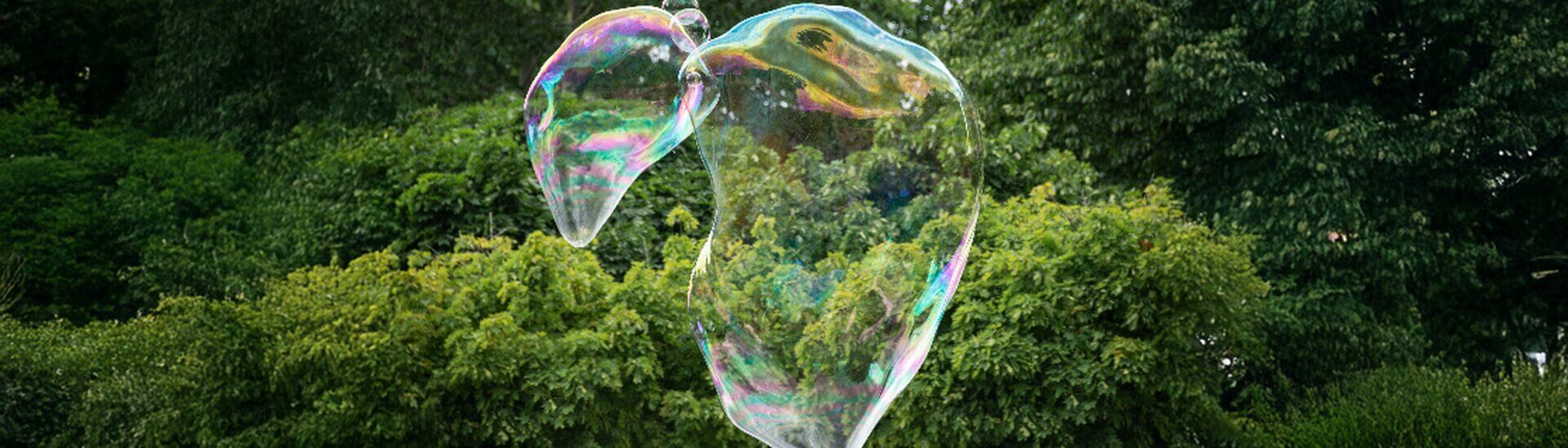Auf den ersten Blick hat die Blase nicht viel mit dem Herzen zu tun – doch jetzt zeigt sich: Harnwegsinfekte steigern das kardiovaskuläre Risiko akut. Warum es sich lohnt, hier genau hinzuschauen.
Bei der Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen spielen sowohl beeinflussbare als auch nicht beeinflussbare Risikofaktoren eine Rolle. Während genetische Dispositionen und Alter nicht modifiziert werden können, lassen sich bestimmte Verhaltensweisen gezielt verändern, um das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse zu senken. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Infektionskrankheiten als potenziell modifizierbare Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse betrachtet werden sollten. Insbesondere akute Infektionen wie Influenza stehen im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Myokardinfarkte.
Studien (hier und hier) konnten zeigen, dass das kardiovaskuläre Risiko in den ersten Tagen bis Wochen nach einer Infektion signifikant erhöht sein kann. Eine kürzlich veröffentlichte Studie, erschienen im The British Medical Journal, untersucht, ob auch mikrobiologisch bestätigte Harnwegsinfektionen (HWI) ein vergleichbares Risiko darstellen.
HWI trifft Herz & Hirn
In die Studie wurden Einwohner aus Wales über 30 Jahre mit dem Nachweis einer Krankenhausaufnahme aufgrund eines Myokardinfarkts oder Schlaganfalls und dem Nachweis einer mikrobiologisch bestätigten HWI im Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2020 eingeschlossen. Der primäre Endpunkt der Studie war das Auftreten eines akuten Myokardinfarkts oder eines Schlaganfalls. Zur Identifikation wurden stationäre Diagnosen herangezogen. Diese basierten auf der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD). Die entsprechenden Daten wurden der Patientenepisoden-Datenbank für Wales entnommen. Das Forscherteam um Reeve verwendete die Poisson-Regressionsanalyse, um Inzidenzratios und 95 Prozent-Konfidenzintervalle für einen Myokardinfarkt und einen Schlaganfall während vordefinierter Risikoperioden im Vergleich zu Basisperioden zu ermitteln.
Während des Studienzeitraums wurden 51.660 Personen aufgrund eines Myokardinfarkts stationär aufgenommen. Von diesen Personen hatten 2.320 (4,5 Prozent) 3.900 mikrobiologisch bestätigte HWIs. Die Herzinfarkt-Fälle waren zu 63 Prozent männlich. Das Alter betrug im Median 77 Jahre (25. bis 75. Perzentil 66–85 Jahre) für Frauen und 69 Jahre (25. bis 75. Perzentil 59–78 Jahre) für Männer.

Du kennst die Schwächen unseres Gesundheitssystems aus dem Alltag – und genau deshalb bist du gefragt! Was muss sich jetzt ändern?
Zur Umfrage
Außerdem wurden 58.150 Personen aufgrund eines Schlaganfalls stationär aufgenommen, von denen 2.840 (4,9 Prozent) 4.600 mikrobiologisch bestätigte HWIs hatten. Bei den Schlaganfall-Fällen waren 49 Prozent männlich, die Frauen waren im Median 79 Jahre alte (25. bis 75. Perzentil 69–87 Jahre). Das Alter der Männer betrug im Median 74 Jahre (25. bis 75. Perzentil 64–82 Jahre).
Es gab 120 Myokardinfarkte während der Risikoperioden und 2.190 während der Basisperioden, mit einem erhöhten Risiko für einen Infarkt in den ersten 7 Tagen nach einer HWI (IRR 2,49, 95% CI (1,65 bis 3,77)). Es gab keinen statistisch signifikanten Anstieg des Risikos 8–14 Tage nach einer HWI, jedoch einen weiteren Zeitraum mit erhöhtem Risiko während der 15–28 Tage nach einer HWI (adjustierte IRR 1,60, 95% CI 1,10–2,33). Zudem traten 200 Schlaganfälle während der Risikoperioden und 2.640 während der Basisperioden, mit einem erhöhten Risiko für einen Schlaganfall in den ersten 7 Tagen nach einer HWI auf (IRR 2,34, 95% CI (1,61 bis 3,40)). Es gab keinen statistisch signifikanten Anstieg des Risikos 8–28 Tage nach einer Harnwegsinfektion, aber einen weiteren Zeitraum mit erhöhtem Risiko während 29–90 Tage nach der HWI (adjustierte IRR 1,26, 95 % CI 1,05 bis 1,52).
Studie braucht Nachschärfung
Eine Stärke der Studie sind die hohen Einschlusszahlen. Allerdings handelt es sich um eine epidemiologische Studie mit einem Self-Controlled-Case-Series-Design. Es besteht somit Bedarf an weiterführenden Untersuchungen, um die Ursachen besser zu verstehen und mögliche vorbeugende Maßnahmen in der Primärversorgung zu entwickeln. Zudem ist die zeitliche Nähe der HWI-Diagnose zum tatsächlichen Infektionsbeginn nicht ganz klar, was die Risikobewertung und die Eingrenzung der Risikoperiode beeinflussen könnte.
Die Datenlage im Hinblick auf einer HWI im Zusammenhang mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko ist spärlich. In einer im Jahr 2004 im New England Journal publizierten Studie wurden 20.486 Personen mit einem ersten Myokardinfarkt und 19.063 Personen mit einem ersten Schlaganfall, die eine Influenza-Impfung erhalten hatten, in die Analyse einbezogen. In der Auswertung war das Risiko für einen Myokardinfarkt oder einen Schlaganfall nach einer Influenza-, Tetanus- oder Pneumokokkenimpfung nicht erhöht. Die Risiken beider Ereignisse waren jedoch nach einer Diagnose einer systemischen Atemwegserkrankung erheblich höher und erreichten während der ersten drei Tage ihren Höhepunkt.
Die Risiken waren ebenfalls nach einer Diagnose einer HWI erhöht, jedoch in geringerem Maße als bei den Atemwegsinfekten. Auch wenn diese Studie einen anderen Schwerpunkt hatte als die Arbeit von Reeve et al. konnte der Zusammenhang zwischen einem kardiovaskulären Ereignis und einer HWI mit ebenfalls einem besonders erhöhten Risiko in den ersten Tagen belegt werden. Das erhöhte Risiko für einen Myokardinfarkt in dem Zeitraum nach einer HWI belegte auch eine dänische Kohortenstudie. Die höchsten relativen Raten wurden in den ersten 30 Tagen nach einer HWI festgestellt (HR 2.44 (95% CI 2.21-2.70)).
Fazit
Zusammenfassend liefern die Ergebnisse der Studie wichtige Hinweise darauf, dass mikrobiologisch bestätigte Harnwegsinfektionen mit einem kurzfristig erhöhten Risiko für Myokardinfarkt und Schlaganfall assoziiert sind. Diese Beobachtung unterstützt die Annahme, dass akute Infektionen als potenzielle Auslöser kardiovaskulärer Ereignisse in der Prävention stärker berücksichtigt werden sollten. Es sind jedoch wie so oft weitere Studien notwendig, um die zugrunde liegenden Mechanismen zu klären und mögliche präventive Interventionsstrategien zu entwickeln.
de Boer et al.: Influenza Infection and Acute Myocardial Infarction. NEJM Evid., 2024. doi: 10.1056/EVIDoa2300361
Reeve et al.: Risk of myocardial infarction and stroke following microbiologically confirmed urinary tract infection: a self-controlled case series study using linked electronic health data. BMJ Open, 2025.
doi: 10.1136/bmjopen-2024-097754
Smeeth et al.: Risk of myocardial infarction and stroke after acute infection or vaccination. N Engl J Med, 2004. doi: 10.1056/NEJMoa041747
Juelstorp Pedersen et al.: Severe infections as risk factors for acute myocardial infarction: a nationwide, Danish cohort study from 1987 to 2018. European Journal of Preventive Cardiology, 2024. doi: 10.1093/eurjpc/zwae344
Bildquelle: Ramin Karbassi, Unsplash