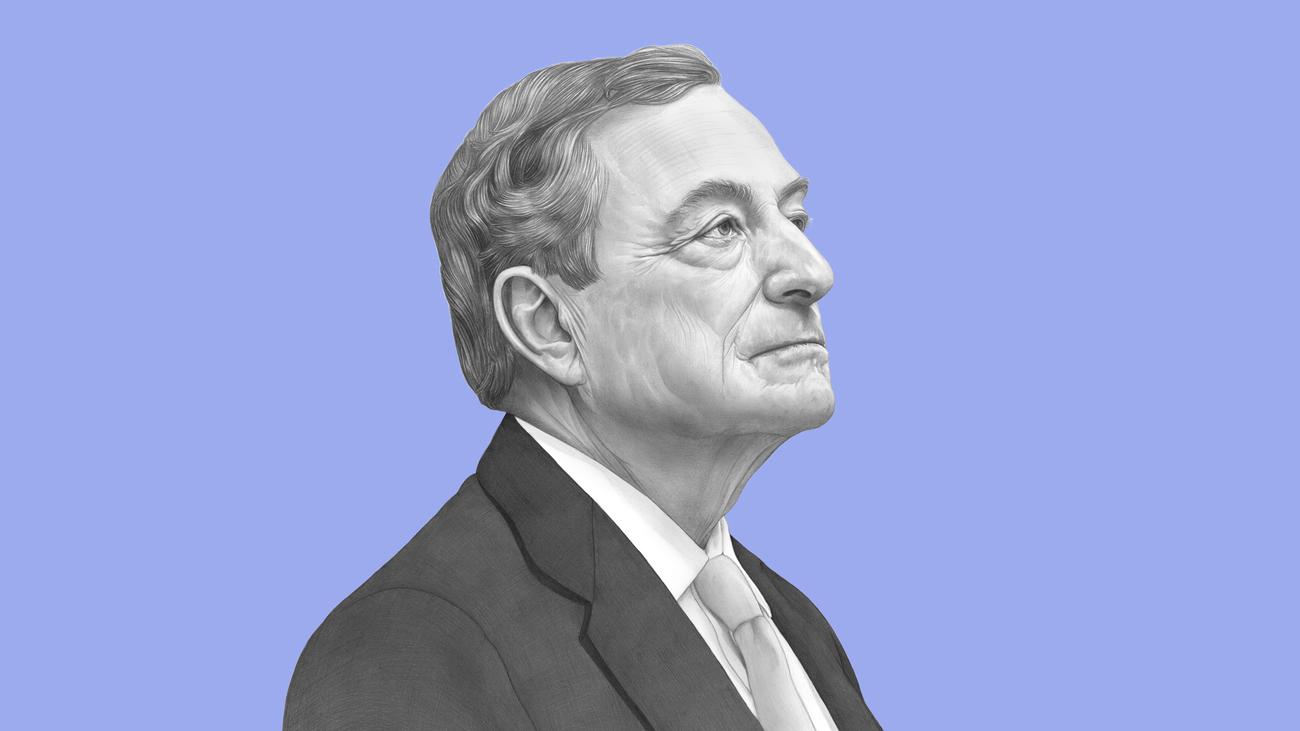Inhalt
Auf einer Seite lesen
Inhalt
Seite 1Europa ist schlecht gerüstet für eine Zeit der Handelskriege. Hier sagt Mario Draghi, wie sich das ändern lässt
-
Seite 2″Die EU muss sich von einem Zuschauer zu einer Hauptfigur wandeln“
Seite 3″Die Welt ist uns nicht wohlgesinnt“
Es liegt auf der Hand, dass eine Demontage der europäischen Integration uns nur noch stärker dem Willen der Großmächte aussetzen würde. Es ist aber ebenso wahr, dass wir, um Europa gegen die wachsende Skepsis zu verteidigen, nicht einfach die Errungenschaften der Vergangenheit auf die Zukunft projizieren dürfen. Die Erfolge, die wir in den vergangenen Jahrzehnten erzielt haben, waren Antworten auf die spezifischen Herausforderungen ihrer Zeit und sagen wenig über unsere Fähigkeit aus, die Aufgaben zu bewältigen, vor denen wir jetzt stehen. Die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Stärke eine notwendige, aber nicht ausreichende Voraussetzung für geopolitische Stärke ist, kann endlich ein echtes politisches Nachdenken über die Zukunft der Union auslösen.
Wir können uns damit trösten, dass die EU in der Vergangenheit in der Lage war, sich zu verändern. Aber die Anpassung an die neoliberale Ordnung war im Vergleich zu heute eine relativ leichte Aufgabe. Das Hauptziel bestand damals darin, Märkte zu öffnen und staatliche Eingriffe zu begrenzen. Die EU konnte in erster Linie als Regulierungsbehörde und Schiedsrichter fungieren.
Um den heutigen Herausforderungen zu begegnen, muss sich die EU von einem Zuschauer oder bestenfalls einem Nebendarsteller zu einer Hauptfigur wandeln. Ihre politische Organisation muss sich ändern. Auch Wirtschaftsreformen bleiben eine notwendige Voraussetzung. Denn fast achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die kollektive Verteidigung der Demokratie von den jüngeren Generationen als selbstverständlich angesehen. Ihr Engagement für Europa hängt nicht zuletzt von der Fähigkeit der Union ab, ihren Bürgern Zukunftsperspektiven zu bieten – einschließlich Wirtschaftswachstum, das in Europa in den letzten dreißig Jahren weit hinter dem des Rests der Welt zurückgeblieben ist.
Der von mir im vergangenen Herbst vorgelegte Bericht zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit hat viele Bereiche identifiziert, in denen Europa an Boden verliert und Reformen am dringendsten erforderlich sind. Aber ein Thema zieht sich durch alle Empfehlungen: die Notwendigkeit, das europäische Potenzial in zwei Richtungen voll auszuschöpfen.
Die erste betrifft den Binnenmarkt. Er wurde vor fast vierzig Jahren beschlossen, und dennoch gibt es nach wie vor erhebliche Hindernisse für den Handel innerhalb Europas. Ihre Beseitigung hätte erhebliche Auswirkungen auf das Wachstum Europas. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass die Arbeitsproduktivität in der EU nach sieben Jahren um etwa sieben Prozent höher sein könnte, wenn unsere internen Barrieren auf das Niveau der USA gesenkt würden. Zum Vergleich: In den vergangenen sieben Jahren wuchs die Produktivität in Europa nur um zwei Prozent.
Die Kosten dieser Barrieren sind bereits sichtbar. Die europäischen Staaten starten eine Großanstrengung mit zusätzlichen Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Billionen Euro, die bis 2031 geplant sind, ein Viertel davon in Deutschland. Dennoch haben wir interne Barrieren, die einem Zoll von 64 Prozent auf Maschinen und 95 Prozent auf Metalle entsprechen. Das Ergebnis sind langsamere Beschaffungsprozesse, höhere Kosten und mehr Einkäufe bei Lieferanten außerhalb der EU – und das alles wegen Hindernissen, die wir uns selbst auferlegen.
Der zweite zentrale Bereich ist die Technologie. Aus der Entwicklung der Weltwirtschaft lässt sich eine Lehre ziehen: Kein Land, das Wohlstand und Souveränität anstrebt, kann es sich leisten, von kritischen Technologien ausgeschlossen zu sein. Die Vereinigten Staaten und China nutzen ihre Kontrolle über strategische Ressourcen und Technologien offen, um Zugeständnisse in anderen Bereichen zu erlangen.
Allein verfügt kein europäisches Land über die Mittel, um die nötigen industriellen Kapazitäten für die Entwicklung dieser kritischen Technologien aufzubauen. Das zeigt sich an der Halbleiterindustrie: Chips sind für die digitale Transformation unverzichtbar, aber die Fabriken zu ihrer Herstellung erfordern massive Investitionen.
In den USA konzentrieren sich öffentliche und private Investitionen auf eine kleine Anzahl großer Chipfabriken mit Projekten im Wert von 30 bis 65 Milliarden Dollar. In Europa hingegen erfolgen die meisten Ausgaben auf nationaler Ebene, im Wesentlichen durch staatliche Beihilfen. Die Projekte sind weitaus kleiner – in der Regel zwischen zwei und drei Milliarden Euro – und über unsere Länder mit unterschiedlichen Prioritäten verstreut. Der Europäische Rechnungshof hat bereits gewarnt, dass es wenig wahrscheinlich ist, dass die EU ihr Ziel erreichen wird, ihren weltweiten Marktanteil in diesem Sektor von derzeit weniger als zehn Prozent bis 2030 auf 20 Prozent zu steigern.