Das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska war keine diplomatische Geste, sondern eine Bühne, auf der Putin sich als ebenbürtiger Gegenspieler inszenieren konnte. Es markierte einen Bruch mit den Gewissheiten der vergangenen Jahre.
Trump rollte dem russischen Präsidenten den roten Teppich aus, die Bilder gingen um die Welt und sie lösten in Europa Schockwellen aus. Die BBC sprach von einer „Erschütterung des Vertrauens“, viele Regierungschefs reagierten alarmiert.
Trump selbst setzte unmittelbar danach seine Linie fort. Auf seiner Plattform erklärte er: „Die Ukraine muss einen Teil ihres Territoriums an Russland abtreten. (…) Selenskyj könnte den Krieg fast augenblicklich beenden, wenn er auf die Krim und die NATO-Mitgliedschaft verzichtet.“ Eine Forderung, die auf ukrainischer Seite Empörung auslöste, auch wenn Präsident Selenskyj nach seinem Vieraugengespräch in Washington betonte: „Es wurden keine inakzeptablen Entscheidungen getroffen.“
Putin nutzte die Bühne, um sein Narrativ zu zementieren. In Anchorage sprach er von „Grundursachen“ und „Sicherheitsinteressen“, konkrete Öffnungen blieben aus. Der Kurs bleibt unverändert: Moskau hält an den seit 2022 formulierten Zielen fest, „Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine“, flankiert durch eine faktische Russifizierung in besetzten Gebieten. Das Institute for the Study of War wertet diese Linie als unvereinbar mit ernsthaften Verhandlungen.
Jede Verzögerung nützt dem Kreml
Es geht jetzt um konkrete Maßnahmen. Dazu gehört der Schutz des ukrainischen Luftraums durch Einrichtung einer Flugverbotszone. Es braucht verlässliche Munitions- und Ersatzteillieferungen sowie ein Sanktions- und Durchsetzungsregime mit klaren Konsequenzen. Jede Verzögerung nützt dem Kreml. Sie gibt ihm Gelegenheit, Truppen auszutauschen, Bestände aufzufüllen und Strukturen zu festigen. Sicherheit entsteht nicht in Pausen, sondern durch Garantien, die halten und durchgesetzt werden.
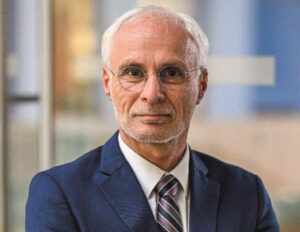 ES&T-Chefredakteur Jürgen Fischer.
ES&T-Chefredakteur Jürgen Fischer.
Foto: Maurizio Gambarini
In Washington traten Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Alexander Stubb und Bundeskanzler Friedrich Merz gemeinsam mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte an die Seite Wolodymyr Selenskyjs. Die Botschaft war klar: Europa lässt sich nicht an den Rand drängen. Sicherheitsgarantien für die Ukraine sollen künftig nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern vor allem von den Europäern getragen werden.
Sicherheit für die Ukraine ist eine europäische Aufgabe. Anders als Trump machten Merz und Frankreichs Präsident Macron allerdings deutlich, dass jeder ernsthafte Verhandlungsprozess nur auf Grundlage eines Waffenstillstands beginnen kann. Sie widersprachen damit offen dem US-Präsidenten und pochten auf klare Bedingungen für Frieden. Die Vereinigten Staaten mögen unterstützen, koordinieren und flankieren, doch die Hauptlast wird auf den Schultern der Europäer liegen müssen.
Militärische Präsenz für den Ernstfall
Die Frage, ob deutsche oder europäische Soldaten für eine Friedensmission entsendet werden sollen, wird kontrovers diskutiert. Weite Teile der Politik lehnen das derzeit ab. SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Miersch erklärte, „jetzt sei nicht die Zeit“ für eine solche Diskussion. Statt aber auf die nächste Wahl zu schielen und parteipolitische Rücksichten zu nehmen, sollte Politik die Freiheit der Ukraine – und damit Europas – in den Mittelpunkt stellen. Die Debatte muss jetzt offen geführt werden. Genau daran war bereits die Vorgängerregierung gescheitert: Sie lavierte, sprach kein klares Wort und ließ die Bürger mit Spekulationen allein. In militärischen Gremien und in der NATO wird längst über Szenarien beraten. Diese Diskussion ist notwendig und unvermeidlich. Wer sie blockiert, betreibt inakzeptable Bevormundung.
Europa darf nicht auf ein Wunder warten. Sicherheitsgarantien müssen glaubwürdig und einlösbar sein. Das bedeutet keine symbolischen Kontingente oder Blauhelm-Romantik und schon gar keine Sandalen-Truppen, sondern militärische Präsenz durch robuste, kampffähige Truppen, die im Ernstfall bereitstehen und wirksam eingesetzt werden können. Ihre Stärke muss so überzeugend sein, dass sie abschreckt und im Falle des Einsatzes Erfolg verspricht.
Genau hier muss Europa als Koalition der Willigen erwachsen werden und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir handeln, wenn wir Truppen stellen und Entschlossenheit beweisen, dann werden auch die Vereinigten Staaten nicht abseitsstehen.
Die unbequeme Wahrheit ist: Ohne ein europäisches Sicherheitsversprechen für die Ukraine wird es keinen dauerhaften Frieden geben. Wer also die Zukunft unseres Kontinents sichern will, muss jetzt den Mut haben zu handeln.
Jürgen Fischer

