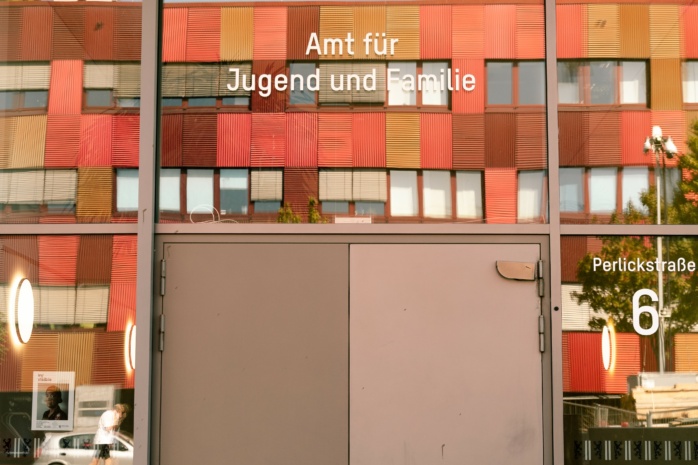Wer in Leipzig Kinder hat, kommt um den Kontakt mit dem Amt für Jugend und Familie kaum herum. Ob es Kita-Plätze, Elterngeld oder Hilfe bei Problemlagen betrifft, sogar das BAföG außerhalb des Hochschulbereichs, das Amt ist für vieles zuständig. Nicht erst mit der Zunahme von Kindern mit migrantischem Hintergrund sind die Aufgaben und die finanziellen Aufwendungen ständig angewachsen, in Zeiten klammer Kassen wächst auch hier der Ruf nach Sparsamkeit.
In Teil 1 sprachen wir mit Amtsleiter Silko Kamphausen über Kinder- und Jugendhilfe als Zukunftsthema und weitere Themen.
Es wird schon lange davon geredet, in der Politik und den Medien, dass man die Leistungen bündeln muss. Es gibt dann nicht mehr 10 Stellen, an denen ich je eine Einzelleistung beantragen muss, sondern ich kann zu einer Stelle gehen und dort über alles sprechen, was an Problemen anliegt und bekomme Hilfe. Wie sieht das beim Amt für Jugend und Familie aus?
Mit unserem Elternexpress, ein Angebot für Erstleistungen direkt nach der Geburt haben wir das als Stadt Leipzig in ersten Ansätzen. Wir machen uns gerade stark, dass bestimmte Leistungen zunächst wieder zum Bund zurückgehen. Dazu gehört das BAföG und das Elterngeld. Wir setzen uns dafür ein, dass das Kindergeld automatisiert mit der Geburt ausgezahlt wird.
Auch wenn es eine Leistung ist, die über die Bundesagentur für Arbeit erfolgt. Der erste Schritt ist es, alle Leistungen, die nicht auf die kommunale Ebene gehören, die müssen wieder dorthin, wo sie tatsächlich verursacht werden. Das ist das eine. Dann haben wir Leistungen finanzieller Art, bei denen nicht ein Gespräch ausreichen wird, sondern eine Bedarfsprüfung erforderlich ist, beispielsweise Hilfen zur Erziehung.
Das ist nichts, was jeder einfach so bewilligt bekommen kann, sondern wir müssen prüfen, ist die Hilfe in welchem Umfang tatsächlich geeignet, notwendig, bedarfsgerecht und welches Fachpersonal wird benötigt. Das wird auch in Zukunft so sein, dass das durch Menschen auf den Weg gebracht wird.
Wichtiger ist eher, dass wir die Leistungen, die im Hintergrund laufen, digitalisieren. Da kann ich nur sagen, wir sind dabei zu prüfen, inwieweit wir alle Rechnungen, beispielsweise 144.000 Rechnungen von Trägern und Erziehungsberechtigten, also alles, was mit unserem Amt in der Außendarstellung auftritt, dass wir dies alles medienbruchfrei durch eine neue Software digitalisieren und Rechnungen fristgerecht zur Auszahlung bringen, damit die Zahlungsverfahren auch besser funktionieren.
Das ist ein ambitioniertes Projekt, welches wir wahrscheinlich in zwei Jahren erfolgreich umgesetzt haben werden. Daneben laufen viele weitere Projekte, wie die digitale Ausstattung unserer Kitas oder die einmal eingegebenen Daten im KITA Portal für einen Kita-Platz für die Hort- oder Schulanmeldung gleich weiterzunutzen.
Wir sind auch gerade dabei, zu prüfen, inwieweit KI zum Einsatz kommen kann. Ein Beispiel: es gibt existenzsichernde Leistungen, wie den Unterhaltsvorschuss. Eine alleinerziehende Mutter möchte diese beantragen, Ermessensspielraum besteht kaum, sondern Wertgrenzen und klare Verwaltungsabläufe. Hinzu kommen ganz klare, abprüfbare Paragrafen.
Warum kann sie das nicht digital beantragen und innerhalb kurzer Zeit einen Bescheid erhalten? Da muss sich doch niemand mehr hinsetzen und mit dem Taschenrechner diese zwei bis drei Wertgrenzen ermitteln.
Wollen Sie die KI etwa entscheiden lassen? Ich hoffe nicht.
Also, wir wollen KI nutzen, ohne dass sie unsere Fachlichkeit und Dienstleistung ersetzt, sondern wir bleiben in einem qualifizierten Teil, das ist die Beratung. Unser langfristiger Anspruch an Digitalisierung muss sein: Als Bürger öffne ich eine Maske auf einer Internetseite, gebe meine Daten einmalig ein, am besten nur einmal für die gesamte Stadtverwaltung, und dann wird angezeigt, welche Leistungen kommen für mich infrage.
Es gibt sehr viele Menschen in dieser Stadt, die diese Sozialleistungen gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie keine Kenntnis davon haben, beispielsweise gilt dies für den Kindergeldzuschlag oder die Leistung „Bildung und Teilhabe“. Oder weil sie sagen, der bürokratische Aufwand sei so hoch, dass sie erst gar keinen Antrag stellen. Am Ende fehlt es jedoch den Kindern. Das kann nicht unser Anspruch sein.
 Gesprächspartner Silko Kamphausen. Foto: Philipp Kirschner
Gesprächspartner Silko Kamphausen. Foto: Philipp Kirschner
Die Schließung von Kindergärten, weil zu wenig Kinder da sind, ist in der letzten Zeit durch die Medien gegangen. Es gibt die Forderung von Parteien und Akteuren aus diesem Bereich, mit dem frei werdenden Personal den Betreuungsschlüssel zu verbessern. Wie sieht es da aus?
Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Sie haben es eingangs gehört, der Elementarbereich der Pädagogik, also Kindergarten, Kinderkrippe, Tagespflege, das ist etwas, wovon ich überzeugt bin, dass wenn wir da wirklich sinnvoll investieren, das wird präventiv wirklich langfristig auf ganz vielen Ebenen gewinnen werden. Gleichzeitig weiß ich, dass die Kita-Finanzierung ein Gemeinschaftswerk von Land und Kommune ist.
Fakt ist, dass wir in den vergangenen Jahren, als wir die Handlungsspielräume aber noch hatten, auf kommunaler Ebene deutlich mehr finanziert haben als das Land. Das beginnt bei dem Unwort „Dynamisierung“, also steigende Ausgaben. Steigende Ausgaben haben die Kommunen fast ausschließlich alleine getragen, das Land hat sich entzogen.
Das heißt, der kommunale Anteil steigt und steigt. Gleichzeitig bleiben die Elternbeiträge im Vergleich zu anderen Städten stabil, beziehungsweise niedrig, was sehr schön ist für die Eltern. Das bedeutet aber, das haushalterische Defizit nimmt zu.
Weniger Kinder bedeuten ebenfalls mehr Raum für Qualität und Inklusion. Die Stadt könnte die frei werdenden Kapazitäten nutzen, um Kitas zu inklusiven Bildungszentren weiterzuentwickeln. Kinder mit und ohne Behinderung, aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten, könnten nun gemeinsam in kleineren Gruppen lernen.
Multiprofessionelle Teams – bestehend aus Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Sprachförderkräften und Sozialarbeiterinnen – begleiten unsere Kinder individuell. Kitas könnten zu offenen Orten im Quartier werden: Sie bieten Elternberatung, Familienbildung und Begegnungsräume – insbesondere für Familien mit besonderen Unterstützungsbedarfen.
Gleichzeitig könnte der Rückgang der Kinderzahlen das pädagogische Personal entlasten. Mehr Zeit für Beobachtung, Dokumentation und intensive Elternarbeit würde zur gelebten Praxis. Leipzig könnte sich weiter als Modellregion für inklusive Frühpädagogik positionieren. In enger Zusammenarbeit mit Hochschulen und Fachschulen können jetzt neue Konzepte, Fortbildungen und Forschungsprojekte entstehen.
Die Stadt sollte zum Lernlabor für eine inklusive Gesellschaft von morgen werden. Die frühkindliche Bildung würde endlich in der öffentlichen Diskussion zunehmend an Bedeutung gewinnen. Von der Stadt Leipzig wird gefordert, die Investitionen in diesem Bereich auszuweiten, um insbesondere die Startchancengerechtigkeit der Kinder zu erhöhen.
Das klingt gut, ist das auch durchführbar?
Jetzt aber das große Aber: Wir setzen uns auf Landesebene mit Nachdruck dafür ein, diese Entwicklung aktiv zu gestalten. Denn nur wenn die Landesregierung seiner Verantwortung nach dem SächsKitaG endlich auch gerecht wird – insbesondere bei der Finanzierung und strukturellen Unterstützung – können wir diese Vorhaben auch tatsächlich umsetzen. Davon sind wir aber weit entfernt.
Wir machen das ja nicht, weil wir Menschen ärgern wollen, sondern es geht am Ende darum, Gestaltungsfähigkeit für unsere Kommune im gesamten Haushalt zu haben. Egal was wir tun, sie wird kleiner werden.
Wir verlassen uns immer mehr auf den Sozialstaat, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir das gar nicht mehr alleine lösen können, sondern wir brauchen andere Konzepte wie bürgerschaftliches Engagement und so weiter.
Die Kita-Finanzierung ist unser größtes Budget, mit 370 Millionen, das darf man nicht vergessen, davon 240 Millionen aus Leipzig. Wir müssen auch schauen, wie es uns gelingen kann, aus der haushalterischen Verantwortung heraus, Einsparungen vorzunehmen ohne, dass es dem Kind weggenommen wird.
Und da rede ich über Overhead-Strukturen, über Trägerstrukturen, Trägerverbände und so weiter. Natürlich war die Enttäuschung bei den Trägern sehr groß, als der Oberbürgermeister die Verträge gekündigt hat. Das war bis zu dem Zeitpunkt nicht vorgesehen.
Trotzdem glaube ich, dass wir das verloren gegangene Vertrauen wiedererlangen können, weil ohne die Träger und die Tageseltern hätten wir den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Leipzig seit 2013 niemals erreicht. Den haben wir erst mal 2023 erreicht.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Ende des Jahres tatsächlich einen guten Kompromiss mit den freien Trägern verhandelt haben, damit wir im nächsten Jahr eine gültige Kita-Finanzierung für die Stadt Leipzig haben.
 In den neuen Räumen des Amtes für Jugend und Familie. Foto: Thomas Köhler
In den neuen Räumen des Amtes für Jugend und Familie. Foto: Thomas Köhler
Ein prägnantes Beispiel war ja die Kita Paul-Küstner-Straße. In der einen Woche bekommt ein Träger den Zuschlag, diese zu betreiben und in der nächsten Woche werden die Rahmenvereinbarungen gekündigt. Wie soll der Träger da planen?
Das ist, glaube ich, unabhängig von einzelnen Einrichtungen einfach schwer, für den Bürger/ die Bürgerin nachzuvollziehen. Ich formuliere es jetzt so, das ist Rationalität von Politik, es geht immer um Mehrheiten statt Wahrheiten. Das Geld steht schlicht nicht im Haushalt zur Verfügung.
Wenn wir ehrlich sind, machen wir das ja nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern am Ende hängen da 28.000 Kinder an der Vereinbarung und deren Eltern. Und dann öffnen jene die Zeitung und da steht, die „Verwaltungsspitze hat die Kita-Finanzierung gekündigt“.
Was heißt das eigentlich? Habe ich dann keinen Kita-Platz mehr? Muss ich mir jetzt eine private Betreuung suchen? Was hat das mit mir als Elternteil eigentlich zu tun? Natürlich entsteht da Panik, aber ich kann Ihnen versichern, auch im nächsten Jahr wird die Kita-Finanzierung der Stadt Leipzig gesichert sein und ich setze auf die Innovationsfähigkeit aller Verhandlungspartner und auf die Kompromissbereitschaft der Verwaltung und Träger, dass wir bis zum Ende des Jahres daher eine Lösung finden.
Es gibt auch Bedenken, dass wir in 5 oder 10 Jahren vor demselben Problem stehen, wie wir vor 10 Jahren standen. Es gibt vielleicht wieder mehr Kinder, aber zu wenige Einrichtungen.
Das ist tatsächlich ein großes Problem: Wie entwickeln sich die Geburten tatsächlich? Man kann festhalten, dass es ein bundesweites Phänomen, nicht nur ein Leipziger Phänomen, ist. Und Fakt ist, seit 2017 fiel die Geburtenzahl von fast 7.000 auf jetzt weit unter 5.000. Wir gehen jetzt auf die 4.500 Geburten zu.
Ja, die Bevölkerungsprognosen, nach denen wir die Infrastruktur Kita ausgebaut haben, waren nicht immer treffsicher, um das mal vorsichtig zu formulieren. Die führten natürlich dazu, dass Überangebote entstanden. Deshalb ist eigentlich die entscheidende Frage, wie gelingt es uns, als Stadtgesellschaft die vorhandene bauliche Infrastruktur so zu erhalten, dass langfristig eine Nachnutzung bzw. erneute Inbetriebnahme mit wenig Aufwand in 10 bis 15 Jahren erfolgen könnte, wenn erforderlich.
Aber wenn zwei Drittel unsaniert oder teilsaniert sind, dann brauche ich Ihnen nicht erzählen, dass es wahrscheinlich nichts wird.
Es gibt ja das Sondervermögen für Infrastruktur, von dem ein Teil in die Länder geht. Gibt es Hoffnung, dass davon etwas bei den Kitas ankommt?
Es ist nach wie vor ungewiss, wie viel der 500 Mio. Euro in Sachsen aus dem 100 Mrd. Programm des Bundes für Infrastruktur wirklich in den Kommunen ankommt. Die Kommunen verausgaben 65 Prozent, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mittel auch weitergereicht werden ist unwahrscheinlich, wenn man einzelne Verlautbarungen auf Landesebene verfolgt.
Der sächsische Finanzausgleich muss neu geordnet werden. Kindertagesstätten sind eine gemeinsame Aufgabe von Land und Kommunen. Wir werden hier bei den Aufwendungen genauso hängen gelassen wie beim Betreuungsschlüssel und den Kita-Kosten je Platz.
Mit dem Haushaltssicherungskonzept wurden die Ansätze für Investitionen nochmals auf den vorrangigen Mittelabfluss und die Umsetzung angepasst.
Die damalige Anmeldung für Kita-Investitionen betrug 36,4 Mio. € in 2025 und 50 Mio. € für 2026 (zum Vergleich 2016: weniger als eine Million). Wenn Sie sich unsere Schul- und Kita-Baustrategie angucken und wissen, dass wir dieses Jahr nur noch 10 Millionen nach Haushaltskonsolidierung investieren. Das heißt, wir reden über fast 70 Millionen Euro an Einsparungen.
Die Zielsetzung besteht darin, mit den wenigen verfügbaren Mitteln eine tragfähige und bedarfsgerechte Infrastruktur zu sichern. Angesichts sinkender Geburtenzahlen in vielen Stadtbezirken und damit einhergehender Überkapazitäten ist es notwendig, Investitionen gezielt zu steuern und Prioritäten auf die bauliche Sicherung tatsächlich benötigter Plätze zu legen.
Hinzu kommt, dass sich die Finanzierungslage auch deshalb angespannt darstellt, weil Förderprogramme von Bund und Land stark eingeschränkt wurden oder gänzlich entfallen sind. Umso wichtiger ist eine vorausschauende, bedarfsgerechte Steuerung der Investitionen im Sinne eines langfristig stabilen Angebots.
Da ist halt kaum noch Luft zum Atmen, um das aufrechtzuerhalten oder Nachnutzungen zu finanzieren. Die Prognosen gehen davon aus, dass, wenn überhaupt, Anfang 2030 tatsächlich wieder ein leichter Anstieg an Geburten zu verzeichnen ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir in unserer Langfristprognose, die gibt es bis 2035, aller Voraussicht nach so viel Puffer einbauen werden, dass wir locker einen geburtenstarken Jahrgang oder Jahrgänge ohne weiteres integrieren könnten.
Letzte Frage schon. Was wünschen Sie sich, was würden Sie gerne tun in Ihrem Bereich und wo klemmt es?
Wir sind ein Teil der Verwaltung und damit auch die Werkbank der Demokratie. Gerade deswegen sind wir auch oftmals der emotionale Puffer für Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Rücksicht, Rückhalt und Respekt für die Arbeit und Wertschätzung der beschäftigten wünschen, weil jene tatsächlich mit sehr viel Herzblut jeden Tag ans Werk gehen.
Und ich glaube, dass es uns als Gesellschaft nicht weiterbringt, nur aus dem Bauch heraus Dinge anzunehmen und zu entscheiden. Wenn wir uns ein bisschen mehr auf Wissenschaft und Evidenz konzentrieren würden, insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendhilfepolitik, glaube ich, dann kriegen wir auch schneller einen breiteren gesellschaftlichen Konsens in dieser Stadt hin.
Auch wenn das soziale System derzeit ordentlich wackelt, würde sich unser Jugendamt, das wichtigste Amt der Stadt Leipzig, über jedwede Unterstützung von entscheidungsstarken Visionären freuen im Sinne unserer Kinder.
Herr Kamphausen, ich bedanke mich für das Gespräch.