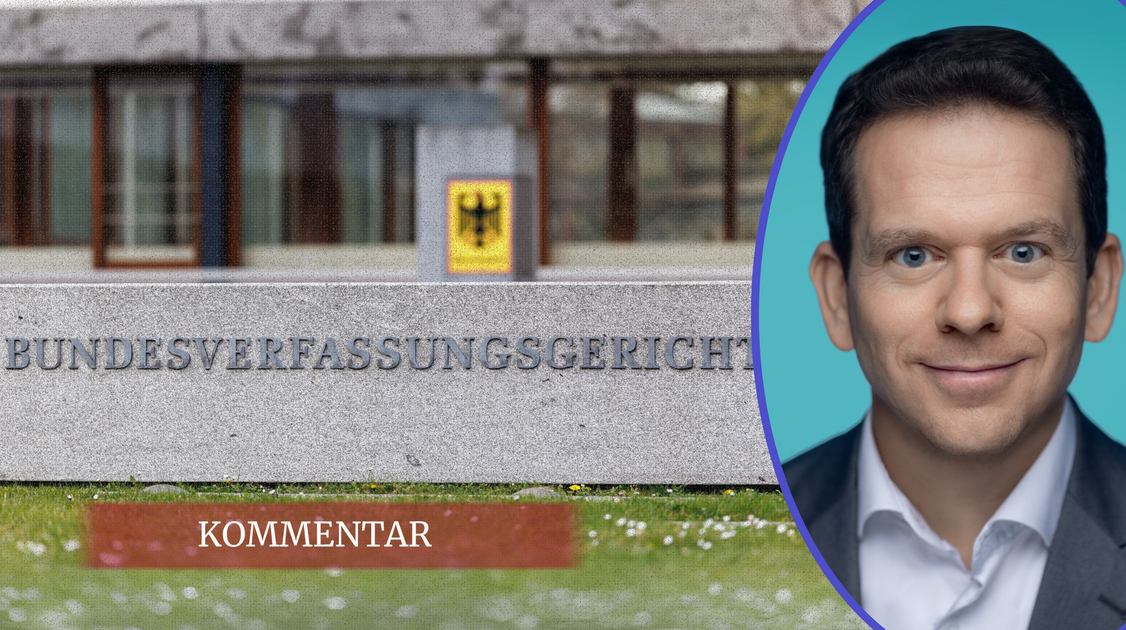Gastkommentar von Dr. Martin Plum

Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk / privat – Zuschnitt und Skalierung LTO
Das BVerfG drängt auf mehr Tempo bei der Wahlprüfung. Für Martin Plum steht fest: Das bisherige zweistufige Verfahren dauert zu lange. Künftig sollte die gesamte Wahlprüfung ohne Umweg über Berlin direkt in Karlsruhe erfolgen.
Die Wahlprüfung nach Art. 41 Grundgesetz (GG) fristete lange ein Schattendasein. Die Bundestagswahlen 2021 und 2025 haben das geändert. Erst bescherte die „Berliner Pannenwahl“ dem Deutschen Bundestag einen Rekord von über 2.000 Wahleinsprüchen. Dann sorgten Schwierigkeiten bei der Zustellung von Wahlunterlagen ins Ausland und das knappe Scheitern des BSW an der Fünf-Prozent-Hürde für über 1.000 Wahleinsprüche, eine – im Vergleich zu vorangegangenen Bundestagswahlen – erneut sehr hohe Zahl.
Diesen doppelten Praxistest hat das durch Art. 41 GG vorgeschriebene zweistufige Wahlprüfungsverfahren – Wahleinspruch vor dem Deutschen Bundestag und Wahlbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) – nicht bestanden. Im Gegenteil: Es erwies sich als zu lang und zu schwerfällig. Die Bundestagwahl vom 26. September 2021 wurde in Berlin erst am 11. Februar 2024 teilweise wiederholt, also nach Ablauf von mehr als der Hälfte der Wahlperiode. In einem ersten Schritt brauchte der Deutsche Bundestag rund 13 Monate, um über die Wahleinsprüche zu entscheiden. In einem zweiten Schritt dauerte es dann weitere 13 Monate bis das BVerfG abschließend über die Wahlprüfungsbeschwerden entschied. Zügig waren diese Entscheidungen damit beide nicht.
Reform rechtsstaatlich geboten
Rechtsstaatlich ist das in mehrfacher Hinsicht bedenklich: Erstens geht es um nicht mehr und nicht weniger als die Gültigkeit einer Bundestagswahl und die richtige Zusammensetzung des Deutschen Bundestages. Zweitens werden die Wahlrechtsbehelfe mit fortschreitendem Ablauf der Wahlperiode mehr und mehr entwertet. Das BVerfG betont dementsprechend in ständiger Rechtsprechung das öffentliche Interesse an einer raschen und verbindlichen Klärung des Wahlgeschehens und leitet daraus ein Zügigkeitsgebot für das Wahlprüfungsverfahren ab.
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass sich bereits während der langwierigen Prüfung der Bundestagwahl 2021 Diskussionen über eine Reform des Wahlprüfungsverfahrens entzündeten. Schon damals warfen die zuständigen Parlamentarischen Geschäftsführer von Union und SPD die Frage auf, ob die Wahlprüfung nicht Sache des BVerfG werden müsse. Es folgte ein Vorschlag für ein einstufiges Wahlprüfungsverfahren beim BVerfG. Die Diskussion versandete indes. Im aktuellen Koalitionsvertrag ist keine Reform vereinbart.
Karlsruhe setzt Berlin unter Druck
Der Beschluss des BVerfG über eine Verfassungsbeschwerde zur Untätigkeit des Wahlprüfungsausschusses vom 13. August 2025, Az. 2 BvR 957/25, zwingt dazu, die Reformdiskussion wieder aufzunehmen. Zwar blieb die Beschwerde im Ergebnis erfolglos. Das BVerfG nahm sie mangels Zulässigkeit nicht zur Entscheidung an. Die kurze Beschlussbegründung hat es aber in sich: Karlsruhe mahnt Berlin erstens zur Eile bei der Prüfung der Bundestagswahl 2025. Das Parlament müsse „die für die Wahlprüfung erforderlichen Schritte … unverzüglich“ einleiten und „binnen angemessener Frist“ über Wahleinsprüche entscheiden. Das sei auch völkerrechtlich geboten. Die Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses habe der Deutsche Bundestag aber „erst“ am 26. Juni 2025 gewählt, also rund drei Monate nach der Bundestagswahl vom 23. Februar 2025. Zweitens schließt das BVerfG „eine Wahlprüfungsbeschwerde … ohne vorangehende Entscheidung des Deutschen Bundestages“ – gegen den klaren Wortlaut des Art. 41 Abs. 2 GG und dafür mit recht schmaler Begründung – nicht aus, wenn der Deutsche Bundestag nicht binnen angemessener Frist über einen Wahleinspruch entscheidet und dadurch die Gefahr besteht, das Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren könne nicht mehr zeit- oder sachgerecht durchgeführt werden. Kurz gesagt: Karlsruhe stellt in Aussicht, die Wahlprüfung an sich zu ziehen, sollte Berlin sie im „Bummelzug“ betreiben. Dass das Gericht bei der Prüfung der vorangegangenen Bundestagwahl selbst nicht durch ein besonderes Tempo geglänzt hat, übergeht es dabei geflissentlich. Erst in einem drei Tage später veröffentlichten weiteren Beschluss vom 23. Juni 2025, Az. 2 BvC 25/23 – Vz 1/25, rechtfertigt es sein Vorgehen ausführlich, wenn auch für einen anders gelagerten Einzelfall.
Für den Verfassungs- und den Gesetzgeber sollte nun dennoch klar sein: Besser selbst handeln, bevor Karlsruhe handelt. Die bloße Ankündigung des BVerfG, eine Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren notfalls entgegen Art. 41 Abs. 2 GG und die einfachgesetzlichen Regelungen unmittelbar selbst zu treffen, setzt Berlin unter Handlungsdruck.
Wahlprüfung gehört nach Karlsruhe – trotz Zusatzbelastung
Die Richtschnur einer Reform ist dabei klar: Mehr Tempo! Aus dem bisherigen zweistufigen Wahlprüfungsverfahren muss ein einheitliches, einstufiges Verfahren werden. Die Wahlprüfung braucht einen einzigen neutralen Richter, der objektiv und frei von parteipolitischen Einflüssen entscheidet.
Diese Anforderung erfüllt der Deutsche Bundestag nicht. Im Gegenteil: Das aktuelle Wahlprüfungsverfahren macht Abgeordnete zu Richtern in eigener Sache. Die damit verbundene Gefahr, einer Politisierung der Wahlprüfung hat sich nach der Bundestagswahl 2021 realisiert – auf Kosten des Vertrauens in die Integrität des Wahlprüfungsverfahrens. Darauf hat bereits Patrick Schnieder zurecht hingewiesen. Die Parlamentsmehrheit wird zudem nur sehr selten ein ausgeprägtes Interesse an einer schnellen Wahlwiederholung und damit auch an einer raschen Wahlprüfung haben. Das Lavieren der Ampelfraktionen bei der Prüfung der Bundestagswahl 2021 hat auch das bestätigt. Ein „Wahl(prüfungs)gericht“ aus Richtern und Abgeordneten – wie es die Bundesländer Bremen und Hessen kennen – ist ähnlichen Bedenken ausgesetzt und damit keine geeignete Alternative.
Richtigerweise gehört die gesamte Wahlprüfung nach Karlsruhe. Das BVerfG entscheidet schon heute als „letzte Instanz“ im Wahlprüfungsverfahren – warum also nicht direkt ohne Umweg über Berlin? Die dann erforderliche Karlsruher Tatsachenfeststellung schließt das Gericht schon heute – im Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren – nicht aus. Sie überfordert die Verfassungsrichter auch nicht, wenn das vorgelagerte Wahleinspruchsverfahren wegfällt. Die zusätzliche Arbeitsbelastung dürften sie verkraften können. Zu deren Bewältigung braucht es keine neuen Richter. Es reichen zusätzliches nichtrichterliches Personal und temporär mehr wissenschaftliche Mitarbeiter. Unter den Bundesländern geht Berlin bereits heute diesen Weg. Dort ist die Wahlprüfung Sache des Verfassungsgerichtshofes. Über die Wiederholung der „Berliner Pannenwahl“ 2021 entschied dieser – bezogen auf die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin – mehr als ein Jahr früher als das BVerfG.
Wahlrechtskommission als Reformtreiber
Die Initiative für eine grundlegende Reform der Wahlprüfung kann von der im Koalitionsvertrag vereinbarten Wahlrechtskommission ausgehen. Sie könnte nicht nur die dafür erforderliche Grundgesetzänderung vorbereiten, sondern auch die Empfehlung des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE aufgreifen, konkrete gesetzliche Entscheidungsfristen für die Wahlprüfung einzuführen. Das BVerfG nimmt in seinem Beschluss auf diese Empfehlung ausdrücklich Bezug.
Durch solche Reformvorschläge würde sich die neue Wahlrechtskommission wohltuend von ihrer Vorgängerkommission abheben. Letztere hat kaum überzeugende Ergebnisse hervorgebracht. Für die Wahlprüfung rang sie sich noch nicht einmal zu einer klaren Empfehlung durch. Der Hinweis Karlsruhes, effektiver Rechtsschutz im Rahmen der Wahlprüfung sei auch infolge völkerrechtlicher Normen geboten, wirkt da wie eine nachträgliche Ohrfeige.
Die Dringlichkeit einer Reform liegt schließlich nicht nur mit Blick auf die beiden letzten Bundestagswahlen offen zu Tage. Auch der Blick über Deutschlands Grenzen hinweg zeigt: Wahlergebnisse werden immer öfter infrage gestellt und ihre Überprüfung immer stärker politisiert. Eine klare, schnelle und unabhängige Wahlprüfung kann daher einen wichtigen Beitrag zu mehr Resilienz leisten. Wer unsere Demokratie dauerhaft schützen und stärken möchte, sollte deshalb auch die Wahlprüfung grundlegend reformieren.
Dr. Martin Plum MdB ist Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und Mitglied im Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung. Vor seiner Wahl in den Deutschen Bundestag 2021 arbeitete er rund zehn Jahre als Richter.
Zitiervorschlag
Reform des Wahlprüfungsverfahrens:
. In: Legal Tribune Online,
11.09.2025
, https://www.lto.de/persistent/a_id/58065 (abgerufen am:
11.09.2025
)
Kopieren
Infos zum Zitiervorschlag