Ohne einen tagespolitischen Blick auf die Ukraine konnte Markus Lanz am Donnerstag seine Talkrunde im ZDF nicht starten, denn die „lahme Reaktion“ der USA – wie es die Journalistin Sabine Adler formulierte – auf den russischen Drohnen-Angriff auf den Nato-Partner Polen ließ viele Fragen offen. Der ZDF-Korrespondent in den USA, Elmar Theveßen, erklärte die maue Reaktion von US-Präsident Donald Trump damit, dass der eigentlich nur vordergründig an einem Frieden interessiert sei, wichtiger seien ihm die wirtschaftlichen Interessen. Er verspüre derzeit gerade keinen Drang, beispielsweise auf China in Sachen Ukraine Druck auszuüben, denn Ende Oktober plane er einen Gipfel mit dem chinesischen Staatschef Xi.
Im Übrigen seien die meisten Amerikaner derzeit der Ansicht, der Ukraine-Konflikt sei eine europäische Angelegenheit – was Trump gut zupasskommt. Und wenn es um den Beistandsartikel 5 der Nato gehe, so stehe darin ja auch, dass jedes Nato-Mitglied selbst entscheiden könne, welche Reaktion es ergreifen wolle – und das reiche vom verbalen Protest bis zu militärischem Einsatz. Alles offen also.
„Markus Lanz“: „Verheerendes Signal“ aus den USA
Aber in der Studiorunde von Lanz hatte die Journalistin Adler immerhin eine feste Ansicht parat, was zu geschehen habe. Wichtig sei, dass die Europäer jetzt den Luftraum der Ukraine schützten und im Übrigen erinnerte sie an 2015, als die Türkei nach mehreren Verletzungen seines Luftraumes durch Russland kurzerhand einen russischen Kampfjet abgeschossen habe. „Ein Land kann auch so reagieren – ein starkes Zeichen.“ Die Zeichen stehen in den USA aber offenbar mehr auf Appeasement – und es sei ein „verheerendes Signal“, so Sabine Adler, dass ausgerechnet an dem Tag des offenbar aus Belarus erfolgten Drohnen-Beschusses die USA erklärten, es sei ein Deal mit der Freilassung von 52 Gefangenen aus Belarus erfolgt und man wolle wieder eine US-Botschaft in Minsk eröffnen.
Auch interessant

„Das klingt wie eine Belohnung“, meinte Adler, man könne es auch als ein Zeichen von „Macht nix“ an den belarussischen Diktator Lukaschenko verstehen. Sowohl Adler als auch Theveßen meinten, dass es nicht schaden könne, wenn bereits jetzt im Rahmen einer Debatte über Sicherheitsgarantien auch über deutsche Truppen in der Ukraine gesprochen werde. Vom Linken-Parteichef Jan von Aken kam da heftiger Widerspruch. Diese Debatte über Sicherheitsgarantien gehe in die „völlig falsche Richtung“. Man müsse doch erst mal zu Verhandlungen und einem Waffenstillstand kommen. Aber jetzt käme die Debatte so rüber, als „ob deutsche Soldaten jetzt gegen Russland kämpfen sollen“. Van Aken setzt seine Hoffnung auf UN-Blauhelme als Garant für die Sicherheit der Ukraine und er schlägt vor, China als „starken Verbündeten“ jetzt zu drängen, Druck auf Moskau auszuüben, sich auf den Verhandlungsweg zu begeben.
Migrationsforscher: Deutsches Aufnahmesystem dysfunktional und ungerecht
Der Ukraine-Krieg hat schon eine gewaltige Fluchtwelle ausgelöst und zehn Jahre nach dem Merkel-Satz „Wir schaffen das!“, stellte Moderator Lanz die Frage, wie „gestresst“ das Land eigentlich durch Migration sei. Mit reichlich Zahlen antwortete der niederländische Migrationsforscher Ruud Koopmans und untermauerte seine These, dass das deutsche System der Aufnahme von Flüchtlingen dysfunktional und ungerecht sei. Die Hälfte aller Bürgergeld-Empfänger seien nicht-deutscher Nationalität. Es sei aber auch so, dass das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Bürgergeldempfängern bei Polen, Ungarn oder Menschen vom Westbalkan noch günstiger sei als bei deutschen Staatsangehörigen.
Bei „Schutzsuchenden“ aber komme auf 1,5 Bürgergeldempfänger nur ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter. Bei Afghanen und Syrern sei die Quote noch höher, bei Syrern kämen zwei Leistungsbezieher auf einen Arbeitenden. Bei Deutschen komme hingegen ein Bürgergeldempfänger auf zehn Arbeitende. Tatsache sei, dass viele der Schutzsuchenden aus Ländern mit niedrigem Bildungsniveau kämen, wo Frauen mitunter gar keine Bildungschancen hätten.
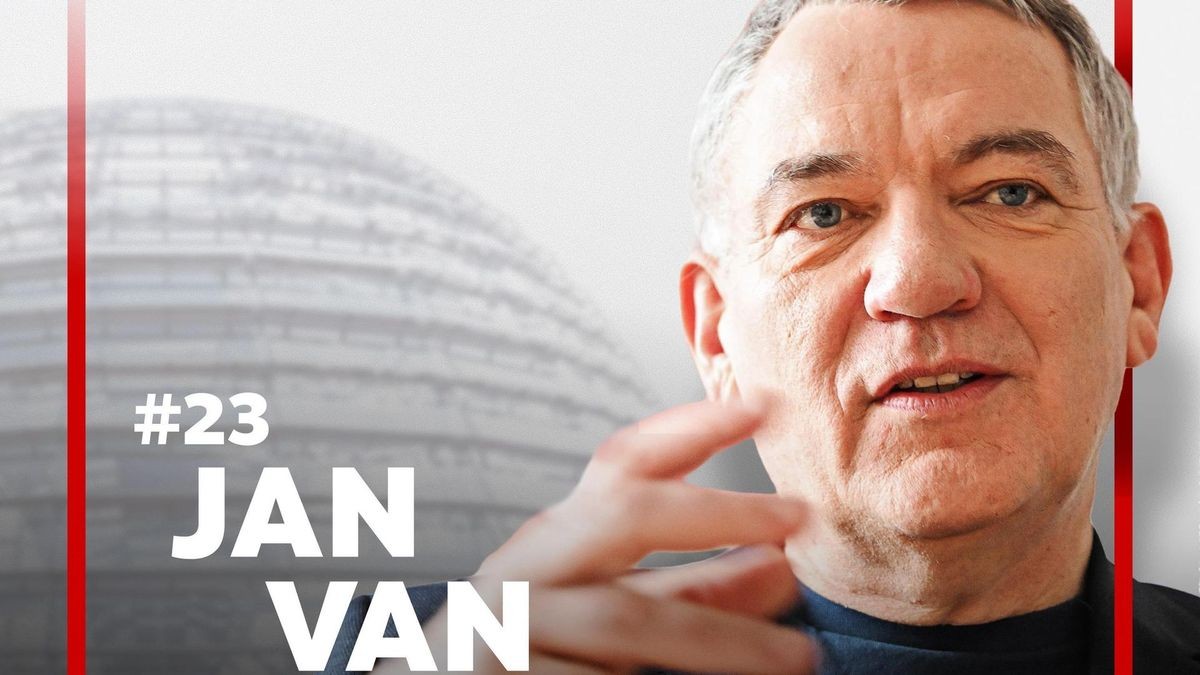
Linken-Chef von Aken weist Aussagen als „pauschalisierend“ zurück
Tatsache sei aber auch, dass viele Betroffenen später gar keinen Schutzstatus erhalten und dennoch in Deutschland bleiben. Es sei für sie attraktiver, im Bürgergeldbezug zu bleiben. Das helfe aber der Nachhaltigkeit des deutschen Sozialsystems nicht weiter und löse auch nicht das Problem des demografischen Wandels. Ungerecht empfindet es Koopmans, dass das System nicht verhindere, dass immer noch tausende von Migranten auf dem Fluchtweg im Mittelmeer ums Leben kommen – Australien habe das Problem mit Zuwanderungskontingenten viel besser gelöst. Und ungerecht sei auch, dass Migranten aus Westafrika – die keines Schutzes bedürften – kommen könnten und wirklich bedrohte Personen – etwa aus dem Jemen – keine Chance hätten.
Van Aken wies diese Aussagen als „pauschalisierend“ zurück. „Sie tun so, als ob Syrer nicht arbeiten wollen. Das stimmt nicht. Viele wollen was tun, die machen was, die versuchen was.“ Allerdings dürften viele gar nicht arbeiten, so van Aken, ein Einwand, den Koopmans mit dem Zuruf „Märchen!“ beantwortete. Die meisten könnten drei bis sechs Monate nach der Ankunft arbeiten, aber die deutsche Arbeitsmarktintegration sei nicht gut und unter dem europäischen Durchschnitt.
