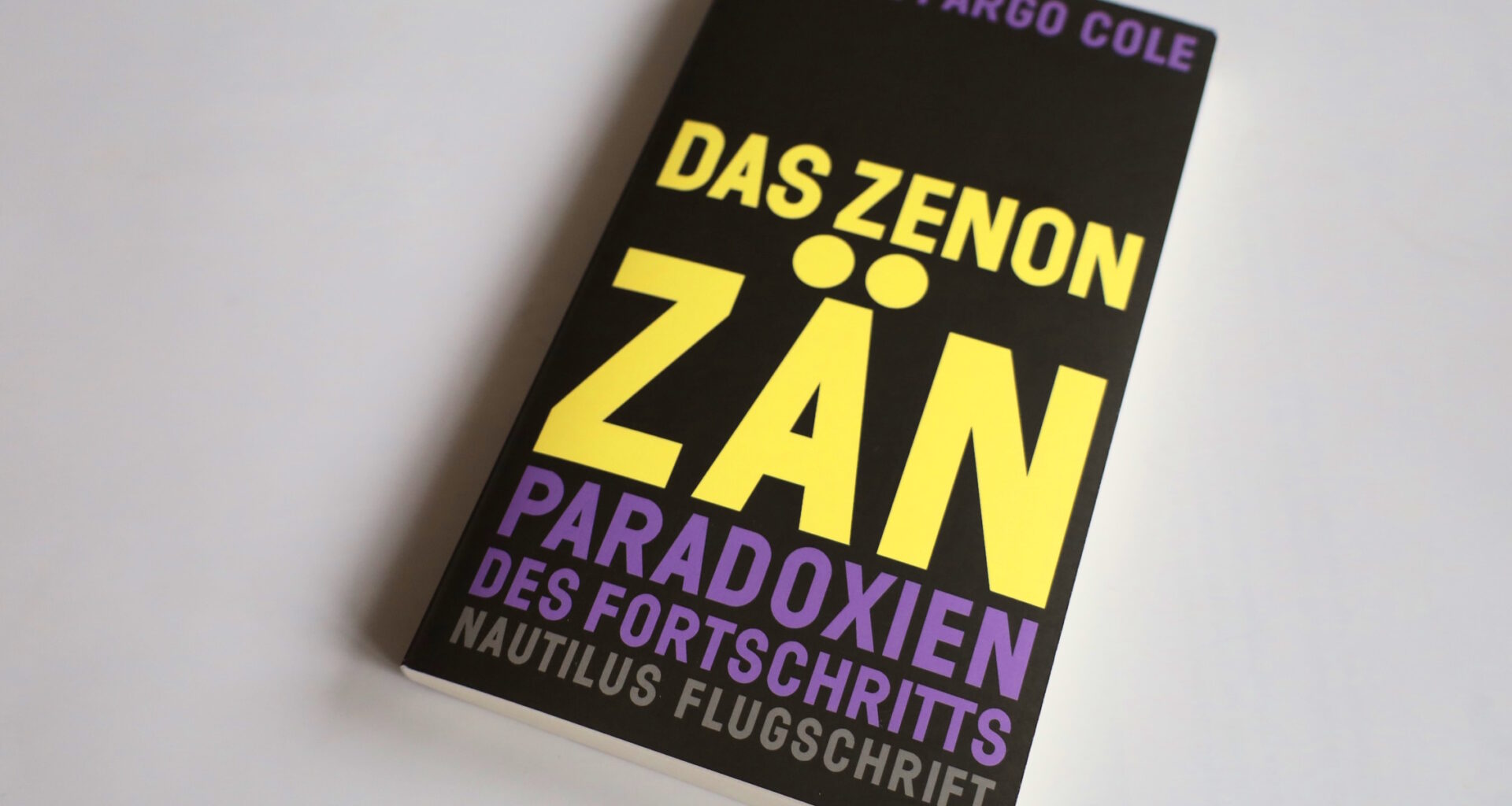Fortschritt ist paradox. Nie wird es so, wie sich das die großen Planer mal gedacht haben. Aber unsere Gegenwart ist noch durch ein neues Phänomen geprägt: das auch medial verbreitete Gefühl, dass es nicht mehr vorwärtsgeht. Und das passt natürlich zu einem Paradox, mit dem einst der griechische Philosoph Zenon von Elea seine Zuhörer verblüffte: Es ist das Gleichnis von Achilles und der Schildkröte. Bei Isabel Fargo Cole ist es Atalanta, die gegen die Schildkröte antreten muss. Und keine Chance hat, zu gewinnen.
Gerechtigkeit muss sein. Frauen sind nicht ausgenommen, wenn es um den desolaten Zustand unserer Gegenwart geht. Sie sind genauso betroffen. „Als Studentin fühlte ich mich von Zenon vor den Kopf gestoßen: Ein Toter will mir sagen, dass kein Fortkommen möglich sei!“, schreibt Cole in jenem Text, den sie dann konsequenterweise auch mit „Zenonzän“ betitelt hat.
Und in dem sie auch Diogenes erwähnt, der Zenons Paradox scheinbar einfach durch Gehen gelöst hat. Aufstehen und losgehen. Nur: Im Kopf spukt das Paradox weiter. Cole: „Doch anstatt Zenon zu widerlegen, bezeugte er damit vielmehr, dass Zenon uns durch die Jahrtausende begleitet, immer einen Schritt voraus.“
Ostdeutsche Utopien
Isabel Fargo Cole ist Autorin und Übersetzerin, hat 2017 mit „Die grüne Grenze“ einen Roman über die deutsch-deutschen Grenzgeschichten geschrieben. Der Osten Deutschlands hat die gebürtige Amerikanein seit ihrer Ankunft 1995 in Berlin besonders interessiert.
Sie wollte dieses andere Deutschland verstehen, seine Illusionen und sein Scheitern. Es war fast zwangsläufig, dass sie dabei auch auf Wolfgang Hilbig stieß, den sie ins amerikanische Englisch übersetzte, auch wenn sich US-Verlage anfangs schwertaten mit Hilbig.
Überhaupt mit Literatur aus der ehemaligen DDR. Nicht ahnend, dass Autoren wie Hilbig Themen aufgriffen, die nach dem Terroranschlag von 2001 auch in den USA greifbar werden würden. Ganz zentral: Die Entseelung der Sprache, ihre Verwandlung in Maschinenwörter, aus denen dann Wortmaschinen werden.
Das sah sie anfangs selbst nicht, interpretierte Hilbigs Analysen eher als Metaphern. Metaphern, die den Sprachgebrauch eines Landes und eines wild wuchernden Geheimdienstes charakterisierten, in denen alle menschlichen Handlungsweisen in sprachliche Automatismen verwandelt wurden, eine in sich getaktete Sprach-Matrix, in der alles Lebendige verschwand und sich reale menschliche Leben in Störungen im Maschinenraum verwandelten.
Und auf einmal kann Cole – 20 Jahre nach der Übersetzung – erstaunliche Parallelen zum neuen Universum der Sprachmaschinen feststellen: „Gedankenarbeit im Keller der KI“. Der Essay „Maschinenwörter, Wortmaschinen“ erschien im März 2024 in der FAZ. Es war nicht der erste, in dem sich Cole mit den seltsamen Verrenkungen der heutigen digitalen Welt beschäftigte.
Die sogenannte KI treibt all die Phänomene, die wir seit zwei Jahrzehnten erleben, nur noch auf die Spitze, suggeriert den Narren vorm Bildschirm, dahinter stecke tatsächlich eine sich zu Bewusstsein erhebende künstliche Intelligenz.
Falsche Intelligenzen
Dass es aber lediglich Programme sind, die – mit zusammengeklaubten Texten und Bildern aus Millionen digitalen Quellen – das Surrogat einer neuen Schöpfung zusammenmixen, das ist den Anbetern von ChatGPT & Co. meist gar nicht mehr bewusst.
Auch nicht, dass das präsentierte Material eigentlich gestohlen ist. Oder in der herrlich leichtfüßigen Formulierung Coles: „Denn ich hatte nicht bedacht, dass eine Maschine längst nicht wie ein Mensch schreiben oder übersetzen muss, um schlicht nach der Logik des Marktes den Menschen ersetzen zu können. Dass der Markt zu diesem Zwecke eine eigene Sprache entfalten könnte, die rein aufgrund ihrer Übermacht überzeugt: die Large Language Models mit ihrer Bibliothek aus Abermillionen gescrapten Buchseiten (unter ihnen zwei Werke Hilbigs in meiner Übersetzung) und mit ihrer von unzähligen Serverfarmen betriebenen Stochastik, die daraus Sätze herausklaubt.“
Und wieder nehmen Menschen das für bare Münze, feiern diesen Raubzug am geistigen Eigentum Anderer geradezu als Beginn einer neuen Ära und glauben den stinkreich gewordenen „Schöpfern“ der KI auch noch, wenn die prophezeiten, dass die Plagiatmaschinen irgendwann in nächster Zeit den vernunftbegabten Menschen ablösen werden.
Dabei ist alles nur Fake, Illusion, das Vorgaukeln kreativer Tätigkeit, während die erzeugte Raubgut-Ware dann dazu benutzt wird, Millionen von Menschen aus ihren Jobs zu eliminieren.
Das ist jetzt meine Formulierung. Isabel Fargo Cole geht mit der Materie etwas feinfühliger um. Ihre Essays sind vor allem Erkundungen. So wie sie in „Zwischen Gestern und Morgen“ die großen Postwachstumsutopien der bekanntesten Denker aus der DDR untersucht – die damit natürlich heftig mit der Kontrollwut des regulierten Staates kollidierten. Ihre Namen sind längst Legende, auch wenn die allerwenigsten tatsächlich ihre Zukunftsentwürfe gelesen haben: Wolfgang Harich, Robert Havemann und Rudolf Bahro.
Die ignorierten Grenzen des Wachstums
Alle schrieben sie kurz nach jenem Donnerschlag, den die Veröffentlichung des Berichts des Club of Rome „Grenzen des Wachstums“ 1972 bedeutete. Und alle drei sahen den Frevler nicht allein im Westen, sondern sahen dieselbe fatale Entwicklung auch in den Planwirtschaften des Ostens.
Mit derselben Philosophie eines unendlichen Wachstums und eines ungehemmten Raubbaus an der Natur. Aber auch in ihren utopischen Gesellschaftsentwürfen findet sie etwas, was sie fatal an die Utopien der Gegenwart und das wilde Wirken eines Elon Musk erinnert, der mit dem DOGE-Projekt ja glaubte, die amerikanische Regierung in eine verschlankte Steuerungseinheit für den perfekten Staat (nach seinen Vorstellungen) verwandeln zu können.
Und gleichzeitig sorgen Netzwerke wie X dafür, die Menschen mit Sprachmüll zu überschütten und reale menschliche Beziehungen regelrecht zu zerstören. Ein Thema, das Cole besonders in der Corona-Zeit beschäftigte, als die verhängten Lockdowns zwar etlichen Menschen entgegenkamen, die vorher schon den Weg in die Vereinzelung angetreten hatten.
Aber selbst Menschen, die sich über dieses Herunterfahren des Alltags erst einmal freuten, merkten schnell, wie sehr ihnen die echten Begegnungen mit anderen Menschen fehlten. Und so schreibt Cole auch über die nur zu verständliche stille Rebellion gegen eine mögliche Zukunft, in der Menschen nur noch digital miteinander interagieren würden, wie es sich die Tech-Bosse im Silicon Valley ja gern ausmalen.
Darauf sind all ihre Strategien (und die Baupläne ihrer Algorithmen) ausgerichtet. Alles sollen Menschen möglichst nur noch digital machen. Denn so hinterlassen sie Spuren, die zur gewaltigsten Sammlung von persönlichsten Informationen führt, die es je gegeben hat. Wovon Geheimdienste in der Vergangenheit immer nur träumten.
Doch seit den Enthüllungen Edward Snowdens über die Praktiken der NSA wissen wir, dass Geheimdienste dieser Art längst unverschämt auf die weltumspannenden Datenströme zugreifen.
Verflogene Euphorie
Wobei Cole eben noch etwas feststellt: Dass die Euphorie der Menschen gegenüber diesen heute als Nonplusultra verkauften Technologien eigentlich fehlt. Anders, als es noch im 19. Jahrhundert war, als Erfindungen wie das Telefon die Menschen faszinierten.
Als wären wir bei all den technologischen Neuerungen längst schon satt, würden mehr gar nicht vertragen. Und schon gar nicht die Verheißungen glauben, mit denen uns die neue technologische Zukunft verkauft wird.
Irgendetwas ist da passiert. Das wird Cole bewusst, als sie beginnt, sich mit den 1990er Jahren in Berlin zu beschäftigen und erstaunt feststellt, dass es darüber überhaupt keine lesenswerten Bücher gibt. Als wären die 1990er Jahre eine Art geschichtslose Zeit, in der die Menschheit einfach ratlos vor sich hindümpelte.
Dabei ist ja selbst unsere jetzige Gegenwart rätselhaft, geradezu seltsam, wenn man die Menschen in der Bahn beobachtet, die ihre Blicke alle aufs Smartphone heften, meist noch Ohrstöpsel eingesetzt, um auch nichts aus ihrer Umgebung zu hören.
„Aber ein Eindruck von Psychose bleibt – und trügt womöglich nicht“, schreibt Cole in „Frau C. versteht die Welt nicht mehr“. „Entlang der Nahtstelle fragmentiert sich die Realität, desorganisiert sich das Denken. (…) Die Technik, die derart den Alltag durchdringt und sich im Körper einnistet, nimmt uns Alltag und Körper als festen Boden, auf welchem wir Technik selbstbestimmt bewältigen könnten.“
Im Gegenteil: Technik ist heute mit so viel zusätzlichen Funktionen, Angeboten, Programmen überladen, dass sie für ihre Nutzer nicht mehr durchschaubar und begreifbar ist. Was aber nichts mit dem „Zauber der Technik“ zu tun hat, sondern mit den sehr wohl profitgeleiteten Überwachungs-Interessen der großen Konzerne, die das Datensammeln zu ihrem Hauptgeschäft gemacht haben.
Denkfallen
Aber dieser Drang, gut Gemeintes immer weiter ins Extrem zu steigern, wird ja auch in anderen Gesellschaftsbereichen sichtbar – etwa im Feld von Political Correctness und dem verwandelten Umgang mit dem Begriff Woke.
Statt die tatsächlichen politischen Verwerfungen zu thematisieren und zu bekämpfen, haben sich ganze Fraktionen von Aktivisten in einen Sprachkampf gestürzt, in dem sich – mal wieder – Linke mit Linken darüber zerfetzen, welcher Sprachgebrauch am Ende der einzig richtige ist. Während sich an den besprochenen falschen Zuständen gar nichts ändert.
Denn da müsste man ja von seinem Laptop aufstehen und nach draußen gehen und mit echten Menschen sprechen. Womit man wieder bei Zenon wäre, der sich seit 2.400 Jahren ins Fäustchen lacht, wie es die Menschen in ihren eigenen Denkfallen festgetackert hat.
Während nur die rebellischen Diogenesse einfach aufstehen und sagen: Das ist mir zu blöd.
Und das Faszinierende an Coles Essays ist, dass sie dieses scheinbar antike Phänomen in unserer überforderten Gegenwart wieder sichtbar macht – gern immer wieder mit Rückgriffen auf Autoren wie Wolfgang Hilbig, der in seinem Heizungskeller Gedanken spann, die im grauen und schlecht beleuchteten Phänomen der sozialistischen Utopie schon Erscheinungen beschrieb, die in der hyperventilierenden digitalen Gegenwart wieder auftauchen.
Nur diesmal eben aus den Kellern profitbesessener Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley, die mit derselben Rücksichtslosigkeit die Welt nach ihren Utopien formen wollen, wie es einst die Helden der sozialistischen Arbeit mit ihrer Welt taten.
Isabel Fargo Cole Das Zenonzän Edition Nautilus, Hamburg 2025, 20 Euro.