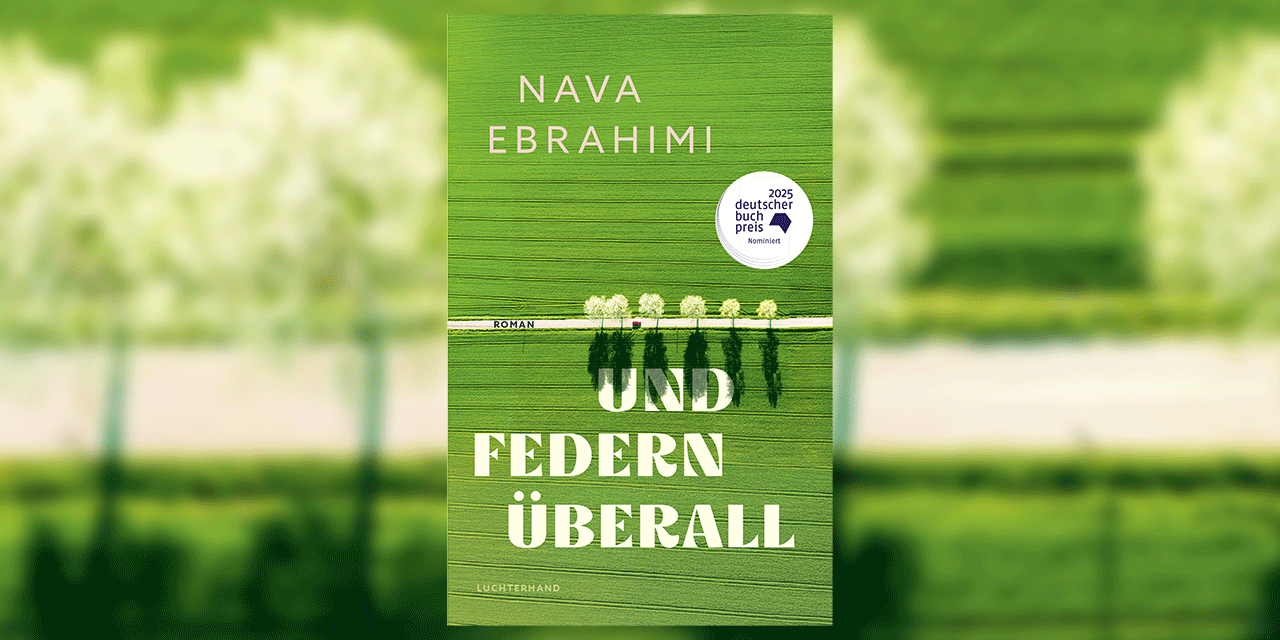Hühner können bis fünf zählen. Dieser “fun fact” geht der Ingenieurin Anna immer wieder durch den Kopf während ihrer Dienstreise im Emsland, einer tristen deutschen Industrieregion (Gibt es eigentlich nicht triste Industrieregionen?). Dort überwacht sie den Probebetrieb einer neuen Technologie in einer Hühnerfabrik, die, wie es neue Technologien so an sich haben, für mehr Optimierung sorgen und dadurch Personal sparen soll. Irgendwo hakt es, die neue Anlage funktioniert nicht, wie sie soll, und Anna wird länger im Emsland festgehalten, als sie bleiben wollte.
Der Prozessoptimierer der Fabrik, Merkhausen, ein alter Chauvi mit polnischen Wurzeln, versucht hartnäckig, ein Date mit der Polin Justyna zu bekommen. Diese hat andere Sorgen: ihre Arbeitgeberin wird dement und ihr junger Liebhaber Nassim kämpft als afghanischer Flüchtling darum, in Deutschland bleiben zu dürfen. Dazu gesellen sich die alleinerziehende Fabriksarbeiterin Sonia und die iranisch-deutsche Dichterin Roshanak, die sich überreden lässt, Nassims Gedichte ins Deutsche zu übersetzen, um die deutschen Einwanderungsbeamten milde zu stimmen.
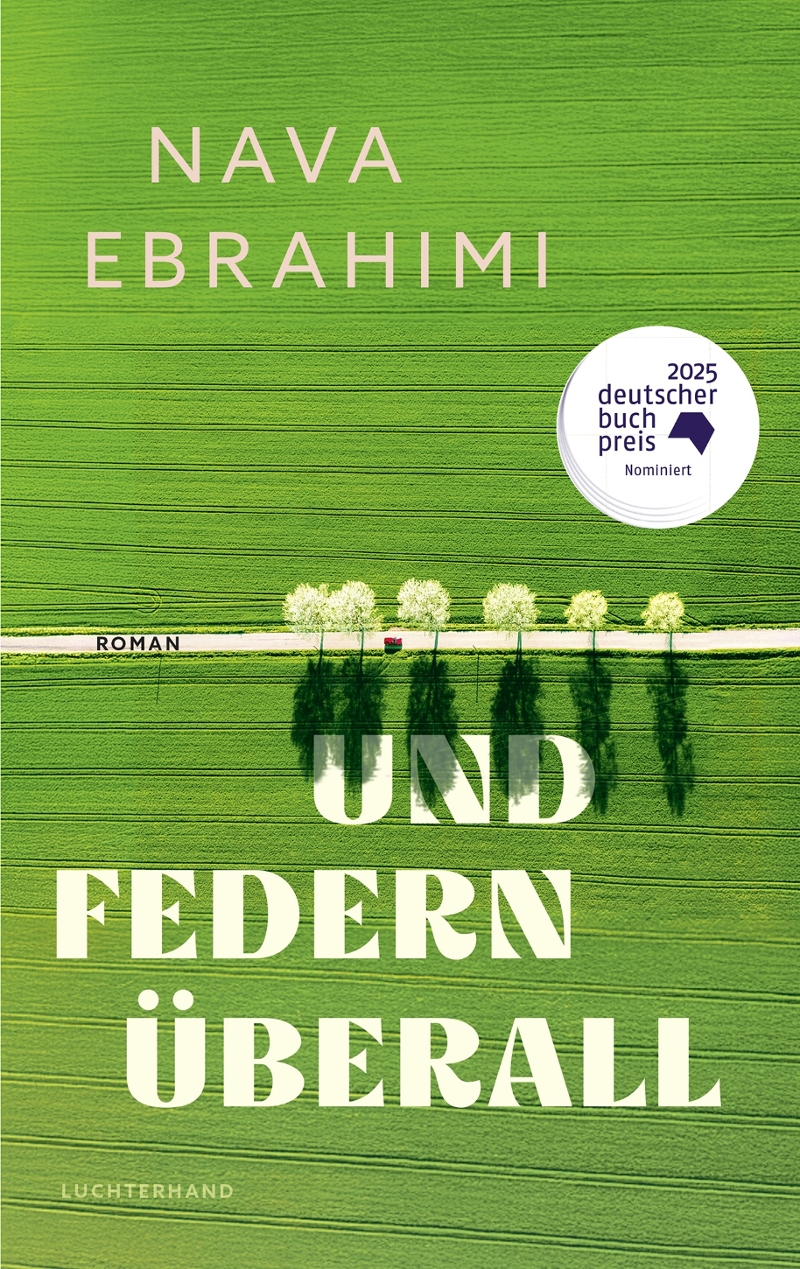
Verlag Luchterhand
“Und Federn überall” von Nava Ebrahimi (352 Seiten) ist im Verlag Luchterhand erschienen.
Naiverweise hatte er geglaubt, dass er, weil er für einen deutschen Verein eine Schule in Kabul mit aufgebaut hatte, hier bevorzugt behandelt werden würde oder zumindest als Individuum. Aber nein, er musste sich das Individuumsein erkämpfen gegen alle Anstrengungen der Behörden, ihm das Individuumsein zu verweigern.
Eine zarte Liebesgeschichte
Die Beziehung zwischen Nassim, der eine Sehbehinderung hat, und der viel älteren Justyna, die als Haushälterin arbeitet, ist berührend zärtlich und von gegenseitigem Verständnis getragen. Beide wissen, dass ihre Beziehung nicht von Dauer sein kann – zu groß der Altersunterschied, zu unsicher Nassims Aufenthaltsstatus, zu prekär beider finanzielle Lage -, aber ihre unterschiedlichen kulturellen Hintergründe sind es spannenderweise nicht, was man als großes Hindernis wahrnimmt. Vor allem Nassim ist bereit, seine eigenen tradierten Vorstellungen von Geschlechterrollen zu hinterfragen.
“Natürlich steht Nassim erst mal für sich selbst, aber ich mochte auch die Idee, dieses Zerrbild des afghanischen Geflüchteten, das wir in unserer Gesellschaft haben, ein bisschen aufzubrechen”, sagt Nava Ebrahimi. “Weil letztlich ist es nicht Frage der Herkunft, sondern Frage der Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, seine Konvention, mit der man aufgewachsen ist. Die Fähigkeit, das, was man bislang angenommen hat, über Bord zu werfen und versuchen, die Welt ganz anders zu sehen.”
Hühner können bis 5 zählen und wir essen sie trotzdem
Der Hühnerschlachtbetrieb, um den sich die Handlung dreht, ist nicht zufällig gewählt. Ebrahimi ist fasziniert von der kognitiven Dissonanz, die es Menschen ermöglicht, Fleisch zu essen und dabei die brutale Realität der Fleischerzeugung zu ignorieren. “Das ist für mich ein Paradebeispiel von menschlicher Verdrängungskunst”, sagt Ebrahimi. “Dass wir so Widersprüche einfach hinnehmen können, dafür steht für mich die Hühnerfabrik.”
Es geht in dem Roman zwar nicht vordergründig um die Fleischindustrie, aber doch (auch) um die menschliche Eigenheit, alles auszublenden, was das eigene Selbstbild in Frage stellen könnte – oder das Bild, das man nach außen präsentieren möchte. So hadert etwa Justyna damit, wie treu sie sich selbst bleiben kann, wenn sie auf Merkhausens Annäherungsversuche eingeht.
Dennoch, beschwor sie sich, sie musste ihn nicht treffen. Wenn er glaubte, er konnte sie nun nach Belieben mit Sprachnachrichten zutexten und überallhin bestellen, lag er falsch. (…) Sie konnte ihm jederzeit das Geld zurücküberweisen und ihm schreiben, sie habe nur einen Witz gemacht und offenbar kenne er sich mit polnischem Humor gar nicht aus.
Aber wenn sie das Geld behielt und ihn später traf, was würde sie Nassim sagen? Musste sie es ihm erzählen? Wozu war sie ihm gegenüber verpflichtet? Eigentlich zu nichts, darauf hatte sie geachtet. Eigentlich.

Clara Wildberger
Die Autorin Nava Ebrahimi
1978 in Teheran geboren, studierte Nava Ebrahimi Journalismus und Volkswirtschaftslehre in Köln und arbeitete als Redakteurin bei der Financial Times Deutschland, sowie der Kölner Stadtrevue. Sie erhielt 2021 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Für „Sechzehn Wörter“ wurde sie mit dem Österreichischen Buchpreis, Kategorie Debüt, sowie dem Morgenstern-Preis ausgezeichnet. 2021 war sie auch Jurorin beim FM4-Kurzgeschichtenwettbewerb Wortlaut. Seit 2025 ist sie regelmäßige Kolumnistin der Süddeutschen Zeitung. Nava Ebrahimi lebt mit ihrer Familie in Graz.
Starkes Buch mit schwachem Ende
Wie sich die Leben der sechs Protagonist:innen immer mehr verflechten, ist interessant mitzuverfolgen und liest sich sehr flüssig. Jede der Figuren ist Hauptperson in seinem oder ihrem eigenen Drama und Nebenfigur in dem der anderen. Eher eine Abseits-Perspektive nimmt die Dichterin Roshanak ein – die einzige Figur, die die Geschichte in der ersten Person erzählt. Einzig das Ende, von dem man sich einen explosiven Crash erwartet, enttäuscht ein wenig; es wirkt etwas erzwungen, als hätte Ebrahimi den Titel des Romans noch irgendwie rechtfertigen müssen. Trotz des schwachen Endes ist es aber ein starkes Buch mit originellen und psychologisch fein beobachteten Charakteren. „Und Federn überall“ ist übrigens für den Deutschen Buchpreis 2025 nominiert.