Was wären konsequente Lehren aus diesen Übungen?
Gehringer: Idealerweise hätten wir zur Vorbereitung des Ernstfalls Aktionsgruppen, die Informationen zusammentragen. Zum Beispiel zum Thema Gesundheit: Wie sind wir insgesamt aufgestellt? Haben wir Medikamente? Wie sieht es mit den Ärzten, dem Rettungsdienst, den Pflegekräften aus? Wie sind die Krankenhäuser ausgelastet? Wie wird die Verteilung organisiert? Sind Ärzten typische Kriegswunden bekannt? Alle Akteure müssten sich viel stärker vernetzen und anhand von Szenarien konkrete Maßnahmen entwickeln.
Stellt sich erneut die Frage, warum derart wichtige Dinge nicht bereits getan worden sind?
Steger: Die Politik hielt die Grenze der Zumutung bei der Bevölkerung wahrscheinlich für erreicht – gerade nach der Coronapandemie und den vorhergehenden Krisen. Das sorgte möglicherweise erst recht für Beunruhigung bei manchen Menschen, denn die Entwicklung blieb ihnen ja nicht verborgen. Daraus kann eine gefährliche Mischung aus Unwissenheit, Panikmache, Alarmismus entstehen, alles Dinge, denen wir mit Fakten begegnen sollten.
Gehringer: Es besteht noch ein weiterer Grund, warum wir spät dran sind: Deutschland hat die wichtige Fähigkeit zur strategischen Vorausschau verlernt. Nun müssen wir sie wieder erlernen. Und zwar nicht nur beim Militär, sondern auch im Zivil- und Bevölkerungsschutz und in der Wirtschaft. Man scheute sich auch lange davor, Russland klar als Gegner zu benennen. Das geschah aus dem Grund, weil man den Kreml für die europäische Sicherheitsordnung und die wirtschaftliche Verflechtung als unverzichtbar betrachtete. Heute wissen wir: Das erwies sich als ziemlicher Irrtum.
Nun braucht Deutschland mehr Soldaten und Kräfte für den Zivilschutz. Betrachten Sie die bisherige Debatte über die Wehrpflicht als positiv?
Gehringer: Die Diskussion über die Wehrpflicht greift zu kurz. Wir müssen bedenken, dass alles zusammenhängt: Militär, Zivilschutz und Wirtschaft. Wenn Menschen als Soldaten abberufen werden, ist es wichtig, dass dies aufgefangen werden kann. Wir finden die Idee eines Gesellschaftsjahres für alle recht charmant, allerdings unabhängig vom Alter: Wer das mit 18 Jahren tun will, gut. Wer es mit 60 macht, ist ebenso gut. So lässt sich für den Spannungsfall ein personeller Unterbau erfassen und auch gewährleisten.
Gibt es Nato-Partner im Baltikum oder in Skandinavien, die es besser als Deutschland machen?
Steger: Wir sollten mit Vergleichen vorsichtig sein. Teils könnte sich Deutschland sicher etwas abschauen. In Schweden und Lettland gibt es Broschüren, die die Bevölkerung auf Krisen oder Krieg vorbereiten. In der lettischen Variante stehen unter anderem Basisempfehlungen zu den ersten 72 Stunden nach Eintreten eines Ernstfalls drin. Zum Beispiel, dass jede Familie einen eigenen Aktionsplan braucht. Wie kommunizieren die Mitglieder miteinander, wenn der Strom ausfällt? Haben sie für solche Fälle zum Beispiel einen festen Treffpunkt? Solche Gespräche fühlen sich nicht gut an, aber es ist sehr gut, sie geführt zu haben.
Was steht noch in diesen Broschüren?
Steger: In der lettischen Variante werden die Uniformen der wichtigsten Behörden erklärt. Auch die Rechte der Bevölkerung, wenn das Land durch eine fremde Macht besetzt wird. Welche Akte des Widerstands sind eigentlich erlaubt? Und etwas ganz Wichtiges steht sinngemäß auch drin: „Glauben Sie nie einer Nachricht, dass unser Land kapitulieren würde. Das ist immer Desinformation.“ Kommunikation und Aufklärung sind sehr, sehr wichtig.
Haben Sie ein praktisches Beispiel?
Steger: Nehmen wir die schwedische Insel Gotland. Warum ist das Militär gerade dort so stark vertreten? Weil Gotland einen strategischen Posten der Nato darstellt. Das weiß dort jeder, auch dank der Informationen seitens der Regierung. Deutschland tut sich schwer, über solche Themen zu sprechen.
Wie unterscheidet sich die Mentalität in Skandinavien und im Baltikum von unserer hierzulande?
Gehringer: In Schweden treten im Kinderfernsehen Soldaten auf, um aufzuklären. Das scheint mir bislang in Deutschland eher wenig akzeptiert, das muss es auch nicht sein. Anderes kann man sich aber schon abschauen. Die Nina-Warn-App zum Zivilschutz könnte wesentlich mehr Informationen und auch Karten enthalten, wie in Litauen. Finnland lädt Bürger zu Verteidigungskursen ein, die grundlegende Überlebenstechniken vermitteln. Manches davon besteht in Ansätzen auch hier. Wir haben bereits sicherheitspolitische Formate bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Wir haben Dienstliche Veranstaltungen zur Information der Bundeswehr (InfoDVag). Die könnten wir ausbauen. Da müssten nur kleine Stellschrauben gedreht werden.
Ist den Bürgern in diesen Staaten eine andere Rolle zugedacht als hierzulande?
Gehringer: Die Rolle der Bürger, der Gesellschaft, wird in anderen Ländern viel wichtiger eingeschätzt als in Deutschland, wo immer auf Entscheider und Autoritäten vertraut wird. In Finnland, in Schweden, im Baltikum wird den Bürgern mehr zugetraut und auch mehr abverlangt. Sie sind für ihren Staat mitverantwortlich.
Für den Schutz der Zivilbevölkerung ist aber doch vornehmlich der Staat zuständig?
Gehringer: Im Grunde schon, das führt aber direkt zurück zum Ausgang: Wir haben uns daran gewöhnt, in Sicherheit und Frieden zu leben. Das merkt man an der Einstellung der Zivilbevölkerung wie auch am Zivilschutz durch den Staat. Krisenszenarien, das waren Hochwasser, Waldbrände. Aber eben keine geopolitischen Krisen. Der Staat sollte die Menschen klar auf Notwendigkeiten hinweisen.
Auf Hilfe dürfen Bürger in der Krise aber doch hoffen?
Gehringer: Ja, wir dürfen uns aber nicht nur aufs Ehrenamt verlassen – oder als Plan B auf die Bundeswehr, die im Krisenfall nicht dafür da ist, in Deutschland aufzuräumen.
Steger: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Krisenfall verteidigt die Bundeswehr das Land. Das heißt: Die zivilen Kräfte müssen die Bundeswehr unterstützen. Wir wissen aber nicht einmal, ob Personal doppelt verplant ist. Ist ein Arzt vielleicht parallel beim Technischen Hilfswerk? Ein Reservist vielleicht gleichzeitig Leiter eines kritischen Infrastrukturbetriebs? Niemand erfasst die Fähigkeiten und kann im Ernstfall das Personal bündeln oder verteilen. Das kann in den ersten Stunden einer Krise möglicherweise entscheidend sein.
Was passiert mit den Betrieben und unserer Wirtschaft im Spannungsfall oder gar im Verteidigungsfall? Was bedeutet es, wenn ein Land auf Kriegswirtschaft umgestellt wird?
Gehringer: Ein größerer Konflikt hat sicher auch Auswirkungen auf die zivile Produktion. Die Nahrungsmittelindustrie könnte eingespannt werden oder die Textilwirtschaft. Arbeitskräfte könnten verpflichtet werden, andere Tätigkeiten auszuüben. Das sind nur Beispiele. Es kommt darauf an, welchen Bedarf der Staat sieht, wenn er den in der Verfassung möglichen Notstand ausgerufen hat.
Bitte erläutern Sie das noch etwas näher.
Gehringer: Wenn die „Notstandsverfassung“ greift, steht dem Staat zum Beispiel das Wirtschaftssicherstellungsgesetz zur Verfügung. Der Staat kann bestimmen, was produziert werden soll, und greift so tief in die Privatwirtschaft ein. Wie viele Brötchensorten brauchen wir im Ernstfall wirklich? Der Staat könnte anordnen, nur noch eine zu backen, die haltbarste zum Beispiel. Sollen Schutzwesten produziert werden oder Ähnliches? Das, was gerade schnell und dringend gebraucht wird. Das ginge aber alles nur mit entsprechender Entschädigung.
Wie können wir uns das vorstellen, wenn der Staat in die Wirtschaft eingreift?
Gehringer: Das ist ein verwaltungsrechtlicher Vorgang. Auf der Grundlage der Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze können Rechtsverordnungen erlassen werden. Der Staat stellt dann in erster Linie Bescheide an Unternehmen oder Personen aus.
Um dann auf Kooperation zu hoffen oder sie durchsetzen zu müssen?
Gehringer: Richtig. Besser wären natürlich die freiwillige Zusammenarbeit und die Kooperation. Es besteht grundlegend schon ein Unterschied und möglicherweise ein Widerspruch. Während die Wirtschaft sehr effizienzgetrieben handelt, geht es beim Militär und auch beim Zivilschutz um Effektivität. Die Bundeswehr trifft aber schon Vorbereitungen und befindet sich mittlerweile in Gesprächen mit großen Logistikunternehmern am Markt, auch mit der Deutschen Bahn, mit der Lufthansa. Es gibt Vorhalteverträge, die Transport und Versorgung der Truppen sicherstellen sollen. Militärisch wurden die Notwendigkeiten also schon erkannt. Der „Operationsplan Deutschland“ befasst sich sehr intensiv mit dem Ernstfall und das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr arbeiten diesen nun ab. Auf der zivilen Seite laufen die Vorbereitungen weniger planvoll und koordiniert.
Gehringer: Genau. Auf ziviler Seite geht es um Millionen von Menschen, die planvoll zusammenwirken müssen. Wie kriegen wir das organisiert? Um beim Bäckerbeispiel zu bleiben: Ich befürchte, mit den großen Bäckereien ist noch niemand im Gespräch bezüglich einer angepassten Produktion für den Krisenfall.
Sind Sie optimistisch, dass Deutschland es noch rechtzeitig hinbekommt?
Gehringer: Der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer hat kürzlich gefordert, Fertigprodukte – wie Ravioli – in die nationale Reserve zu integrieren, die Reserveplanung zu überarbeiten, und das mit der sicherheitspolitischen Lage begründet. So müssten wir in vielen Bereichen, beispielweise in der Bildung und im Gesundheitswesen, auch überlegen. Der Minister hat das Problem und die Lage erfasst.
Herr Gehringer, Herr Steger, wir danken für das Gespräch.
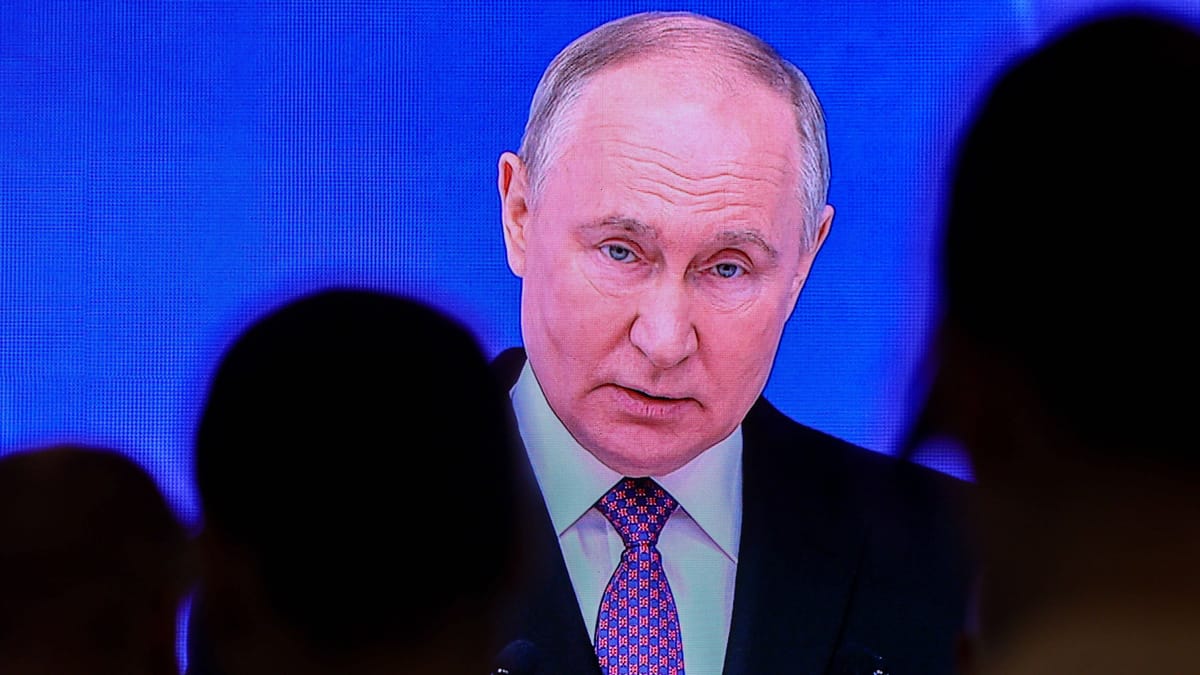

 „Lükex 2023“: Das Kürzel steht für „Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung (EXercise)“, sie dient der Verbesserung der Zusammenarbeit der Akteure. (Quelle: Christoph Schmidt)
„Lükex 2023“: Das Kürzel steht für „Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung (EXercise)“, sie dient der Verbesserung der Zusammenarbeit der Akteure. (Quelle: Christoph Schmidt)
