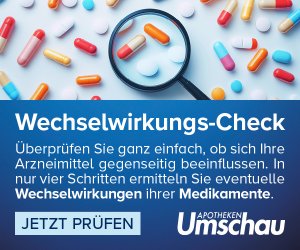Deutschland wird zunehmend attraktiv für Forscherinnen und Forscher aus den USA. Auf der Jahrestagung des German Academic International Network (GAIN) in Boston gab es Ende August großes Interesse am deutschen Forschungsstandort. Mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren vor Ort, darunter 300 Postdocs aus Deutschland, die in den USA forschen. Das sind deutlich mehr Besucherinnen und Besucher als in den Vorjahren.
Auf der GAIN werben deutsche Hochschulen um deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten. Postdocs sind begehrt, da sie oft die Leitung einer Forschungsgruppe anstreben, also den nächsten Schritt vor der Professur. Aufgrund der wissenschaftsfeindlichen Politik der US-Regierung scheinen die Forschenden nun zunehmend darüber nachzudenken, die USA zu verlassen.

Die Verunsicherung ist groß
Auf der GAIN war die Verunsicherung vieler Wissenschaftler zu spüren, berichtet Peter Rosenbaum. Er ist Leiter des Internationalen Büros der TU Dresden und war in Boston vor Ort. „Die Kürzungen in der mRNA-Forschung oder beim Klimaschutz und die Unsicherheit bei der Visa-Vergabe führen dazu, dass sich viele deutsche Postdocs in den USA umorientieren“, sagt Rosenbaum gegenüber der Apotheken Umschau. Einige würden eine Rückkehr nach Deutschland planen, andere lieber noch abwarten und beobachten, wie sich die politische Lage entwickelt.
Auch Dr. Simone Schwanitz, Generalsekretärin der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), war auf der Jahrestagung dabei. „Gerade im Bereich der biomedizinischen Forschung gab es dieses Jahr ein sehr hohes Interesse an einer Rückkehroption nach Deutschland.“ Wegen der Kürzungen bei den Nationalen Gesundheitsinstituten (NIH), einer Behörde des US-Gesundheitsministeriums, können viele Forscherinnen und Forscher in den USA nur noch eingeschränkt arbeiten. Deutschland hingegen werde „als attraktiver Forschungsstandort gesehen“, sagt Schwanitz. Drei Tage lang hat die MPG junge Interessierte auf der GAIN beraten.
USA immer noch führend in vielen Forschungsfeldern
Was die deutschen Universitäten besonders freut: Im Vergleich zu den vergangenen GAIN-Konferenzen hätten diesmal auch US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ohne deutsche Wurzeln Interesse am Forschungsstandort Deutschland gezeigt, sagt Peter Rosenbaum von der TU Dresden. Etablierte US-Professoren und Professorinnen blieben allerdings zurückhaltend: „Trotz der Kürzungen sind die USA in den meisten Forschungsfeldern führend und zahlen deutlich höhere Gehälter“, sagt Rosenbaum.
Bereits im Februar hatten deutsche Universitäten auf der Wissenschaftskonferenz AAAS in Boston einen großen Andrang verzeichnet. Mehrere Universitäten führten Gespräche mit Studienanfängern, Doktorandinnen sowie Professoren und Professorinnen. „Zeitweise fühlten wir uns wie die Rekrutierungsvertretung des Wissenschaftsstandorts Deutschland“, sagte Marion Schmidt Kommunikationschefin und Mitglied des Erweiterten Rektorats der TU Dresden, der Apotheken Umschau im Februar. „Das große Interesse hat uns völlig überrascht.“
Die bürokratischen Hürden sind hoch
Kann Deutschland von den Entwicklungen in den USA also vielleicht sogar profitieren? Darüber sind sich Expertinnen und Experten uneinig. Manche sind der Meinung, dass die Einschränkungen in den USA zu einem Standortvorteil für Deutschland werden könnten.
Die Bundesrepublik ist nach den USA das zweitwichtigste Gastland für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Infrastruktur ist durch stabile Finanzierung und internationale Kooperationen stark. Zugleich diskutiert die Politik derzeit über Investitionen in die Pharmaforschung, um unabhängiger von den USA zu werden und Deutschland als Forschungsstandort zu stärken.
Kritiker befürchten hingegen, dass US-Forscherinnen und -Forscher wegen bürokratischer Hürden am Ende nicht nach Deutschland, sondern in europäische Nachbarländer kommen. Die Bewilligung von Förderanträgen dauert mit bis zu zwei Jahren oft zu lange. Nicht selten vergeht auch zu viel Zeit, bis ausländische Berufsabschlüsse und Zeugnisse anerkannt werden. Rosenbaum ergänzt: „Viele Verwaltungsdokumente gibt es nicht auf Englisch, das ist ein Problem.“
Womöglich wäre es aber auch kontraproduktiv, wenn die USA künftig viele Top-Wissenschaftler verlieren würden. Denn sie sind ein wichtiger Partner für viele deutsche Forschungseinrichtungen, beispielsweise für die Max-Planck-Gesellschaft. „In Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Forschungslaboren entstehen jährlich 1000 Fachpublikationen“, sagt Simone Schwanitz. Eine Schwächung der Wissenschaft in den USA würde also so gesehen auch den Forschungsstandort Deutschland treffen.
mRAN-Forschung in den USA unter Beschuss
Zuletzt geriet in den USA insbesondere die mRNA-Forschung unter Beschuss. So hatte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Anfang August angekündigt, Bundesmittel in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen zu streichen. Davon sind insgesamt 22 Projekte betroffen, die von bekannten Unternehmen wie Pfizer und Moderna geleitet werden.
„Diese Kürzungen sind rein ideologisch motiviert“, sagt Prof. Dr. Stefan Pfister. Er forscht am Hopp-Kindertumorzentrum und am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg an neuen Therapien für krebskranke Kinder. „mRNA-Impfstoffe sind eine der erfolgreichsten und sichersten medizinischen Innovationen der letzten Jahrzehnte. Während der Corona-Pandemie wurden damit Millionen von Menschenleben gerettet.“

Zudem wurden sämtliche Mitglieder des Beratungsgremiums ACIP, dem US-Pendant der Ständigen Impfkommission (STIKO), entlassen und teilweise durch Impfskeptiker ersetzt. Durch die US-Politik sinke das weltweite Vertrauen in Impfungen, sagt Prof. Dr. Reinhard Berner. Er ist Vorsitzender der STIKO und Professor für Kinder- und Jugendmedizin an der TU Dresden. „Dieses ständige Säen von Zweifeln an Impfungen und der Wissenschaft verursacht großen Schaden.“ Zwar werde der US-Kurs die Entwicklung neuer mRNA-Impfstoffe nicht stoppen. „Aber er behindert internationale Kooperationen und erschwert den wissenschaftlichen Austausch“, so Berner.