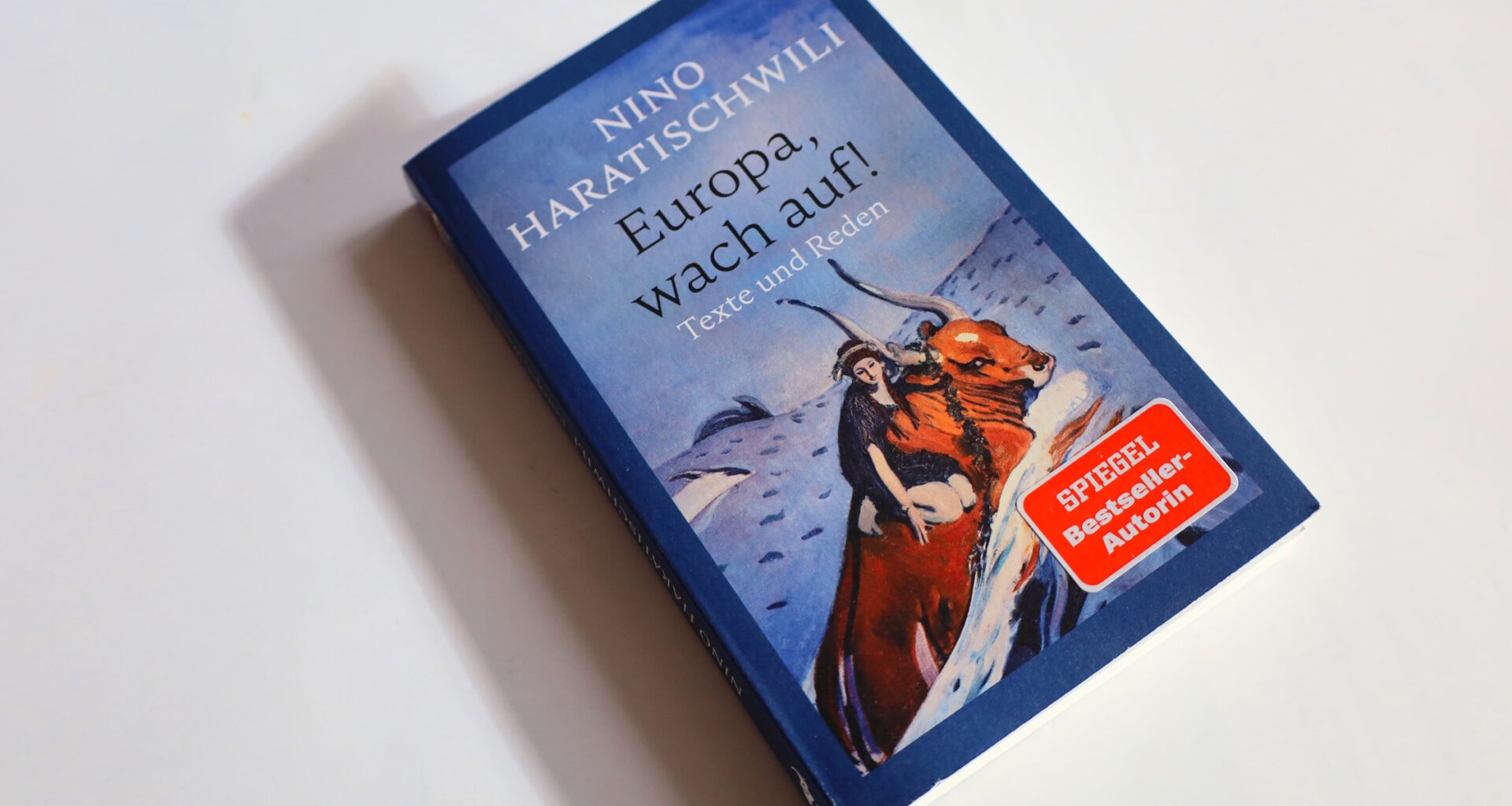Vielleicht brauchen wir das endlich: Eine ordentliche Gardinenpredigt von Menschen, die wissen, wie es sich lebt ohne all die Freiheiten, die Europa besitzt, ohne funktionierende Demokratie, ohne Frieden. Dagegen mit einem aggressiven und übermächtigen Nachbarn, der auf Menschenrechte pfeift, weil es ihm immer nur ums Überwältigen und Kleinmachen geht. Und wer – wie die Autorin Nino Haratischwili – in Georgien aufgewachsen ist, weiß, wie es sich mit einem solchen aggressiven Nachbarn lebt.
Nino Haratischwili ist längst eine der prägenden Stimmen deutschsprachiger Gegenwartsliteratur. Aber natürlich beschäftigt sie Georgien bis heute. Immer wieder besucht die Dramatikerin, Theaterregisseurin und Autorin auch ihre Familie, die dort lebt.
So war es auch damals im August 2008, als mitten während der Olympischen Spiele in Peking russische Truppen in Georgien einmarschierten und auch die Hauptstadt Tbilissi bombardierten. Acht Tage Ausnahmezustand, acht Tage Krieg, in denen Nino Haratischwili nun auch als erwachsene Frau erlebte, wie es sich im Schatten eines finsteren Imperiums lebt, das seine Nachbarn bevormundet, bedroht und sie – wenn es dem Herrscher im Kreml einfällt – auch mit Krieg überzieht.
Was dann im Februar 2022 in der Ukraine passierte, überraschte Nino Haratischwili nicht im Geringsten. Sie kannte das Strickmuster. Und sie hatte in Reden und Zeitschriftenbeiträgen oft genug davor gewarnt. Wer aus einem der ehemaligen Staaten aus dem Reich der Sowjetunion kommt, weiß das. Der weiß, wie das Moskauer Imperium tickt und dass es dagegen keinen Schutz gibt, wenn man sich nicht selbst bis an die Zähne bewaffnet und echte Unterstützung aus dem Westen bekommt. Unterstützung, die Georgien nicht zuteil wurde.
Auch dieses Strickmuster ist nicht neu. Wenn es um Kriege da im „fernen Kaukasus“ ging, hat die westliche Staatengemeinschaft nur zu gern weggeschaut, hat die Propaganda aus Moskau nur zu gern hingenommen, die russische Armee hätte nur lokale Konflikte befriedet und Minderheiten gegen übergriffige Zentralregierungen verteidigt.
Die Kosten der Freiheit
Man lebt ja im Westen in Frieden. Und scheint gleichzeitig vergessen zu haben, dass alle Segnungen des Friedens im Westen einmal hart erkämpft wurde. Sie waren nie ein Geschenk. Und sie sind immer gefährdet, wenn aggressive Regime wieder Morgenluft wittern, die nächsten Kriege anzuzetteln. In ihrer Rede vor dem deutschen Bühnenverein „Die flüchtige Beständigkeit“ bringt es Haratischwili sehr schön auf den Punkt: „Moralische Überlegenheit muss man sich leisten können. Pazifismus muss man sich leisten können. Ideale sind selten kostenlos.“
Diese Rede hat sie im Juni 2025 in Chemnitz gehalten. Mitten in einer Zeit, in der scheinbar lauter „Friedens-“Parteien, die immerfort Moskauer Narrative verbreiten, im Aufwind sind und an der Friedessehnsucht der Wähler andocken, die nur zu gern mit der ganzen Weltgeschichte nichts mehr zu tun haben möchten. Und vergessen haben, dass man sich aus der Weltgeschichte nicht verabschieden kann, sondern immer mitgemeint ist, wenn der Diktator in Moskau gegen den Westen wettert und mit Waffen droht.
Nino Haratischwili nennt das, was da nun nicht nur in Deutschland passiert, beim Namen: Regression. Als wären immer mehr ausgewachsene Menschen bereit, sich so unverantwortlich wie Kinder zu benehmen.
„Nun sind wir im Paradigmenwechsel angekommen, in der historischen Rückwärtsspirale. Dinge, die vor wenigen Jahren undenkbar schienen, sind auf einmal wieder auf der Tagesordnung. Der Krieg ist auf europäischem Boden angekommen.
Der Imperialismus in seiner enthemmten, hässlichen Form ist zurückgekehrt und vernichtet alles im Weg Stehende, die Zeit der Tyrannen und Populisten, die Zeit der toxischen Maskulinität ist wieder da und offenbart die schreckliche Sehnsucht der Menschen nach einfachen und dadurch unrealistischen Lösungen, die dazu führt, dass man wieder faschistoide Parteien wählt mitsamt ihrer Zerstörungspolitik.
Ja, Regression wird uns wieder als Progression verkauft, Rückschrittlichkeit als Sicherheit proklamiert und Ignoranz als Frieden erklärt. Wieder wird von Mauern und Grenzen gesprochen, wieder geht es um die Entweder-oder-Kategorien, um Pro oder Kontra, um Freund oder Feind.“
Schablonen im Kopf
Phänomene, die sie aber nicht nur in der Politik wahrnimmt. Immerhin war das Teil einer Rede vor Theaterleuten. Leuten, die mit dem kostbaren Ort Theater immer auch ein Experimentierfeld haben, auf dem die Wirklichkeit mit dramatischen Mitteln inszeniert, diskutiert, durchschaubar gemacht werden kann. In all ihrer Komplexität. Und so taucht ihre deutliche Kritik am heutigen Entweder-oder-Denken nicht nur in dieser Rede auf, sondern auch in mehreren anderen Aufsätzen.
Aber auch in den Schilderungen ihrer persönlichen Erlebnisse mit Menschen, die geradezu darauf erpicht waren, alles in Entweder/Oder zu teilen, dafür oder dagegen. Als wäre die Welt nur noch in den billigen Kategorien von Schwarz und Weiß, Gut und Böse zu begreifen.
Obwohl gerade gutes Theater zeigt, dass unser Leben komplexer und komplizierter ist, sich geradezu in den Räumen zwischen den Extremen abspielt, in Grautönen, bunten Tönen, Verstrickungen und Verwirrungen eines Lebens, in denen ganz und gar nichts leicht und eindeutig ist und der Mensch sich in lauter Unsicherheiten entscheiden muss.
Aber auch immerfort in Entscheidungssituationen landet, in denen überhaupt nicht klar ist, welches nun tatsächlich die einzig richtige Entscheidung ist. Davon lebt Theater. Von richtigen Geschichten, die diese Vieldeutigkeiten erlebbar machen. Ein Punkt, auf den Nino Haratischwili mehrfach zurückkommt, weil es ihre eigene Entwicklung zur viel gelesenen deutschen Romanautorin und als Dramaturgin begleitet hat.
„Ich will keine einfachen Antworten, weder die eigene Identität noch die Welt treffend. Ich will die Komplexität meines Ichs genauso aushalten wie die der Welt, denn komplexe Fragen zu stellen, halte ich für unser aller Pflicht, die wir in diesem Bereich tätig sind. (Allen voran in einer Zeit, in der Schablonen für Wahrheiten propagiert werden.)“
Mehrere Beiträge in diesem Band beschäftigen sich mit ihrer Herkunft, ihrem Leben – aber eben auch mit den Zuschreibungen anderer, die sich schwertun damit, die in Georgien aufgewachsene Autorin einzuordnen (muss man das überhaupt?), die sie immer wieder versuchen, in ihre Schablonen zu pressen und sie damit auch jahrelang gezwungen haben, sich mit ihrer eigenen Identität zu beschäftigen.
Versuchskaninchen und Kanonenfutter
Aber es sind genau die Stellen, an denen man merkt, wie bekloppt die gängigen Schablonen sind. Sie reduzieren den Menschen auf eine zugeschriebene Rolle, ignorieren aber seine Besonderheit, die gerade durch die Vielfalt seiner Wurzeln und seines Gewordenseins entstehen.
Etwas, was natürlich Menschen, die migriert sind, besonders stark empfinden. Auch als fortwährendes Infragegestelltwerden, Exotisiertwerden. Als wären die Deutschen zu blöd, Menschen mit ihren vielfältigen Erfahrungen und Herkünften zu akzeptieren. Als würden sie die Vielfalt der Welt ohne ihre altklugen Schablonen nicht begreifen können.
Aber es sind ganz offensichtlich auch dieselben Schablonen, die ihre Benutzer unfähig machen, die Vorgänge außerhalb Deutschlands zu begreifen. Auch die in Moskau und in den Ländern, für die der Albtraum einer ins Land einfallenden russischen Armee über Nacht schreckliche Realität werden kann.
In der Dankesrede zur Verleihung des Lessing-Preises „Das letzte Fest“ im Jahr 2018 versuchte es Nino Haratischwili in Worte zu fassen, wie man sich fühlt, wenn der immer ungnädige Tyrann aus der Nachbarschaft ein kleines Land an seiner Grenze bedroht.
„Irgendeine grausame obere Instanz, irgendwelche Präsidenten, Generäle oder gar Götter hatten dies so bestimmt, wir waren nur Versuchskaninchen, nichts, was wir dachten und fühlten, zählte. Wir waren Kanonenfutter.“
Ohne das Wissen um diese permanente Bedrohung und die Verachtung, die diese „zynischen Machthaber“ für das Leben Anderer haben, könne man nicht wirklich vom Leben erzählen. Das ist Haratischwilis Lebenserfahrung.
„Ich kann nicht vom Leben erzählen, zumindest nicht in seiner rauesten und nacktesten, seine animalischsten und somit vielleicht seiner schönsten Form, wenn ich mich nicht zunächst seiner hässlichsten Fratze zugewendet habe.“ Das könne mit ihrer Herkunft zu tun haben, betont sie.
Die Illusion von Kontrolle
Aber so geht es auch den bislang so behüteten Bewohnern des Westens, die jahrzehntelang in dem Glauben leben durften, ihr Wohlstand sei selbstverdient, der Frieden eine Selbstverständlichkeit, und die Konflikte da draußen in der Welt gingen sie gar nichts an. Eine Haltung, die man als Mensch schnell annimmt, wenn einen nichts wirklich mit Gewalt herausschleudert aus dem wohlsortierten Alltag.
So wie es den Menschen ging, denen Haratischwili 2008 im Tbilissi begegnete, mitten in der kriegserstarrten Stadt, in einer einsamen Kneipe, in der sich auf einmal Menschen näherkommen, die alle nicht wissen, ob sie morgen noch am Leben sein würden.
„Sie alle begriffen etwas, was ich erst viel später begriffen habe, sie begriffen, dass jegliche Kontrolle eine Illusion ist, dass wir Menschen, lächerliche, grausame und manchmal auch so rührende Lebewesen, nichts besitzen außer das Jetzt und dass wir uns nicht absichern können: vor dem Morgen nicht, vor den Kalaschnikows nicht, die wir gegeneinander richten, dass wir nicht einmal wissen, wer wir selbst sind, wozu wir fähig, zu was wir in der Lage sind, bevor wir nicht in die jeweilige Situation kommen.“
Eine Passage in ihren Texten, die nicht nur für diese Kriegssituation in Tbilissi gültig ist, sondern für jedes Leben. Auch das im scheinbar friedlichen Westen, der geradezu besessen davon ist, alles unter Kontrolle zu behalten, sich ja auf nichts einzulassen, ja nicht involviert zu sein – selbst dann nicht, wenn er es längst ist. Eine Erkenntnis, die zumindest die noch nicht Dickfelligen 2022 begriffen haben. Wir sind nicht außen vor. Was im Osten passiert, geht uns alle an. Und das allermindeste, was gefragt ist, sind Empathie und Solidarität.
Ein Fakt, den Haratischwili im März 2022 in einem Artikel in der „Zeit“ auf den Punkt brachte, der auch in diesem Band vertreten ist: „Der Urlaub des Westens ist vorbei“. Eine Botschaft, die bekanntlich nicht mal alle verantwortlichen Politiker erreichte, die immer noch glaubten, es gäbe eine Friedensdividende zu verfrühstücken und sich eben nicht einer Realität zu stellen, in der ein russischer Diktator meint, er könne dem Westen wieder die imperiale Harke zeigen und ihn durch Einschüchterung handlungsunfähig machen.
Abschied von alten Gewissheiten
Dabei geht es im Leben immer ums Handeln. Ums Möglichmachen, wie auch Haratischwili erlebte, als sie merkte, wie schwer sich deutsche Theater mit Geschichten taten. Was sie dann zum Romanschreiben brachte und in eine Welt von Verlagsmenschen, die das Ermöglichen als Grundbedingung ihres Arbeitens verstanden.
Auch davon erzählt Haratischwili – insbesondere in „Die flüchtige Beständigkeit“, einem Text, in dem sie auch auf den Abschied von Gewissheiten eingeht (an die so viele Menschen sich klammern). Aber wer es geschafft hat zu akzeptieren, dass es im Leben keine Gewissheiten und Absolutheiten gibt, der wird lebendiger, der lässt sich nicht mehr in Schablonen pressen.
„War man einmal existenziell bedroht und der Boden unter den Füßen hat sich als dünnes Eis erwiesen, weiß man von da an, dass jede Sicherheit eine Illusion ist – vorausgesetzt, man hat diese Erfahrung überlebt.“
Eine Erfahrung, die für die Deutschen in der Regel viele Jahrzehnte zurückliegt. Man hat sich daran gewöhnt, dass Frieden ist und demokratische Freiheiten das Leben bestimmen. Und gerade der Zusammenbruch des Ostblocks 1990 hat die Illusion bestärkt, nun wäre die Geschichte an ihr Ende gekommen, nun könne nichts mehr passieren.
Wie man sich frei schreibt
Doch das war immer eine Illusion. Und so sind die Texte und Reden von Nino Haratischwili eben auch eine Mahnung an die Europäer, ihre Freiheit nicht aus lauter Ignoranz zu verspielen, sondern sie zu verteidigen und auch zu akzeptieren, dass die Welt gefährlicher geworden ist, weil autokratische Staaten wieder meinen, Oberwasser zu haben und Weltpolitik nach ihren archaischen Regeln gestalten zu können.
Was selbst in deutschen Mainstream-Medien mittlerweile zu wirklich dummen Analysen führt, die die Autokratien weltweit ganz selbstverständlich auf dem Vormarsch sehen. Als wäre das eine Gesetzmäßigkeit und nicht das logische Ergebnis imperialen Herrschaftsdenkens, das keine Rücksicht nimmt auf die Wünsche der benachbarten Länder und ihrer Menschen.
Eben weil Menschenleben in diesen Autokratien nichts zählen. Anderes als in den demokratischen Ländern Europas, wo man aber scheinbar vergessen hat, dass alle Freiheiten schwer – und manchmal blutig – erst erkämpft werden mussten.
Ein Buch wie ein Appell. In dem die Autorin aber auch davon erzählt, wie sie gegen all die aufgefundenen Widerstände und Schablonen zu sich selbst und ihrem eigenen Schreiben gefunden hat, wie sie sich frei geschrieben hat. Denn genau darum geht es – im Großen und im Kleinen: Dass man sich das Freisein erst erringen muss, oft gegen viele, viele Widerstände.
Und oft merkt man erst dann, wenn man sich nach vielen Jahren gehäutet hat, wie viel man zu erzählen hat. Und wie sehr es andere anspricht, wenn es dann zur, gedruckten oder gespielten, Geschichte geworden ist.
Nino Haratischwili „Europa, wach auf!“ Frankfurter Verlagsanstalt. Frankfort/M. 2025, 14 Euro.