Zu den seltenen Glücksfällen in einer individuellen Lesebiographie gehören Lektüren, während derer Enttäuschung in Begeisterung umschlägt. Marko Dinićs Roman „Buch der Gesichter“ ist ein Beispiel dafür. Bis rund zur Hälfte des nicht eben schmalen Werks (mehr als 450 Seiten Umfang) steigert sich vor allem das Missfallen über Stilblüten. So liest man etwa: „Sie wunderte sich über den Widerwillen, der plötzlich ihrer habhaft wurde.“ Da schnappt sich also der Widerwille den Menschen? Seltsam.
Oder nur zwei Seiten danach: „Als er die Kneipe betrat, hatte er das eigenartige Gefühl, Mutter soeben verpasst zu haben. Rosa, die hinter dem Tresen stand, bestätigte dieses Gefühl, indem sie ihm sagte, dass sie Olga seit gestern Abend nicht gesehen habe.“ Ja, wie denn nun? „Soeben verpasst“ oder doch „seit gestern Abend nicht gesehen“? Man fragt sich, wie ein angesehener Verlag einem Autor Derartiges durchgehen lassen kann.
Geht es noch manierierter?
Und da ist eine solche Passage (ebenfalls in unmittelbarer Nähe der eben zitierten) noch gar nicht erwähnt: „Ein Außenstehender – vorausgesetzt, er trüge in nichts als seinen sägenden Konsonanten die Reste einer zu Asche zerfallenen Heimat mit sich herum, und nach langer, beschwerlicher Reise wäre er hier, in dieser Arbeiterkneipe, zur Rast eingekehrt –, er hätte meinen können, die Andacht eines Stilllebens läge in der Luft, wäre da nicht die stumme Not gewesen, die sich in Olgas Mundwinkeln abzeichnete.“ Geht es noch manierierter?
 Marko Dinić, geboren 1988 in Wien und aufgewachsen in Belgradpicture alliance/dpa
Marko Dinić, geboren 1988 in Wien und aufgewachsen in Belgradpicture alliance/dpa
Kurz: Marko Dinić, geboren 1988 in Wien und aufgewachsen in Belgrad, bevor er zum Studium wieder nach Österreich ging, macht es einem nicht leicht, denn er will so originelle Bilder finden, dass er darüber immer mal wieder den Sinnzusammenhang vergisst – inhaltlich und sprachlich. „Während er sich einredete, dem Widerstand einen Dienst erwiesen zu haben, bauschte sich in seinem Ohr ein Summen auf, das von einem beißenden Gestank eingeholt wurde.“ Kein Wunder, dass „Buch der Gesichter“ es nicht mehr auf die diesjährige Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Man wird sich eher fragen, wie es auf die Longlist gekommen ist.
Die Antwort lautet: Weil es ungeachtet seiner überanstrengten Formulierungen ein bewegender Roman ist. Dem man den Schmerz des Verfassers über seinen Stoff anmerkt: die deutsche Herrschaft über Belgrad im Zweiten Weltkrieg. Die war im vergangenen Jahr schon Romanthema in Clemens Meyers „Die Projektoren“, doch da war sie eingebettet als nur ein Baustein in einem sich über mehr als hundert Jahre erstreckenden Panorama. Bei Dinić ist die Handlungszeitspanne zwar kaum weniger weit angelegt (der erste Satz der Handlung führt uns in den Ersten Weltkrieg, und recht spät im Buch wird die eigene Geburt des Autors zum Thema), doch im Fokus dieses Romans steht ein einzelner Tag im Mai 1942, an dem aus der jugoslawischen Hauptstadt die Meldung des Chefs der in Serbien eingesetzten Gestapo nach Berlin ergangen ist, dass das Land nunmehr „judenfrei“ sei. Von den 82.500 jugoslawischen Juden überlebten nur 14.000 die Schoa. Von dem, was das für einzelne Schicksale bedeutete, erzählt Dinić. Seine Handlung beschließt er mit der Widmung „Im Andenken an die Opfer des Faschismus“.
Perspektiven auf einen Tag im Mai
Eines davon war ein Großonkel von Mirko Dinić, dessen Geschichte in der Familie durch den Bericht eines im Bosnienkrieg jung getöteten Onkels kursierte. Zumindest erzählt es so der Roman, der als vorletztes Kapitel einen Brief dieses erst nach dem Zweiten Weltkrieg zur Welt gekommenen Onkels aus dem Jahr 1988 wiedergibt, in dem etliche Fäden der zuvor aus bereits vier verschiedenen Perspektiven erfolgten Schilderungen des Schreckenstages vom Mai 1942 zusammengeführt werden. Da sind wir bereits tief in der zweiten, der faszinierenden Hälfte von Dinićs „Buch der Gesichter“, in der es dem Autor nicht mehr darum geht, seine Wortgewandtheit zu beweisen, sondern er in ein Erzählen gekommen ist, das einen nicht mehr loslässt.
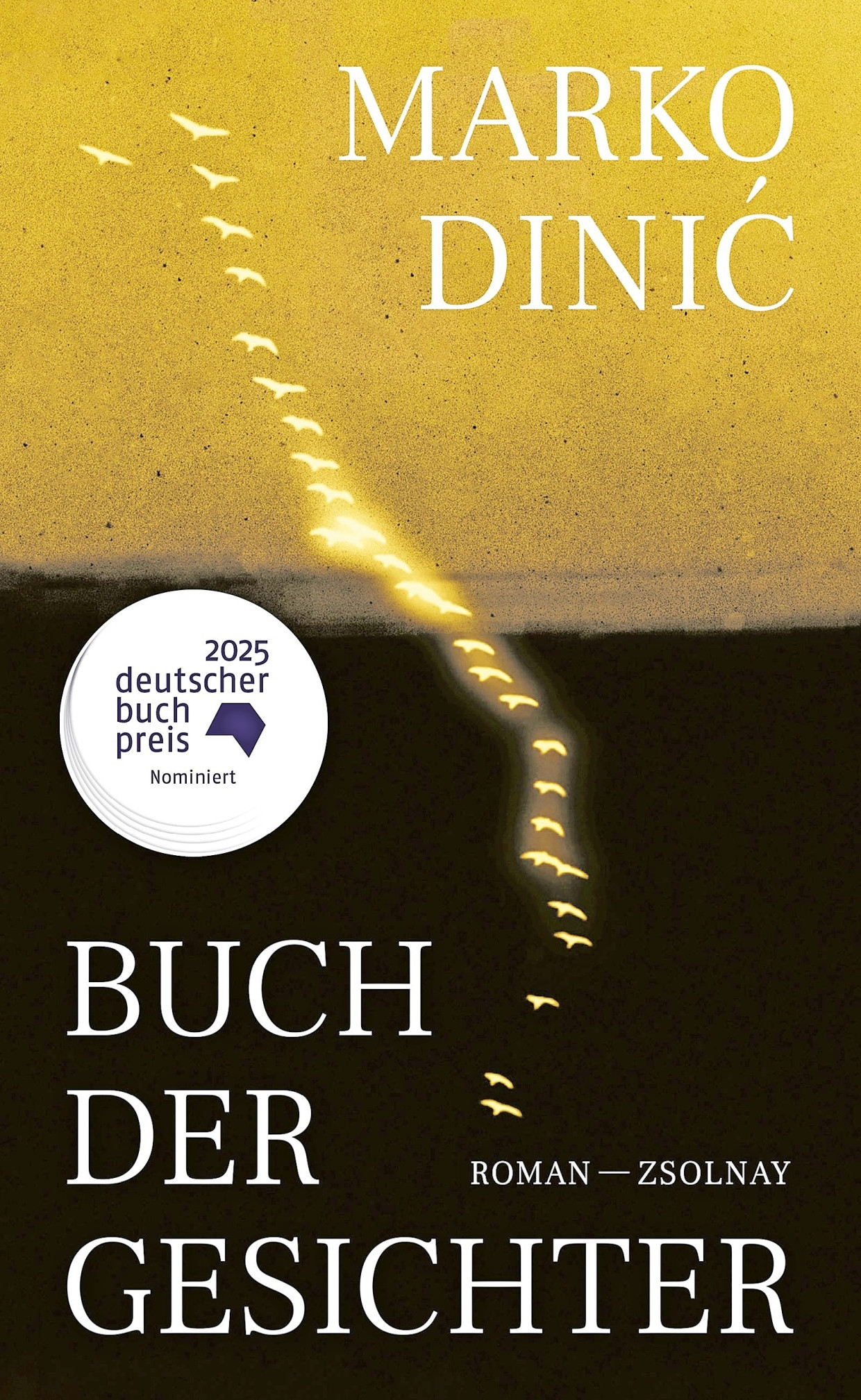 Marko Dinić: „Buch der Gesichter“. Roman.Zsolnay
Marko Dinić: „Buch der Gesichter“. Roman.Zsolnay
Der Wendepunkt ist just der Eintritt jenes Mirko Dinić in die Handlung, denn der erweist sich als ein Denunziant, den durch eine seltsame Fügung das Schicksal jener ereilt, die er verraten will. Die Ambivalenz zwischen dieser Figur und ihrem Autor verändert den ganzen Text – plötzlich wird er psychologisch doppeldeutig, und die zuvor angesichts eindimensionaler Charakterisierungen der Protagonisten fehlende Neugier beim Lesen wird nicht nur geweckt, sondern konstant gesteigert bis zum Schluss. Es ist, wie gesagt, ein seltenes Glücksgefühl, das durch einen solchen Umschwung entsteht. Warum dann noch Gedanken an die zähe erste Hälfte verschwenden?
In ihr wird der eigentliche Held des „Buchs der Gesichter“ etabliert: Isak Ras, geboren 1910 und gestorben im Geburtsjahr seines Autors, 1988. Unter dem Rufnamen Iwan entgeht er dem verbreiteten Antisemitismus, zumal er seine jüdischen Eltern schon als Kind verliert. Bei dem überzeugten kommunistischen Wirtshaus-Betreiberpaar Rosa und Milan findet er Unterschlupf und moralische Vorbilder. Noch einmal: Hier sind wir tief im Klischee.
Doch je tragischer die Menschen um Isaak/Iwan sterben, desto komplexer wird Dinićs Konstruktion: „Wahrscheinlich hätte der Serbe Ivan die Erinnerung an den Juden Isaak mit ins Grab genommen, wären die Deutschen nicht gekommen – wahrscheinlich wäre Jalija noch am Leben.“ Das steht auf Seite 303. Und längst bedient Dinić sich da auch intensiv bei Büchern von Autoren, die zu den bleibenden Zeugen der NS-Verbrechen zählen: Ruth Klüger mit „weiter leben“ zum Beispiel, Alexander Tišma mit „Das Buch Blam“ und allen voran Milo Dor, der mit dem 1952 erschienenen Widerstandsroman „Tote auf Urlaub“ nicht nur ein Muster für „Buch der Gesichter“ geboten hat, sondern unter seinem Geburtsnamen Milutin Doroslovac sogar zur Figur bei Dinić wird, und das nicht zufällig in jenem „Doppelgänger“-Kapitel, mit dem das Buch endlich zu sich selbst findet. Da es trotzdem vielen wohl unplausibel erscheinen dürfte, „Buch der Gesichter“ erst von Seite 207 an zu lesen, sei Geduld angeraten. Sie wird reich belohnt.
Marko Dinić:„Buch der Gesichter“. Roman. Zsolnay Verlag, Wien 2025. 461 S. geb., 28,– €.
