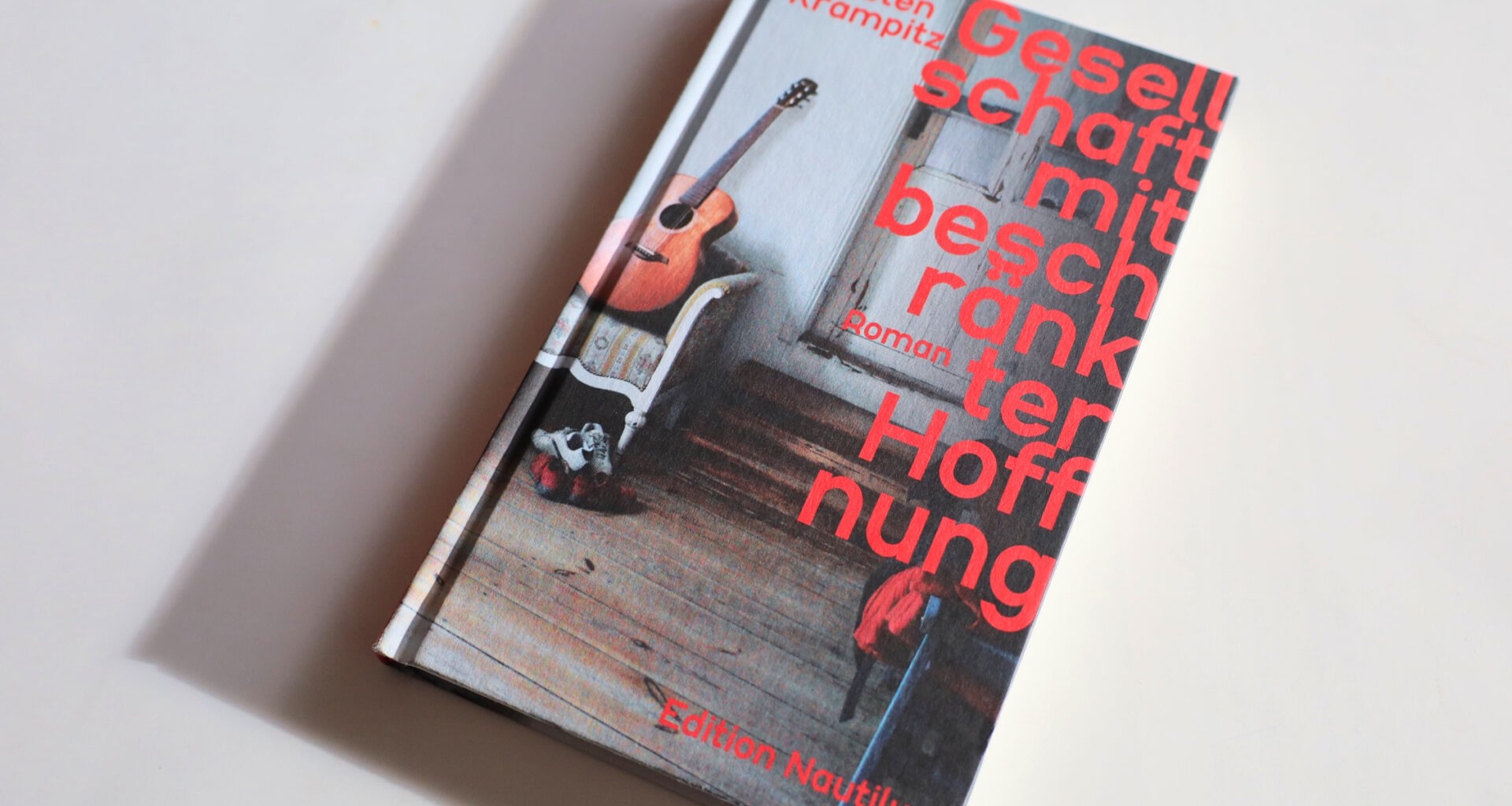Es gab sie tatsächlich – die „Bruderschaft Hartroda“. Man glaubt es kaum, wenn man in diesen Roman von Karsten Krampitz eintaucht. So etwas soll in der DDR möglich gewesen sein? Ein geradezu utopisches Projekt in einem Land, in dem alles geregelt, überwacht und misstrauisch beäugt war? Eine Gruppe von jungen Menschen mit schweren Behinderungen, die Ende der 1970er Jahre die Nase voll hatten vom Weggesperrtsein in einem kirchlichen Pflegeheim. Sie wollten raus und ein selbstbestimmtes Leben führen. Und sie wussten auch, wie es gehen könnte.
Denn dazu brauchten sie tatsächlich nur ein eigenes Haus. Ihre Pfleger würden sie aus ihrer kleinen Rente und dem Pflegegeld bezahlen können. Und Leute, die bereit waren, mit ihnen in die Provinz zu gehen, gab es damals. Leute wie den schweigsamen Mozek, die selbst keinen Platz fanden in der Gesellschaft, die selbst innerlich zerrissen waren und mit ihrem Dienst an den jungen Pfleglingen im Rollstuhl auch ein wenig von dem gutzumachen versuchten, was in ihnen selbst kaputt war.
Einer dieser tatsächlichen Pfleglinge war Matthias Vernaldi, dessen Name auch der Preis trägt, den Karsten Krampitz für diesen Roman bekommen hat. Und er war wohl auch das Vorbild für Gruns, die zentrale Figur in diesem Aussteiger-Roman, der das Thema „Aussteiger in der DDR“ endlich auch einmal von einer Seite thematisiert, die es bislang so noch nicht in den Fokus der Öffentlichkeit geschafft hat.
Was überrascht. Und andererseits auch wieder nicht. Denn gerade die mediale Verengung der Berichterstattung über die DDR gleich in den frühen 1990er Jahren hat auch dafür gesorgt, dass ganz elementare Themen der DDR-Geschichte regelrecht ignoriert und ausgeblendet wurden. Dazu hätte man wahrnehmen müssen, welches eigentlich die Themen waren, die den Film, die Musik und die Literatur in der späten DDR eigentlich beherrschten, was diskutiert wurde und die Herzen der Leser und Zuschauer beschäftigte.
Und das waren in der Mehrheit alles Aussteigerthemen. Geschichten über Menschen, die auf die verschiedenste Weise aus dem Trott, der Bevormundung, den Zwängen einer Gesellschaft herauswollten, die den Menschen nur als Funktionsteil brauchte, dabei aber seinen Willen zu einem selbstgestalteten Leben in freier Entscheidung immerzu negierte.
Rebellion beginnt mit Träumen
Für Menschen mit schweren Behinderungen war es noch verschärfter, denn von Barrierefreiheit war in der DDR keine Rede. Menschen mit Behinderungen sah man im Alltag praktisch nicht. Sie verschwanden vor allem in Heimen – in diesem Fall einem kirchlich betreuten. Und sie lebten ein Leben im Verschlossenen. Es war nicht vorgesehen, dass sie nach draußen gingen. Aber das wollen sich in dieser Geschichte Gruns und seine Freunde nicht gefallen lassen. Gruns ist ein Rebell. Ein ganz und gar nicht gewalttätiger Rebell, das verhinderte schon seine Behinderung, die ihn an den Rollstuhl fesselte.
Aber Rebellion beginnt im Kopf. Beginnt mit Träumen von einem selbstbestimmten Leben. Und wenn einer auch noch geradezu besessen ist vom Lesen und Problemlösen wie Gruns, dann findet er auch eine Weg. Dann setzt er die Dinge und die Menschen in Bewegung. Auch den schwerfälligen Kirchenapparat, der in Thüringen dutzende leer stehender Pfarrhäuser zur Verfügung hat. Warum nicht so ein altes Pfarrhaus zu einem ganz besonderen Ort machen? Zum Lebensort für eine neue Bruderschaft ganz im alten kirchlichen Sinn? Mit guten Argumenten kann man auch Kirchenleute überzeugen.
Und so kam in Hartroda tatsächlich zustande, was es in dieser Art nicht einmal im Westen gab: eine Lebensgemeinschaft von jungen, durch ihre Krankheit behinderten Menschen. Eigentlich eine Gemeinschaft auf Zeit, denn die Ärzte haben Gruns eigentlich nur noch wenige Jahre prophezeit, bevor die Krankheit sein Leben beenden würde. Der Auszug nach Hartroda war also auch irgendwie die Chance, wenigstens noch ein paar selbstbestimmte Jahre draußen zu erleben. So gesehen tatsächlich eine „Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung“.
Predigten aus dem Rollstuhl
Doch das Erstaunliche war: Es wurden nicht nur ein paar Jahre. Die Wohngemeinschaft gab es bis in die frühen 1990er Jahre. Sie überlebte auch das Land, in dem die „Bruderschaft Hartroda“ so etwas wie eine Insel gewesen war, ein Zufluchtsort für Menschen, die in diesem alten Pfarrhaus Platz fanden für ihre Vorstellungen vom Leben. Aussteiger aller Art, die das Leben der kleinen Gemeinschaft teilten oder aber auch oft nur für ein paar Tage hereinschneiten.
Dabei den Haushalt der kleinen Gemeinschaft auch durcheinander brachten, denn dadurch, dass die Wohngemeinschaft auch im Westen bekannt wurde, entstand dort auch ein Netzwerk an Spendern, die das ungewöhnliche Projekt auch mit Geld unterstützten.
Was die Spielräume deutlich erweiterte.
Karsten Krampitz erzählt das ganze bunte Leben in dieser Gemeinschaft, geht auch auf den staatlichen Argwohn ein und die Tatsache, die sich dann nach 1990 nicht mehr leugnen ließ: Dass auch hier die Stasi eine lückenlose Überwachung organisierte. Zunder genug, um die Existenz dieser besonderen Lebensgemeinschaft bis ins Tiefste zu erschüttern.
Dabei war Hartroda auch ein Ort, an dem eine landesweit bekannte Band namens Mischpoke ihren Rückzugsort hatte. Hier konnten die Musiker auftanken, die benachbarte Kirche gleich als Probenraum nutzen. Eine Kirche, in der Gruns auch vehemente Predigten hielt, denn seine Zeit im Rollstuhl hatte er auch genutzt, um regelrecht Theologie zu studieren.
Nur die Priesterweihe wollte die Kirche ihm nicht zugestehen. Aber seine Predigten hatten es in sich. Denn Gruns verstand sein Amt natürlich nicht als Hüter seiner braven Christenschafe. Seine Predigten knüpften zwar an die Bibel an – aber sie behandelten das Leben im regulierten Staat. Es ging um menschlichen Anstand, Ehrlichkeit, Freiheit.
Wenn es um Vertrauen geht
Es ist kein Zufall, dass Krampitz’ Geschichte mit seiner Atmosphäre an die großen Rocksongs der späten DDR-Zeit erinnert, in denen die Melancholie sich stets mit der Frage nach einem aufrechten menschlichen Leben paarte. Nach einem ehrlichen Leben in verqueren Zuständen. Aber natürlich geht Krampitz auch auf die sehr persönlichen Beziehungen der Pfleglinge und ihrer Pfleger ein.
Eine Liebesgeschichte mit all ihrer Trauer und Tragik findet genauso ihren Platz wie die sehr menschliche Beziehung zwischen Mozek und Gruns. Denn in so einem Verhältnis gibt es keine Scham mehr. Da geht es um ganz persönliches Vertrauen. Ganz leise ist das der Grundtenor der Geschichte. Denn am Ende droht genau das in die Binsen zu gehen, kommt ans Licht, was auch Mozek all die Jahre in sich verschlossen hat.
Es ist auch seine Geschichte, die Geschichte eines ehemaligen Grenzsoldaten, der unter dem, was er da getan hat, gelitten hat. Auch das war lange zu erzählen. Es waren keine Monster, die da an der Grenze standen und Befehl hatten zu schießen. Es waren junge Männer, die oft selbst nicht wussten, wie man ein eigenes Leben bestehen kann. Und manche sind an diesem Dienst zerbrochen.
Oder nahmen die blutigen Vorfälle als Trauma mit. Flohen regelrecht davor, verkrochen sich, wie es Mozek in Hartroda tat, wo er über die Jahre zum verlässlichen Ruhepol wurde. Aber eben schwieg. Auch mit Gruns nicht über sich und all das sprechen konnte, was ihn mit dem Staat und dessen Zumutungen verband.
Am Ende von Krampitz’ Roman kommt das alles hoch, gerät die kleine Kommune nicht nur ins Scheinwerferlicht, sondern droht auch an den neuen Verhältnissen zu scheitern. Denn auch vorher war Gruns klar, dass diese kleine Gemeinschaft nur unter den Verhältnissen der verschlossenen DDR so existieren konnte. Eine Nische und Zuflucht in einem Land, in dem alles reglementiert war. Gleichzeitig ein Projekt, das selbst im Westen mit Staunen beachtet wurde. Wie war so etwas möglich?
War es eben nach Mauerfall, und Währungsunion so nicht mehr.
Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben
Aber gerade deshalb wird die Wohngemeinschaft Hartroda auch zu einem besonderen Beispiel für gelebtes Außenseitertum in der DDR. Auch wenn Krampitz mit großer Kenntnis der Szene auch recht harte Worte wählt, mit denen die Mitglieder der kleinen Gemeinschaft sich selbst und ihre Rolle als „Aussortierte“ in einer Gesellschaft betrachteten, in der Abweichungen von der Norm eigentlich nicht vorgesehen waren.
Aber Gruns und seine Freunde zeigen durch ihr Handeln eben auch, dass man mit Menschen, die im Sinne einer auf Funktion getrimmten Gesellschaft als „wertlos“ abgestempelt werden, nicht umgehen kann, als wären sie nur lästige Bürden, die man irgendwo ablud und versorgte. Die kleine Kommune, die auf ihre Weise auch die elementare Frage nach einem wirklich gelebten Kommunismus stellte, zeigte, dass Menschen mit Behinderungen sehr wohl das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben.
Und dabei etwas schaffen können, was auch für andere Unangepasste zu einem Zufluchtsort werden konnte. Selbst für eine Band wie Mischpoke, die am Ende auch noch Auftrittsverbot bekommt und auf einmal vor der Frage steht, wie es nun weitergehen soll mit der Band. Die Geschichten von Band und Wohngemeinschaft verflechten sich. Erst recht, als auch Mozek beginnt, als Roadie mitzufahren.
Welche Rolle die Wohngemeinschaft für ihn spielte, hat Matthias Vernaldi selbst einmal formuliert: „Mit dem Zusammenbruch der DDR endete für die Wohngemeinschaft die ständige Bedrohung, durch Polizeieinsätze oder Inhaftierungen aufgelöst zu werden. Und es endete die Notwendigkeit einer solchen sozialen Symbiose von Leuten, die auf Hilfen im Alltag angewiesen sind, und welchen, die anderweitig nicht in die Norm passen.“
Wie wollen wir leben?
Die Betreuungsbedingungen für behinderte Menschen haben sich deutlich verbessert. Aber ein Anspruch ist geblieben. Und das ist das utopische Moment der Geschichte. Denn sie erzählt eben auch von einem solidarischen Zusammenleben, wie es in der DDR eigentlich so nicht vorgesehen war.
Von einem Modell des Zusammenlebens, das weit über die abgewickelte Gesellschaft hinausweist – bis in unsere Gegenwart hinein, die mit anderen Sorgen und Zwängen zu kämpfen hat. Die aber auch etwas erlebt, was sie von innen her auffrisst: die zunehmende Vereinzelung und Vereinsamung vieler Menschen.
Und so stellt Krampitz’ Geschichte eben auch die Frage noch einem solidarischen Leben. Weit über Hartroda hinaus. Nach Orten, an denen Menschen – wie am Ende der Geschichte der Mischpoke-Roadie Schlotter – das Gefühl haben, zuhause zu sein. Nicht bloß Mieter in einer Wohnung, die ihnen nicht gehört. Sondern wirklich zuhause, weil dieser Ort ein selbstgewählter ist. Mit Menschen, für die man sich bewusst entschieden hat.
Ein Ort, an dem sich Leute zusammenfinden, die gemeinsam einen lebenswerten Platz schaffen wollen. Und die am Ende auch nicht weglaufen, sondern füreinander einstehen. „Was sollte jetzt noch passieren, was nicht passiert ist?“, fragt sich Schlotter beim Anblick des noch nicht winterfest gemachten Hauses. „Bisschen Geld dürfte auch noch da sein. Und wenn ich einfach bleibe? Wenn wir bleiben? (…) Alles vergeht, auch der Schmerz. Und alles geht weiter. Tot ist, wer keine Ideen mehr hat.“
Wie wollen wir eigentlich zusammenleben?
Solche trockenen Sätze findet man eine Menge in diesem Roman. Meist kommen sie von Gruns selbst, der letztlich der Mittelpunkt dieser besonderen Gemeinschaft ist und auch durch seine nicht ganz christlichen Predigten immer wieder Steine des Anstoßes in die Menge wirft.
Denn auch wenn es anfangs eine recht wilde Idee war – und auch nicht wirklich im Sinne eines christlichen Mönchsordens gedacht war – hatte Gruns Vorstellung einer selbstbestimmten Wohngemeinschaft immer auch einen ernsthaften Kern, der weit über seine Hoffnung, noch ein paar selbstbestimmte Jahre zu haben, hinausging. Wie wollen wir eigentlich zusammenleben?
Und das gilt im Kleinen genauso wie im Großen. Und da merkt man dann, wenn man mit den Protagonisten der Geschichte durch die wilden Jahre in Hartroda steuert, dass das eine Frage für die Gegenwart ist, die sich viele Menschen stellen, bewusst und unbewusst. Das Haus muss jedenfalls erst einmal winterfest gemacht werden, „damit die Kälte nicht mehr reinkommt.“
Man merkt an solchen Formulierungen, dass Krampitz auch Songs geschrieben hat. Einer läuft thematisch durch seine Geschichte: „Dies. Und Paradies“, ein Song, den er für die Blues-Rockband Freygang geschrieben hat. Und sein Buch hat er natürlich der Erinnerung an Matthias Vernaldi gewidmet. Denn Träume werden nur Wirklichkeit, wenn einer den Mut hat, sie tatsächlich ins Rollen zu bringen.
Und irgendwie bleibt am Ende das Gefühl, dass das nun einmal nicht nur für das im Nirwana verschwundene Ländchen DDR gilt, sondern auch für das Heute und die Sehnsucht einer Menge Menschen nach einem Ort, an dem sie willkommen sind. Und sich gemeint fühlen.
Karsten Krampitz „Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung“ Edition Nautilus, Hamburg 2025, 22 Euro.