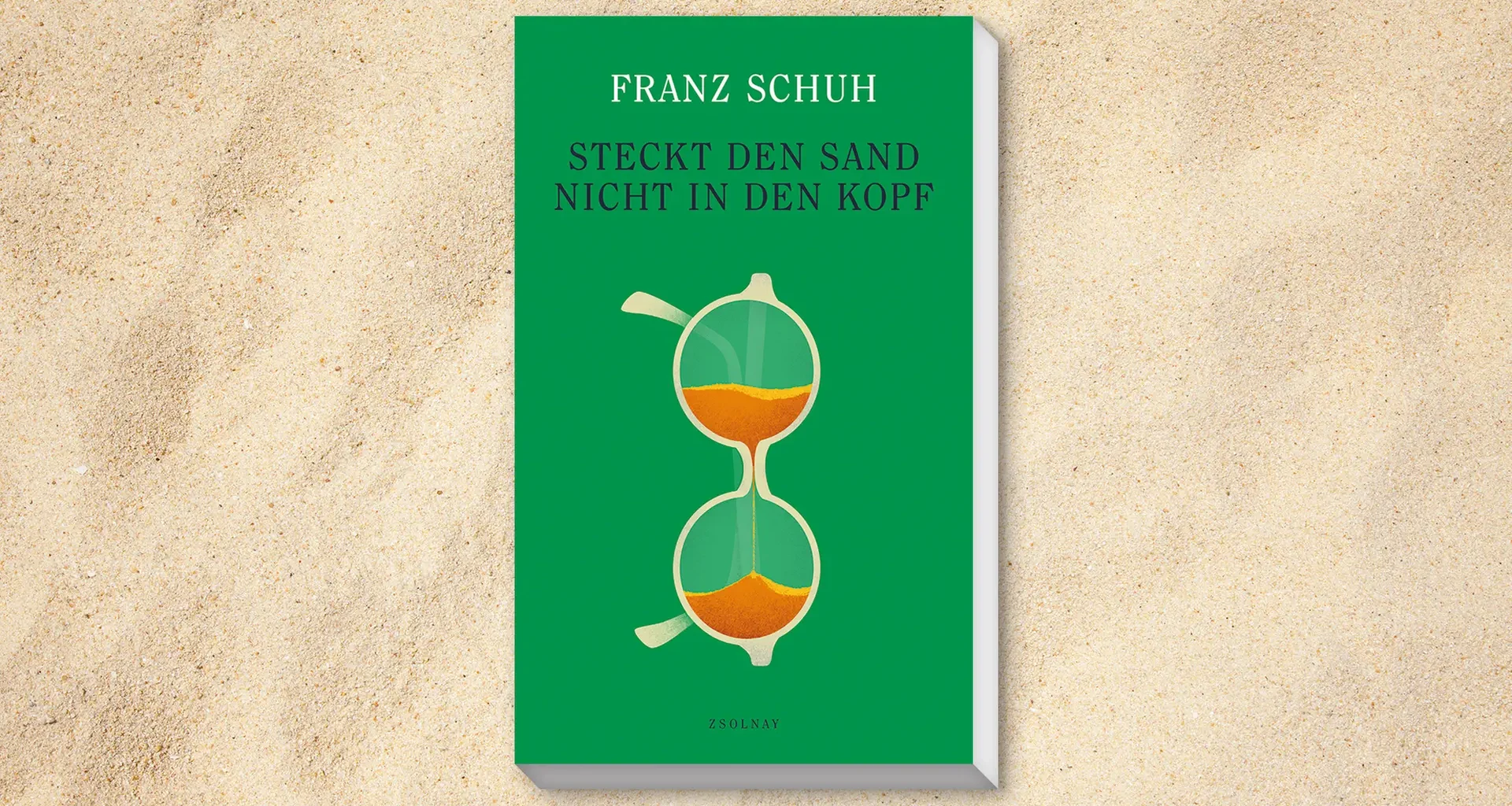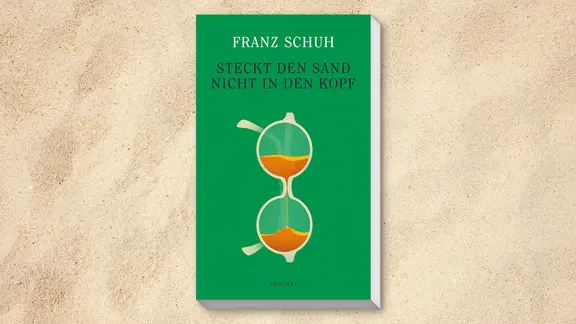
Stand: 23.09.2025 06:00 Uhr
Einen liebenswerten „Grantler“ könnte man Franz Schuh nennen. In „Steckt den Sand nicht in den Kopf“ reflektiert der Wiener mit Humor und Tiefgang über die komplexe Gegenwart.
Franz Schuh formuliert mit unverwüstlichem Humor, mit Eleganz und nahezu unzerstörbar wirkender Nächstenliebe seine Gedanken über unsere Zeit, die man eben nicht mehr mit vorangegangen Epochen vergleichen kann, auch wenn man aus der Geschichte lernen könnte. Das Wort „Sand“ aus dem Titel steht da für vieles:
Das Wort „Sand“ gehört zu den Wörtern, die sich in erprobter Weise hervorragend für Metaphern eignen: Existiert etwas in Überfülle (und kann daher nichts Besonderes sein), sagt man „wie Sand am Meer“. Juristisch kann man über eine Anzeige sagen, dass sie „im Sand verläuft“. Es gibt auch das schöne Wort „absandeln“ – es meint einen Niedergang, bei dem eine feste, stabile Figur oder Struktur zu Sandkörnern zerbröckelt. Der abgesandelte Mensch heißt „Sandler“. In Gesellschaft dieser Wörter habe ich vor allem eines im Sinn: die Sanduhr. Sie zeigt das Vergehen der Zeit – anders als die mechanische oder digitale Uhr – anhand des verrinnenden Sands, also am Materiellen, am Stofflichen. (…) Manche stecken den Sand, den man ihnen in die Augen streut, gleich in den Kopf.
Leseprobe
Gesellschaftskritik und Zukunftsängste in der modernen Welt
Franz Schuh beschreibt die unterschiedlichsten, oft so unvereinbar wirkenden Bereiche in der modernen Gesellschaft. Es geht um Scheinriesen der kulturellen Landschaft und gelegentliche Verzweiflung angesichts unserer Zukunftsperspektive. Er spielt an auf skandalumwitterte Politiker oder Wirtschaftsschurken, die erkannt haben, dass man heutzutage nicht nur reiche Menschen oder Unternehmen bestehlen könnte, sondern besser gleich die Staaten, die große Gemeinschaft der Steuerzahler betrügen.
Differenzierte Sichtweisen zum Nahost-Konflikt
Seine Ansichten zum Konflikt im Nahen Osten gehören zum Klügsten und Differenziertesten, was ich bisher darüber gehört und gelesen habe. Er formuliert, dass es falsch sei, nur zu einer Seite zu halten, sondern beide berücksichtigen muss. Das klingt so banal, aber wer die Nachrichten verfolgt, wird beobachten können, dass genau das eben zu selten gemacht wird. Und immer wieder besteht Franz Schuh auf einem möglichen philosophischen Gegenentwurf durch die Kultur.
In vagen Seelenzuständen, im träumerischen Grübeln glaube ich, dass am besagten Dreiklang vom Guten, Wahren und Schönen doch etwas dran sein könnte, dass damit eine Utopie anklingt, die unwirklich bleibt, aber keiner Menschenseele verborgen sein sollte. Die Kunst bewahrt recht und schlecht etwas von dieser Illusion. In ihr stabilisiert sich ein guter Sinn für Spiritualität, der in der „entzauberten Welt“ abgemeldet erscheint, und der auch Elend und Schmerz berücksichtigt. Im besten Fall lenkt die Kunst nicht vom Entsetzlichen ab, sondern sie notiert und tradiert die Erfahrungen, die Menschen damit machen. Die Konfrontation mit dem Apokalyptischen kann man aber nicht fordern, weil die Kunst unbedingt eine heitere Seite hat – im Spiel ist der Mensch bei sich. Doch im Leid ist er es nicht minder, auch wenn er mit Schmerzen außer sich und trostlos zu sein scheint.
Leseprobe
Franz Schuhs bereichernde Gedankenwelt
Franz Schuhs Text wirkt beim Lesen wie ein Gespräch mit einem vertrauten, sehr klugen Freund, dem es gelingt, die eigene Gedankenwelt nicht einfach zu bestätigen, sondern zu befragen und zu bereichern.
Schlagwörter zu diesem Artikel