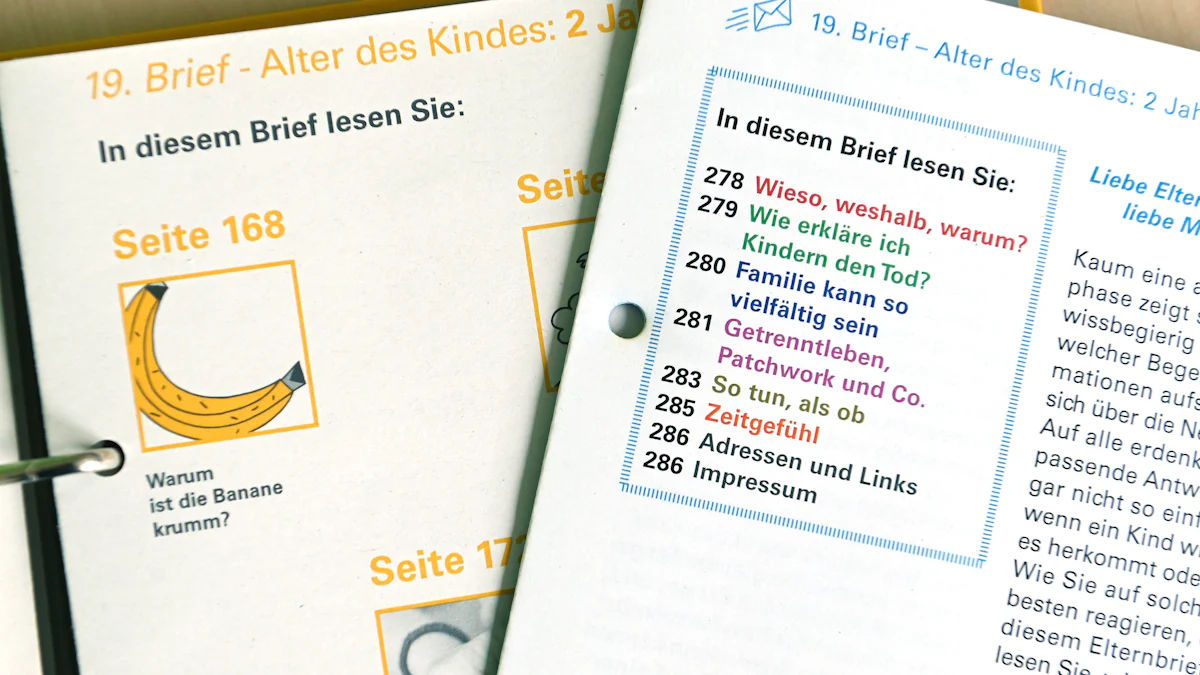Und ja, die brauche es auch heute noch, sagt Bernhard Kühnl, Leiter der Erziehungsberatungsstellen des Münchner Jugendamtes. „Wir zeigen Möglichkeiten auf. Wir versuchen Eltern nicht zu erziehen, sondern zu sagen: Ihr habt eine hohe intuitive Kompetenz, vertraut darauf und lasst euch nicht kirre machen.“ Und wenn es Hilfe brauche, dann lieferten die Briefe die passenden Beratungsstellen und Ansprechpartner gleich mit, passend zu Problemlage und Alter des Kindes. Kühnl sagt, die Briefe sollen Mut machen, freundliche Hinweise geben statt absoluter Ratschläge, begleiten.
„Erziehung ist eines der schönsten Abenteuer“, sagt der Psychologe. „Kinder sind nicht gleich, was bei einem funktioniert, muss nicht auch beim anderen passen. Bei einem ist ein engeres Regelkonzept sinnvoll, bei dem anderen nicht. Das Abenteuer ist es, da einen Mittelweg zu finden.“ Genau dabei sollen die Elternbriefe helfen. Mütter und Väter, die in München leben, bekommen sie für ihr erstes Kind ungefragt mit der Post. Und das seit Kurzem nicht mehr in gelb-schwarz, sondern in Farbe.
Die Briefe sind nicht nur bunter geworden. In den vergangenen Monaten wurden sie umfassend überarbeitet und erweitert, es gibt sie nun auch als Newsletter, insgesamt 46 Stück, von der Geburt bis zum 18. Geburtstag – bisher endeten sie im Alter von 14. Mitte September hat der Münchner Stadtrat diese Änderungen beschlossen, die neuen Briefe werden von nun an verschickt. „In jeder Altersstufe gibt es Herausforderungen, für die Eltern nicht immer Antworten haben“, sagt die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), die selbst Mutter ist. „Die Briefe helfen, hier Orientierung zu finden und Hilfestellung zu geben.“
Die vielleicht wichtigste Änderung: Die Briefe wurden um Themen ergänzt, die vor mehr als 20 Jahren noch keine große Rolle spielten: Smartphones, Ganztag, Pornos im Internet.
Eltern von sechs Monate alten Babys bekommen eine Checkliste, was sie im Urlaub dabeihaben sollten, die Mütter und Väter Fünfjähriger erfahren, dass sie sich in München frühzeitig um einen Platz im Seepferdchen-Schwimmkurs kümmern sollten, weil die Kurse oft schnell ausgebucht sind. Und im Elternbrief für Zehnjährige geht es darum, wie verführerisch es sein kann, Wissenslücken beim Thema Sexualität mithilfe des Internets zu füllen.
„Sehr viele Kinder kommen im Alter von zehn Jahren das erste Mal mit Pornografie in Kontakt“, heißt es. Entweder beim Surfen im Netz oder weil im Freundeskreis Bilder und Videos herumgeschickt werden. Eine Seite weiter geht es um Cybermobbing und Regeln für Social Media, und warum Handyverbot bei Mobbingattacken nicht weiterhilft.
Der Umgang mit Medien sei das beherrschende Thema geworden, sagt der Psychologe Bernhard Kühnl, und das spiegelt sich nun auch in den Elternbriefen wider. Wenn ihr Kind zwei Monate alt ist, lesen Eltern, dass das Smartphone den Kontakt zum Baby störe. „Denn wenn Sie auf das Smartphone schauen, gleicht Ihr Gesichtsausdruck einem ausdruckslosen Starren“, heißt es in dem neuen Elternbrief. „Ihr Baby versucht stets in Ihrer Mimik zu lesen. Sieht es dann aber nur das ausdruckslose Gesicht, wirkt dies verunsichernd und beängstigend.“
Steigende Schülerzahlen in München
:Der große Ansturm auf die Gymnasien
Münchens Gymnasien sind wegen der Rückkehr zu G9 so voll wie seit Jahren nicht mehr. Einige, wie die Willy-Brandt-Gesamtschule, beziehen ihren Neubau. Doch andere beklagen massive Raumnot.
SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff
Weiter geht es um Kinderfotos im Internet, um Jugendschutzsicherungen und die ständige Präsenz der Smartphones im Familienalltag. Eltern von Dreijährigen wird zum Beispiel empfohlen, das Smartphone nicht zu nutzen, um ein Kind ein paar Minuten abzulenken. Klar, das funktioniere, sagt Kühnl. „Aber es ist keine angemessene Art der Beruhigung. Wenn Eltern dauerhaft das Smartphone zur Ablenkung nutzen, dann gewöhnen sich die Kinder dran. Sie sind eigentlich von den visuellen Reizen überfordert, aber trotzdem fasziniert, weil da immer was blinkt.“
Vor mehr als 60 Jahren, im November 1962, verschickte das Münchner Jugendamt die ersten Elternbriefe – damals waren sie etwas völlig Neues. Der Bayerische Rundfunk würdigte es in einem Fernsehbeitrag als einen „für Bayern noch neuartigen Weg“, die Süddeutsche Zeitung schrieb von einer „erfolgreichen Aktion“ des Stadtjugendamtes. Peter-Pelikan-Briefe hießen sie anfangs, so wie das Vorbild aus den USA. Der Arbeitskreis Neue Erziehung in Berlin und dann auch die Stadt München hatten sich die Briefe dort abgeschaut.
Damals sprachen die Briefe, wie die SZ im August 1963 schrieb, Themen „auf eine leicht verständliche und liebenswürdige Weise“ an, „ohne daß dahinter der erhobene Zeigefinger des Sachverständigen spürbar wird“. Es ging um Töpfchen und Sauberkeit, darum, dass Kinder „nicht immer wie aus dem Ei gepellt auszusehen brauchen“. Und von Anfang an auch um ernste Themen: „Viele greifen immer dann zur Prügelstrafe, wenn sie nicht weiterwissen und doch fühlen, daß sie etwas tun müßten“, heißt es in einem Brief. „Nach dem Prügeln fühlen sie, daß sie etwas getan haben. Ob es aber das Richtige war?“
Jede Menge Dankesbriefe mit beigelegten Kinderfotos erhielt das Stadtjugendamt in den 1960er-Jahren auf die Erziehungstipps per Post. Eine Mutter schrieb: „Die Briefe haben uns beiden den Frieden unserer Ehe wiedergegeben, weil wir nun beide genau wissen, was richtig ist und vor allem habe ich nun auch mehr Zeit für meinen Mann.“
Dankesbriefe und Lob erreichen das Stadtjugendamt immer noch – wie viele Münchner Eltern die Briefe wirklich lesen, das wissen sie dort allerdings nicht. Möglicherweise kann in Zukunft die Zahl der Newsletter-Abos einen Hinweis darauf geben, wie groß die Nachfrage ist.
Neue Themen, neues Design, was blieb, ist die Haltung: „Die Elternbriefe haben nicht den Touch, den Eltern zu sagen, Erziehung muss so und so funktionieren“, sagt Bernhard Kühnl. „Es gibt unterschiedliche Kinder und Eltern, es gibt eine gewisse Bandbreite der Erziehung.“ Trends in der Pädagogik? Völlig okay, sagt er, solange sie sich in einem Rahmen bewegen.
 Bernhard Kühnl leitet die städtischen Erziehungsberatungsstellen des Jugendamtes. In seinem Haus wurden die neuen Elternbriefe entwickelt. (Foto: Foto: Robert Haas)
Bernhard Kühnl leitet die städtischen Erziehungsberatungsstellen des Jugendamtes. In seinem Haus wurden die neuen Elternbriefe entwickelt. (Foto: Foto: Robert Haas)
Hat sich das Eltern-Sein verändert? Vieles davon nicht, meint Kühnl. „Die Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nach Liebe, Bindung und Wertschätzung, nach Kontrolle und Orientierung, das sind die gleichen wie vor 20 Jahren.“ Was sich verändert habe, seien die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. „Es gibt jetzt sehr viel mehr Eltern, die unter einem Zeitmangel leiden. Sie sind stark eingespannt mit der Bewältigung des Alltags, der Berufstätigkeit und dem Haushalt.“ Darunter könne die Erziehung der Kinder leiden, sagt Kühnl, denn: „Um ein Kind zu erziehen, müssen Eltern Zeit mit ihm verbringen.“
Und manchmal, sagt er, dürften Eltern sich eingestehen, dass nicht alles möglich ist. Wenn es Ärger in der Familie gibt, weil die Hausaufgaben trotz Ganztagsbetreuung abends nicht erledigt sind, dann brauchten die Eltern keine Erklärungen, wie sie mit ihrem Kind lernen sollen. „Das können sie eigentlich, aber nicht in dieser besonderen Situation, wenn nach einem langen Tag alle müde sind.“ Was hilft? Klären, warum die Hausaufgaben nicht wie vorgesehen in der Betreuung gemacht wurden. Inseln der Ruhe im Alltag suchen. Und vielleicht ab und zu auf die Hausaufgaben verzichten, meint Kühnl. „Nach einem Neun-Stunden-Tag ist keiner mehr in der Lage zu lernen.“
Wenig verschafft Eltern so viel Erleichterung, wie zu wissen, dass es anderen so geht wie ihnen. Zu lesen, dass es zum Alter passt, wenn es einem Grundschulkind auf einmal fürchterlich peinlich ist, sich nackt oder in Unterwäsche zu zeigen; dass es okay ist, wenn Eltern sich hilflos und überfordert fühlen, weil Aufstehen, Anziehen, Essen und ins Bett gehen regelmäßig zu Stress und Streit führen, schon das macht das Eltern-Sein leichter. Und hilft vielleicht dabei, Erziehung wieder so zu sehen, wie der Psychologe Bernhard Kühnl es beschreibt: als Abenteuer.