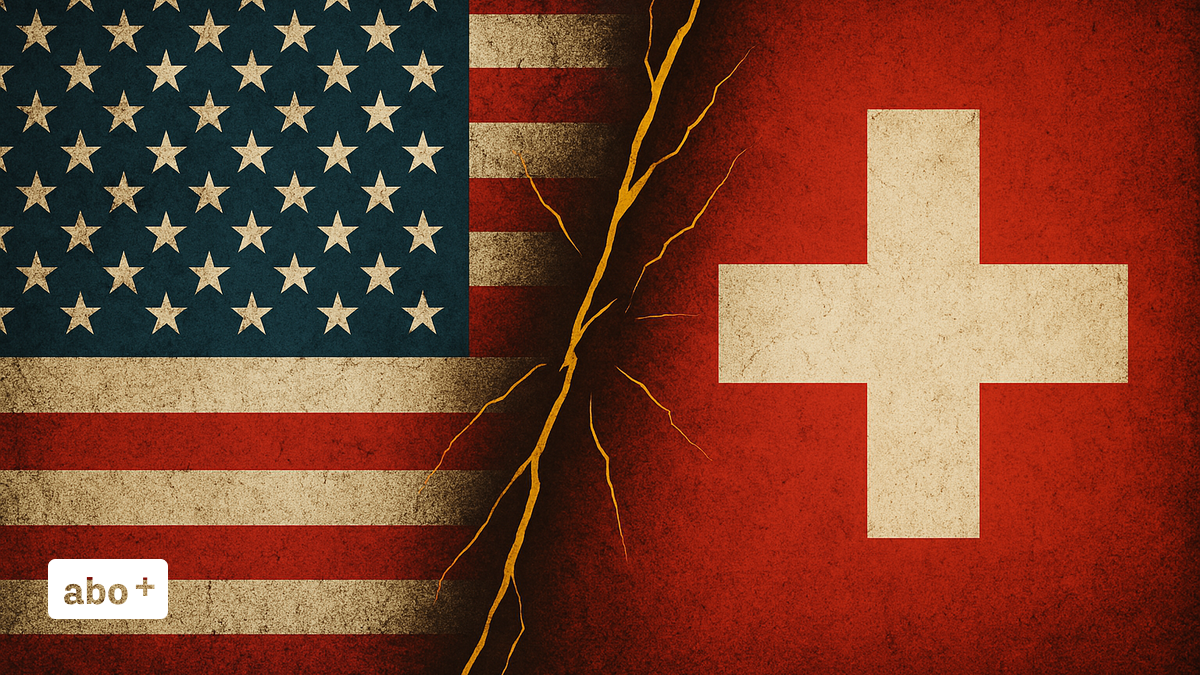Trumps Zölle sind zum Scheitern verurteilt – was die Schweiz jetzt tun sollte
US-Präsident Trump hat seinen Zollhammer niedersausen lassen. Dass er die Schweiz überdurchschnittlich stark trifft, zeigt den Irrwitz seines Vorgehens.
Ausgerechnet Amerika, Inbegriff der freien Welt, Vorreiter der Globalisierung, will zurück zum Protektionismus. Zurück in die Ära vor dem Zweiten Weltkrieg. Dabei ist nicht nur, aber gerade Amerika reich geworden durch Freihandel. Das ist Konsens unter Ökonomen, vielleicht abgesehen von ein paar sehr linken, staatsgläubigen Aussenseitern.
Nun, Trump hat mit den Zöllen Wahlkampf gemacht, das Wort «Tariff» als das schönste überhaupt bezeichnet. Der Hammer kam deshalb mit Ansage. Erstaunlich bleibt zweierlei: dass ein US-Präsident ungehindert und im Alleingang, ohne Parlament, solch weitreichende Entscheide bis auf den Prozentpunkt genau treffen und exekutieren kann. Und dass er die Zölle sehr breitflächig einsetzt, gegen Freund und Feind.
Wenn Trump China, den «Systemgegner» der USA, mit hohen Tarifen belegt, hat das durchaus seine Richtigkeit. US-Unternehmen sollen einen Anreiz haben, nicht dort zu produzieren. Trump bestraft aber auch die EU, das Nicht-EU-Land Grossbritannien und sogar Argentinien, das von seinem Buddy Milei regiert wird.
Zu den Freunden der USA zählt zweifellos die Schweiz. Sie wird mit einem Strafzoll von 31 Prozent belegt. Die Zahl ist Hokuspokus, ein typischer Trump-Pfusch: Seine Beamten haben das Handelsdefizit der USA gegenüber der Schweiz durch den Wert der Güter geteilt, welche die Schweiz aus Amerika importiert. Diese Quote diente dann als Basis zur Zollberechnung.
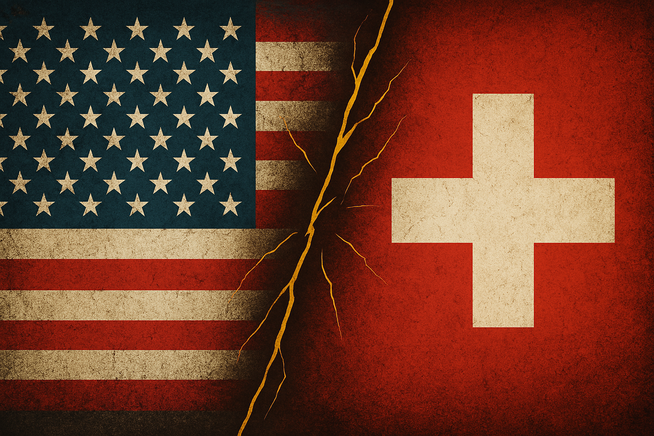
Diese «Logik» gilt auch bei der Zollberechnung für andere Länder. Sie ergibt aber wenig Sinn, unter anderem deshalb, weil sie die Art der gehandelten Güter nicht berücksichtigt. Im Fall der Schweiz ist das Vorgehen besonders widersprüchlich: Pharmaprodukte – die mit Abstand wichtigsten Exportgüter – werden offenbar von den Zöllen ausgenommen. In die Hokuspokus-Formel mit den 31 Prozent fliessen sie aber trotzdem ein.
Abgesehen davon schaden die Zölle allen. Auch und gerade den USA. Man kann dies an einem einfachen Beispiel illustrieren. Die Schweiz produziert die beste Schokolade der Welt und die Amerikaner kaufen sie, weil sie sie lieben. Das macht das Leben der Amerikaner reicher. Jede Alternative ist schlechter: Wenn die Amerikaner die Schweizer Schokolade weiterhin kaufen, aber 31 Prozent mehr bezahlen. Oder wenn sie auf amerikanische Schokolade umsteigen, die sie weniger gut mögen. Die Konsumenten sind so oder so schlechter gestellt.
Genauso wenig wie im Kleinen kann sich im Grossen die vermeintliche «Goldene Ära» entfalten, die Trump mit den Zöllen einläuten will.
Produktionsverlagerungen nach Amerika sind unrealistisch
Es ist unrealistisch, dass die Schweizer Schokoladenhersteller ihre Produktion in die USA verlagern. Ebenso, dass die Schweizer Maschinenindustrie jetzt Fabriken dort aufbaut. Solche unternehmerischen Entscheide werden nicht für eine Phase von dreieinhalb Jahren getroffen, die Trump im Amt noch bevorstehen.
Mit hoher Sicherheit werden die Zölle aber bei weitem nicht einmal seine Amtszeit überleben. Wie schon in der Coronapandemie, die zu seiner Abwahl führte, wird Trump auch bei den Zöllen nicht an den Fakten vorbeiregieren können. Nichts macht in den USA unpopulärer als hohe Inflation, geschweige denn eine Rezession. Wenn Trumps Zölle die Wirtschaft dorthin führen, wird die Stimmung schnell gegen den Präsidenten kippen. Denn die «kleinen Leute», deren Fürsprecher er zu sein vorgibt, spüren die Inflation am schnellsten.
Die «unsichtbare Hand des Marktes», auf welche die Kapitalisten immer vertraut haben, wird wohl auch das Problem der Zölle lösen. Steigt die Inflation, sinkt die Zustimmung zu Trump, und dieser ist in einer Disziplin unschlagbar: Entscheide wieder umzudrehen.
Der Bundesrat sollte deshalb vorerst nichts überstürzen. In den Handelskrieg einzusteigen und hohe Gegenzölle auf US-Produkte auszurufen, würde wenig bewirken. Die Schweizer Diplomatie muss schlauer vorgehen. «The Art of the Deal», Trumps Buch, wurde in den Berner Departementen hoffentlich bereits gelesen. Hilfreich ist auch, sich im Umgang mit Narzissten weiterzubilden.
Wenn die Beziehungen der Schweiz zur US-Administration so gut sind, wie in Bern immer behauptet wird, müssen Lösungen gefunden werden, um die 31 Prozent runterzubringen. Idealerweise, bevor die «unsichtbare Hand des Marktes» Trump zur Aufgabe bewegen wird.
Aktuelles aus dem Bereich Wirtschaft