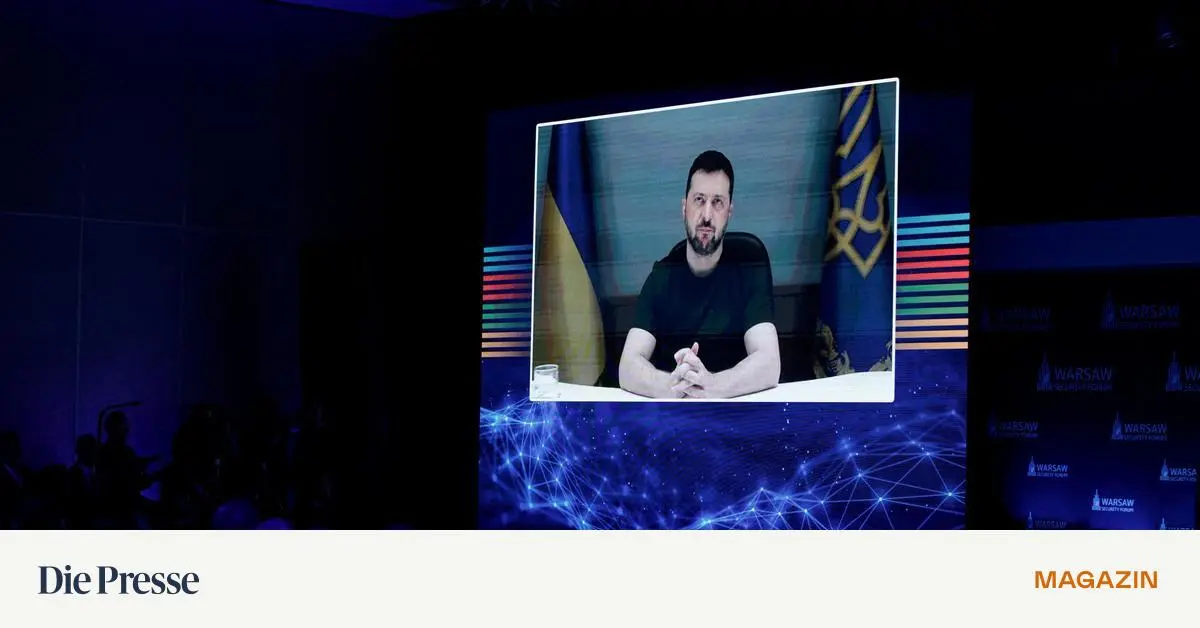Rund 176 Milliarden Euro an Vermögen der russischen Zentralbank liegen seit Februar 2022 auf einem Konto der belgischen Finanzfirma Euroclear auf Eis. Kann man dieses Geld der Ukraine überweisen, um sich gegen die russische Aggression zu wehren, ihr Staatswesen zu finanzieren, und zumindest einen Teil der Kriegsschäden zu reparieren?
Nein, lautete bisher die klare Linie der Union. Zwar werden die Zinserträge des eingefrorenen russischen Vermögens abgeschöpft, und der Ukraine in Form von langjährigen Darlehen zur Verfügung gestellt. Die Mitgliedstaaten wagten es aber bisher nicht, das russische Kapital an sich zu konfiszieren. Belgien voran befürchtete, von Russland vor internationalen Schiedsgerichten verklagt zu werden. Andere Mitgliedstaaten bringen vor, dass Russland seinerseits europäische Vermögenswerte im Land einziehen würde. Auch die Europäische Zentralbank lehnt es ab, auf dieses Vermögen zuzugreifen. Die Reputation Europas als sicherer Finanzplatz, in dem die Eigentumsrechte hochgehalten werden, stünde auf dem Spiel.
Not macht erfinderisch
Doch die finanziellen Nöte der EU und ihrer Mitgliedstaaten sind groß. Die Suche nach neuen Geldquellen, um die Ukraine zu unterstützen, hat zumindest in der Europäischen Kommission die juristische Kreativität angeregt. „Auf Basis der liquiden Anteile könnten wir der Ukraine ein Reparationsdarlehen gewähren“, sagte deren Präsidentin, Ursula von der Leyen, im Europäischen Parlament bei ihrer Rede zur Lage der Union am 10. September. „Die Vermögenswerte selbst bleiben unberührt. Und das Risiko wird gemeinsam getragen. Die Ukraine wird das Darlehen erst zurückzahlen, wenn Russland Reparationszahlungen leistet. Das Geld würde der Ukraine schon heute helfen.“
Seither nimmt diese Idee zaghaft, aber unaufhaltsam Form an. Am Donnerstag voriger Woche legte die Kommission den EU-Botschaftern ein eineinhalb Seiten kurzes Konzept vor. Kurz darauf wurde es an die Medien durchgestochen. Seither kann man sich eine klarere Vorstellung davon machen, wie von der Leyens „Reparationsdarlehen“ aussehen soll.
Garantie der EU-Staaten
Und zwar so: das russische Zentralbankvermögen besteht en gros aus Anleihen. Diese werden nach und nach fällig. Aufgrund der EU-Sanktionen darf Euroclear weder deren Nennwert, noch die fälligen Zinserlöse an Russland auszahlen. Dieses Geld wird derzeit auf gleichsam mündelsichere Weise veranlagt, nämlich bei der EZB. Die Kommission schlägt nun vor, dass die EU bei Euroclear ein zinsloses Darlehen aufnimmt, und zwar in der Höhe des eingefrorenen russischen Vermögens, also rund 180 Milliarden Euro (weitere Anleihen werden demnächst fällig, und erhöhen somit das Guthaben bei Euroclear).
Aus diesem Darlehen würde die EU ihrerseits ein Darlehen an die Ukraine finanzieren, „das nur dann von der Ukraine zurückgezahlt werden würde, falls es Kriegsreparationen von Russland erhält“, heißt es in dem Papier. „Die Operation müsste von den Mitgliedstaaten voll garantiert werden, um die Fähigkeit der Union sicherzustellen, an Euroclear zu zahlen, sobald es die Summen einziehen muss.“ Die Kommission ist sich jedoch sicher, dass dieser Fall nie eintreten wird: Euroclear darf ja laut EU-Sanktionenbeschluss nicht an Russland ausschütten, solange Russland keine Reparationen an die Ukraine leistet, und dazu ist der Kreml nicht bereit.
Das klingt so genial, dass man eine wesentliche Schwäche fast übersehen könnte: der Sanktionenbeschluss muss alle sechs Monate erneuert werden. Dazu braucht es Einstimmigkeit. Und die bedroht fast jedes Mal das derzeit von der moskautreuen Partei Fidesz regierte Ungarn.
Dieses Problem möchte die Kommission mit einem zweiten, noch kühneren Trick lösen. „Um größere Sicherheit zu gewähren, dass die Sanktionen nicht aufgehoben werden, sollte es anerkannt werden, dass die Bedingungen von Artikel 31 Absatz 2 des EU-Vertrages für den Einsatz von qualifizierter Mehrheitsabstimmungen für die Verlängerung der Sanktionen erfüllt sind“, schlägt sie in ihrem Papier vor. Besagter Artikel sieht vor, dass der Europäische Rat, also die 27 Staats- und Regierungschefs, dies als Gegenstand der „strategischen Interessen und Ziele der Union“ qualifiziert.
Würde sich Viktor Orbán, Ungarns Regierungschef, so einfach die Vetokeule entreißen lassen? „Das würde eine hochrangige politische Vereinbarung von allen oder den meisten Staats- und Regierungschefs erfordern“, resümiert das Papier knapp. Die Kommission hofft jedenfalls, auf diese Weise der Ukraine rund 140 Milliarden Euro an Reparationsdarlehen leisten zu können. Die restlichen rund 40 Milliarden Euro müssten hingegen für die Finanzierung der bereits laufenden Ukrainehilfe reserviert werden. Denn die wird auch aus den Zinserträgen des Vermögens gespeist – und das kann nur Zinsen abwerfen, wenn es eingefroren bleibt.
„Das ist eine juristische Frage, und ich möchte unseren Juristen nicht vorgreifen“, ließ ein hochrangiger EU-Diplomat am Montag eine diesbezügliche Frage abperlen. Am Mittwoch werden die Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen jedenfalls bei ihrem informellen Gipfeltreffen erstmals über diesen Plan diskutieren. Und am 10. Oktober wird es in Luxemburg auf dem Tapet der Finanzminister liegen.