Porträt einer Ausnahmeautorin –
Dorothee Elmiger spürt der Gewalt nach, und wir fragen uns: Dürfen wir das sehen?
«Die Holländerinnen» steht verdientermassen auf der Shortlist für den Deutschen und den Schweizer Buchpreis. Wir haben eine der spannendsten Schweizer Autorinnen der Gegenwart getroffen.
 Publiziert heute um 10:45 Uhr
Publiziert heute um 10:45 Uhr
Dorothee Elmiger (40) lässt sich Zeit fürs Schreiben und bleibt ihrem Stil auf bewundernswerte Art treu.
Foto: Gaëtan Bally (Keystone)
Sie interessiere sich gar nicht fürs Erfinden, sagt Dorothee Elmiger bei einem Espresso in Zürich. Man muss ihr nicht lange zuhören, um zu merken: Von dieser Autorin und ihrer Kunst geht ein besonderer Zauber aus. Das Erfinden ist für die 40-Jährige eine Art, an etwas zu gelangen, was eben nicht erfunden ist.
Mit ihrem neuen Roman «Die Holländerinnen» steht sie jetzt, wie schon mit ihrem letzten Buch, «Aus der Zuckerfabrik» (2020), auf der Shortlist für den Schweizer und den Deutschen Buchpreis. Ganz gereicht hat es bis jetzt noch nie. Sie wäre eine würdige Gewinnerin.
Wer ist diese Frau, die seit fünfzehn Jahren auf bewundernswerte Art ihrem ganz eigenen Stil treu bleibt? Die Sätze sagt wie: «Ein Text ist etwas Künstliches und keine Simulation des Lebens.» Oder: «Für das Schreiben gibt es keine Erfahrung, man beginnt mit jedem Buch neu.»
«Die Holländerinnen», ihr viertes Buch, ist einer der aufregendsten Titel in diesem Herbst. Eine knapp 160-seitige Erzählung. Wer denkt, toll, das kann ich zwischen Bus und Büro lesen: nix da. Und wer denkt, ach so, da wird viel zitiert, da werden Referenzen hergestellt, muss ich etwa parallel googeln, um alles zu enträtseln, und obendrauf ist es konsequent in indirekter Rede geschrieben – nein, danke: Halt, halt!
Dorothee Elmigers Bücher entziehen sich jedem Genre
Wir haben es mit einer Art Kunst-Ideenroman zu tun, der sich immer mehr in einen Trip verwandelt, das ist unheimlich gut gemacht. «Die Holländerinnen» wird von manchen auch als True-Crime-Fiction gelesen (es ist aber eigentlich ein Kommentar zur True-Crime-Obsession).
Das wäre sonst sehr zeitgemäss, Elmigers Bücher entziehen sich aber virtuos einem bestimmten Genre. Gegenwärtig ist aber die Frage, die die Autorin antreibt: «Warum leben wir auch heute noch in einer Gesellschaft, die, trotz aller Einsichten, durchtränkt ist von Gewalt und Herrschaftsverhältnissen? Im Umgang mit der sogenannten Natur, in der Familie, unseren Liebesbeziehungen, in der Sprache – und in der Kunst.»
Die Holländerinnen verschwinden, und auf dem Tisch steht eine Schinkenkeule
Im Buch soll die Erzählerin eine Vorlesung halten. Sie nutzt diesen Moment aber, um von einem Abenteuer im südamerikanischen Regenwald, zu dem sie eingeladen wurde, zu erzählen. Eine Theatergruppe bricht in den Dschungel auf, um Spuren eines Vermisstenfalls zu finden. Zwei Holländerinnen sind, und das ist wahr, 2014 bei einer Wanderung im Urwald von Panama verschwunden und nie mehr zurückgekehrt.

«Im ersten Moment wirkt meine Arbeit nicht besonders spektakulär, aber ich frage mich auch: Bin ich rücksichtslos?», sagt Dorothee Elmiger, die jetzt mit ihrem Roman für den Deutschen und den Schweizer Buchpreis nominiert ist.
Foto: Georg Gatsas
Angeleitet wird dieses Experiment von einem namenlosen Theatermacher, dem es hauptsächlich um sich selbst geht. Und wenn gerade nicht, zitiert er gerne Werner Herzog oder Adorno. Immer mehr wird deutlich, wenn Mitglieder der Gruppe der Erzählerin von vermeintlich Alltäglichem erzählen, welches Grauen darin steckt, ausgelöst durch die Bedrängnis des Dschungels. Und so legt die Sprache einen ganz eigenen Horror frei, der sich aber auch konkret zeigt, wenn immer mehr Ziegen tot geboren werden oder der Kameramann eine verstörende Leidenschaft beim Pferdezähmen entdeckt.
Hinreissend sind auch die Milieubeschreibungen: In einer Wohnung steht eine Schinkenkeule, von der sich die Gäste feine Scheiben abschneiden, bis alle mit ihren fettigen Fingern herumstehen und über russische Drohnen und Didier Eribon diskutieren und unentschlossen sind darüber, wie man Ingeborg Bachmanns Todesarten geschickt ins Englische übersetzen könnte.
Damit Elmiger schreiben kann, muss sie alle Konventionen und Regeln von sich wegstossen, dann kann sie sich ins Ungewisse hineinfallen lassen. «Für mich ist das Schreiben eine radikale und freie Form, mich mit der Welt zu beschäftigen.»
Idealerweise bekomme sie dabei etwas zu fassen, das in der «Wirklichkeit» geschieht, und bewege sich beim Weiterforschen dann ausserhalb des Erwartbaren. Und wie!
Dorothee Elmiger liest selber viel, «um in Stimmung zu kommen»
Ihre Bücher erscheinen in Abständen von fünf bis sechs Jahren. «In der heutigen Zeit, in der man stets produktiv und effizient sein soll, zu sagen, ich probiere die nächsten drei Jahre einfach etwas aus, ist eigentlich völliger Irrsinn.» Aber das gelte es auszuhalten, «dass man in diesem Sinne völlig versagt».
Am liebsten hätte sie einen Zettelkasten mit Exzerpten, um dieses Gestrüpp, das später Text wird, zu sammeln. Und natürlich muss, wer viel zitiert und dies zu einer eigenen Erzählung verwebt, viel lesen. «Zum Beispiel Thomas Bernhard, um in Stimmung zu kommen», erzählt sie und lacht.
Der Theatermacher arbeitet mit Laien an realen Schauplätzen und bringt sie zunehmend in Bedrängnis. Beim Lesen entsteht eine Atmosphäre, in der wir uns fragen: Was haben wir gesehen und gehört, das gar nicht für uns bestimmt ist? «Es geht für mich auch da immer um die Gewaltfrage», sagt Elmiger. «Wo bedient man sich Geschichten anderer? Und wo passieren in der Kunst Grenzverletzungen?»
Die konsequent indirekte Rede ist ein stilistisches Spiel, eine Art Filter. Auf der allerersten Seite steht, vorweggenommen, bei dem, was wir später lesen werden, handelt es sich womöglich um eine «Zudringlichkeit». So zu erzählen ist Ausdruck für Elmigers Skepsis gegenüber dem ungebrochenen Erzählen. «Die indirekte Rede war für mich ein spielerischer Umgang mit der Frage: Muss man sich immer selbst in den Text hineinschreiben?»
Und sie spart nicht an männlichen Autoritäten. Adorno, Thomas Bernhard, Klaus Kinski, Wolfram Lotz, Joseph Conrad und Werner Herzog, sie treten alle auf und werden sehr unterhaltsam ein bisschen vorgeführt. «Es wäre aber vermessen, zu glauben, ich könnte demontieren – und das interessiert mich auch gar nicht.»
Herzog hat nun ein Instagram-Profil. Es folgen ihm knapp 500’000 Leute, er folgt niemandem. Wir schauen uns das Video an, wie der 83-jährige Star-Regisseur hinter einem Grill steht, darauf ein Stück Fleisch. In seinem herzogschen Englisch erzählt er, es sei der Moment gekommen, dass er mit uns auch Dinge abseits seiner Kunst teile. Dorothee Elmiger ist begeistert. «Es wäre interessant, zu wissen, wer ihn filmt.»
Sie selbst will sich nicht von allen Seiten beleuchten lassen, sie hat zwar ein Instagram-Profil, ist dort aber eher abwesend. Wie hoch ist der Druck von aussen? «Ich stelle mir ab und zu die Frage, kann ich es mir leisten, da nicht mitzumachen?»
Als der Roman im August erschienen ist, war sich die Kritik einig, Vorlage für die Figur des Theatermachers sei Milo Rau, ob ihn Elmiger gar parodiere? «Ich bin auch der Theatermacher!», sagt sie mit einem Schalk, vor dem man sich in Acht nehmen sollte.
Diese Figur sei interessant, weil der Theatermacher einen ähnlichen Grundimpuls habe wie sie. «Im ersten Moment wirkt meine Arbeit nicht besonders spektakulär, aber ich frage mich auch: Bin ich rücksichtslos? In welche Hierarchien bin ich verstrickt und wann begehe ich eine Grenzverletzung?»
«Die Holländerinnen» ist ein ein ungemütliches, aber nicht zähes Buch
Wer ihr Werk kennt, weiss, dass sie nicht vom Leben abschreibt. Dass sie aus Raus Poetikvorlesungen zitiert, ist Teil dieses Spiels mit der Intertextualität, dem Kern ihrer Kunst.
Er hat sich unterdessen selbst in einem Artikel geäussert. Er sei kein Adorno- oder Herzog-Fan. Aber: «Was wäre dagegen einzuwenden, selbst zum Material zu werden?» Es scheint ihm schon zu schmeicheln, sich vielleicht etwas «in Elmigers Buch aufzulösen».
Obwohl sich ein Unbehagen durch den Roman zieht, ist es kein schweres, zähes Buch. Dafür gibt es zu viel zu entdecken. Und Elmiger ist begabt genug, um aus dem Gestrüpp ihres Materials eine eigenständige Erzählung zu machen.
Man wird ins Dschungeldickicht hineingerissen, schaut dabei zu, wie rechts und links alles in Gewalt und Angst abgleitet, bis man von durchaus Zuversichtlichem zurückgezogen wird. Sie sei keine fatalistische Person, findet Elmiger. «Der Akt des Schreibens an sich ist immer dem Leben zugewandt. Deshalb ist der Text für mich nicht verzweifelt.»
Und so ist auch das Ende ein schelmischer New Turn. Man denkt: Moment! Jetzt schaut uns die Autorin doch dabei zu, wie sich vor uns plötzlich ein Science-Fiction-artiges «flimmerndes, instabiles» Portal öffnet und dann – wer weiss. Wobei, Dorothee Elmiger will doch eigentlich gar nicht sehen, was nicht für ihre Augen bestimmt ist.
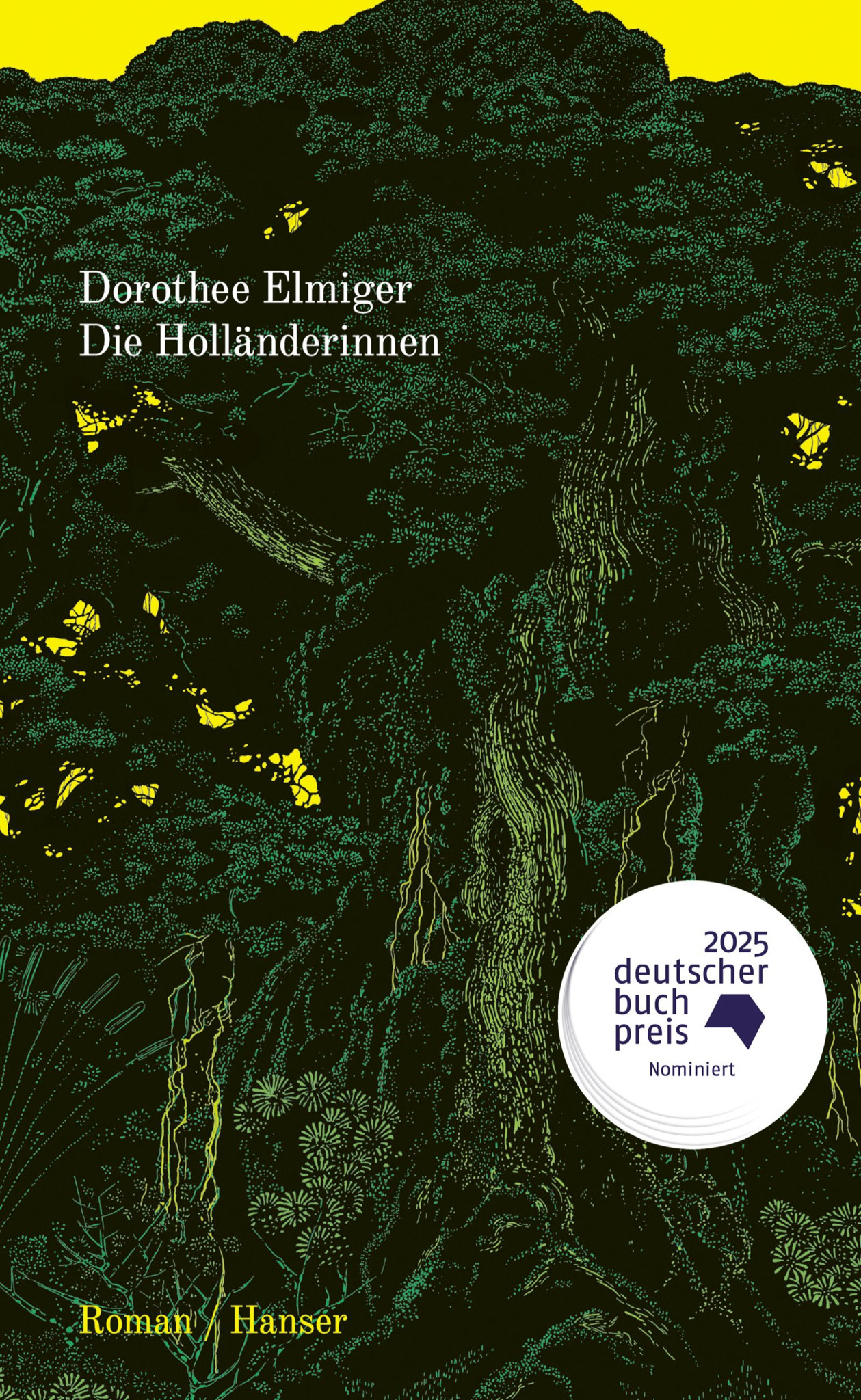
Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen. Hanser, 2025. 160 S., ca. 33 Fr.
Nora Zukker ist die Literaturredaktorin im Ressort Leben und berichtet schwerpunktmässig über deutschsprachige Gegenwartsliteratur.Mehr Infos
Fehler gefunden?Jetzt melden.
0 Kommentare
