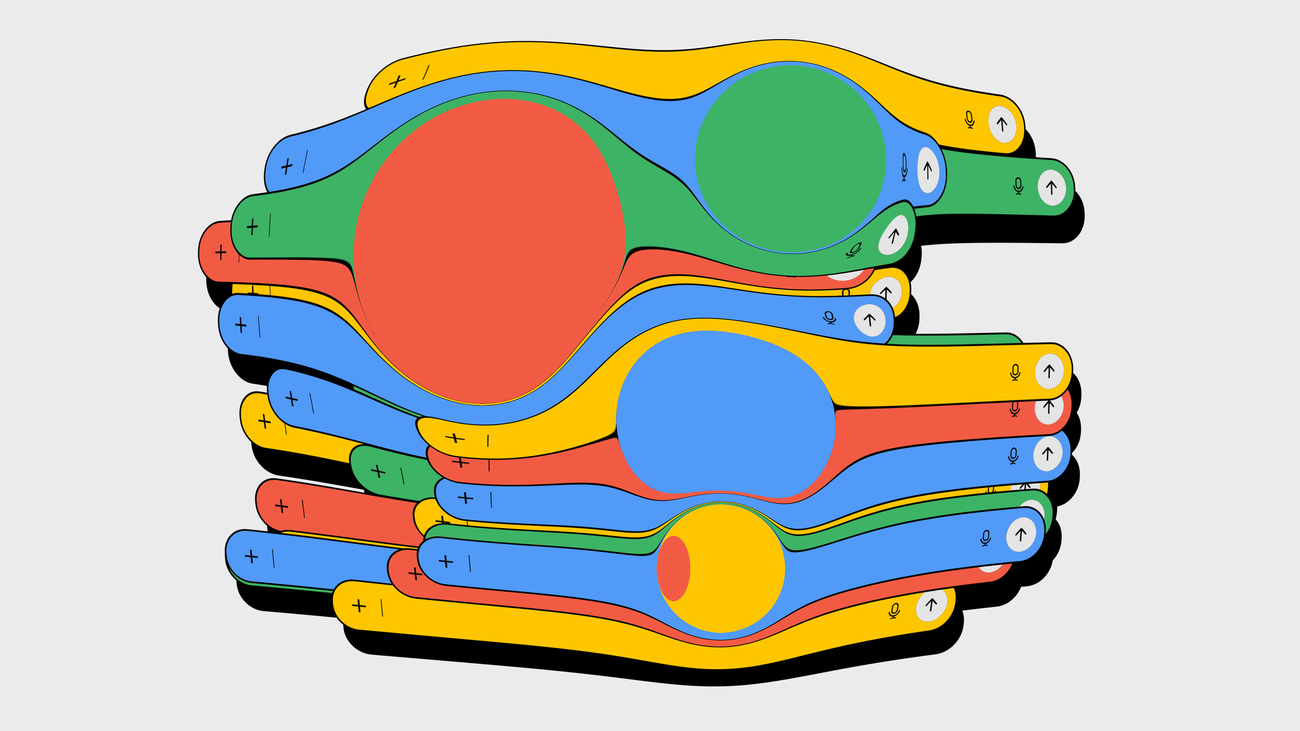Von den vielen Dingen, die Menschen im Internet unternehmen, ist Googeln sicher eines der häufigsten. In einer Minute werden weltweit fast zehn Millionen Anfragen an die Suchmaschine gestellt. Es hilft, sich solche Zahlen vor Augen zu halten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet, wenn Google sich verändert: Es betrifft praktisch alle.
Deshalb ist es keine Kleinigkeit, was Google nun auch in Deutschland startet: Nutzerinnen und Nutzer können innerhalb der Suchmaschine einen Chatbot befragen, der das Internet durchsucht und auf Basis der gefundenen Quellen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) eine Antwort formuliert. Dieser sogenannte KI-Modus ist ab Mittwoch auf google.de verfügbar, zusätzlich zur normalen Websuche, die eine Liste von Websites zurückgibt.
In anderen Ländern ist die Funktion schon seit Mai verfügbar, jetzt schaltet Google sie auch in Europa frei. Der Konzern setzt damit eine Vision fort, die schon Anfang 2023 in einer Art Wettlauf mit Konkurrent Microsoft formuliert wurde: KI soll aus Suchmaschinen Antwortmaschinen machen. „Die Suchmaschine half dabei, Informationen abzurufen. Der große Moment mit KI-Modellen ist jetzt, dass man die Informationen mit Intelligenz kombinieren kann“, sagte Nick Fox, der bei Google unter anderem für die Suche und das Anzeigengeschäft verantwortlich ist, bei einer Pressekonferenz in Berlin.
Der KI-Modus ist eine Art Erweiterung der Funktion „Übersicht mit KI“, die Google-Nutzer in Deutschland schon seit Monaten sehen. Diese KI-generierten Antworttexte erscheinen bei manchen Suchanfragen über den herkömmlichen Ergebnissen. Neu ist im KI-Modus, dass Nutzer Rückfragen stellen können. Der Modus kann direkt per Button, als neuer Reiter neben Web-, Bilder- oder Produktsuche oder aus manchen KI-Übersichtsantworten heraus angewählt werden. Die Funktion wird in den nächsten Tagen allen Nutzern in Deutschland zur Verfügung gestellt.
© ZEIT ONLINE
Newsletter
Natürlich intelligent
Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt.
Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement.
Ideal soll der Modus für komplexere Fragen sein, die nicht auf einer einzelnen Website beantwortet werden. Auf eine Frage wie: „Welche unterschiedlichen Knödelsorten gibt es in Deutschland?“, erzeugte Google schon bislang eine KI-Übersicht. Nun kann man im KI-Modus weiter ins Detail gehen und etwa nachfragen, wie man einen ordentlichen fränkischen Kloß hinbekommt.
Die Oberfläche des KI-Modus erinnert stark an Chatbots wie ChatGPT oder Googles Gemini. Auch technisch basiert die KI-Suche auf den gleichen Modellen wie der Chatbot, der ebenfalls auf das Internet zugreifen kann. Dennoch soll der KI-Modus laut Google noch einmal anders sein, stärker auf Websuche fokussiert, wobei unklar ist, welche Unterschiede es im Detail gibt.
Woher kommen die Antworten?
Die eigene Websuche mit KI zu verknüpfen, ist aus Sicht von Google eine Möglichkeit, sich gegen die zunehmende KI-Konkurrenz, etwa ChatGPT, zu behaupten. Aus Sicht der Urheber der Inhalte, aus denen der Bot seine Antworten generiert, ist die neue Funktion aber möglicherweise ein Problem. Denn sie könnte dazu führen, dass weniger Menschen tatsächlich auf Websites klicken, wenn ihnen die Antworten der KI genügen. Verlagen etwa könnte so eine wichtige Einnahmequelle wegbrechen. In den USA und Großbritannien, wo es den KI-Modus schon gibt, gibt es Verlagshäuser, die bereits von solchen KI-Effekten berichten.
Google sagt dazu, dass die Klickraten trotz KI in der Suche alles in allem „relativ stabil“ blieben. So schrieb es Liz Reid, Leiterin der Suche bei Google, im August in einem Blogpost. Demnach stünden Googles eigene (und geheime) Daten „im Gegensatz zu Berichten von Drittanbietern, die fälschlicherweise einen dramatischen Rückgang“ verzeichneten. Genauer wollte sie auch auf Nachfrage in Berlin nicht werden. Die Zahl der „hochqualitativen“ Klicks steige demnach sogar leicht. Gemeint sind Klicks, bei denen Nutzer die angewählte Seite nicht sofort wieder verlassen.
Überhaupt gebe es durch die KI-Funktionen insgesamt mehr Suchanfragen. Veränderungen beim Traffic einzelner Anbieter müssten nicht unbedingt mit Google zu tun haben. „Nutzertrends verlagern den Traffic auf verschiedene Websites, was zu einem Rückgang des Traffics auf einigen Websites und einem Anstieg des Traffics auf anderen Websites führt“, schreibt Reid in dem Blogpost und verweist auf Inhalte, die besonders zum Klicken anregen würden: „Eine ausführliche Rezension, ein origineller Beitrag, eine einzigartige Perspektive oder eine durchdachte Analyse aus der Ich-Perspektive.“
Die Argumentation ähnelt der, die Google schon lange zu seinen – zum Teil hart umkämpften – Suchplatzierungen formuliert. Die Suchmaschine soll die Inhalte zutage fördern, die am besten zur Suchanfrage passen und die höchste Qualität haben. Was das im Detail bedeutet, bleibt wohl nicht unabsichtlich vage. Google hat einen geheimen Algorithmus, der bestimmt, welche Seiten wie „gut“ bewertet werden.
Die meisten Menschen, die Google regelmäßig nutzen, wissen, wozu das mitunter führt. Ein ganzer Wirtschaftszweig ist um die sogenannte Suchmaschinenoptimierung, auf Englisch search engine optimization (SEO), entstanden. Teilweise ist damit gemeint, tatsächlich relevante Inhalte mit gezielt gewählten Schlagworten dem Bewertungssystem der Suchmaschine anzudienen. Man kann das damit vergleichen, dass ein gutes Produkt auch eine vielsagende Verpackung braucht, um verstanden und gekauft zu werden.
Nicht immer ist der beste Inhalt am weitesten oben
Allerdings ermöglicht das System auch Mogelpackungen. Die Suchergebnisse sind voll mit Inhalten, die nur scheinbar hoch relevant und genau passend zu bestimmten Schlagwörtern sind, aber in Wahrheit im Wesentlichen dazu dienen, Besuchern möglichst viele nervige Werbeanzeigen auszuspielen oder ein Produkt zu bewerben. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Berichte, dass die Google-Suche schlechter werde – auch aufgrund solcher SEO-optimierten Pseudoinformationen.
Wie viele andere Probleme verschwindet auch dieses nicht einfach magisch durch KI. Im Gegenteil: Es besteht die Gefahr, dass die Antworten, die der KI-Modus generiert, auf ebensolchen, bestenfalls mittelmäßigen Inhalten basieren, einfach, weil sie in der zugrunde liegenden Google-Suche ganz oben angezeigt werden. Denn der KI-Modus ist „in seinem Herzen immer noch Suche“, wie Reid sagte.
In einem Beispiel in ihrer Demonstration fragte sie die KI nach der Geschichte des Ostberliner Ampelmännchens. Eine von drei angegebenen Quellen war die Website einer Berliner Firma, die Fahrradtouren für Touristen anbietet. Vermutlich hat diese Firma einen Text zum Ampelmännchen auf ihrer Website, um in entsprechenden Suchergebnissen aufzutauchen.
Das ist weder verwerflich noch muss es bedeuten, dass die Informationen auf dieser Seite falsch sind – aber ist es wirklich eine der drei besten Quellen für diese Information im ganzen, weiten Internet? Google-Suche-Chefin Reid sagte dazu in Berlin, der KI-Modus sei noch neu und man arbeite daran, Quellen mit immer höherer Qualität für die Antworten zu verwenden.
Bislang spielt der KI-Modus in den USA wohl nur eine kleine Rolle, gemessen an den Milliarden Suchanfragen, die Google verarbeitet. So sagte es Reid in Berlin. Die meisten Menschen nutzten die normale Suche inklusive der KI-Übersichten.
Aber je weiter sich die KI-Funktionen verbreiten, umso härter umkämpft werden für Verlage und andere Anbieter von Inhalten die wenigen verbliebenen Plätze, auf denen Links angezeigt werden. Und umso drängender stellt sich für die Nutzer die Frage, wie gut die KI wirklich darin ist, die beste Quelle auszuwählen.